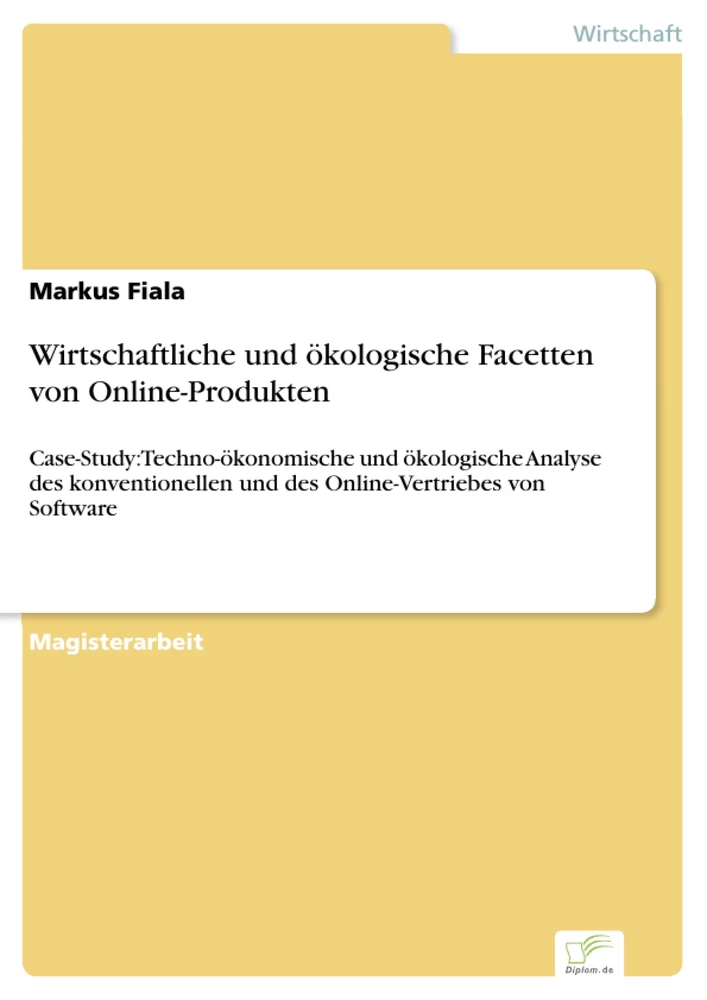Wirtschaftliche und ökologische Facetten von Online-Produkten
Case-Study: Techno-ökonomische und ökologische Analyse des konventionellen und des Online-Vertriebes von Software
©2005
Magisterarbeit
119 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den Auswirkungen und Möglichkeiten neuer, innovativer Produkt- bzw. Distributions- und Vertriebsgestaltung mittels Internet. Die IT Industrie war einer der größten Wirtschaftsmotoren der vergangenen 20 Jahre und hatte als solcher vielfältige Auswirkungen ökonomischer und ökologischer Art. Neue Produkte sind entstanden und neue Industriezweige wurden geschaffen.
Gleichzeitig entstanden auch neue ökologische Herausforderungen durch den Ressourcenverbrauch auf der einen Seite und den neuartigen Abfällen auf der anderen Seite. Wertvolle Substanzen verarbeitet in Elektronikbauteilen, Datenträgern, Kabeln etc. werden oft binnen weniger Jahre zu Abfall. Die Produktlebenszyklen in unserer schnelllebigen Gesellschaft werden immer kürzer, die Geräte veraltern in manchen Branchen bereits nach Monaten. Beispielsweise ist es bei vielen Software-Herstellern üblich, jedes Jahr neue Updates herauszubringen zumeist verpackt in einem Karton mit Handbuch und Datenträger (CD).
Gerade Software eignet sich jedoch als - im Kern - unkörperliches Produkt hervorragend zur Distribution als Online-Produkt über das Internet. Dieses Beispiel liefert auch gleichzeitig den Einstieg in diese Arbeit: Nach einer Einführung über die Entwicklung des IT-Marktes und einer Betrachtung des Softwaremarktes im speziellen, sollen die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen von herkömmlicher Software einerseits (Boxprodukt) und Download- Software andererseits (Online-Produkt) dargestellt werden. Die Analyse der ökonomischen Einsparungsmöglichkeiten erfolgt in Form einer Gegenüberstellung der Produktions- und Folgekosten bei herkömmlicher Box- Software und bei Download-Software.
Bei den ökologischen Faktoren wird in erster Linie auf die Datenträger (CD/DVD) als Hauptbestandteil von Box-Software fokussiert. Beginnend mit der Darstellung der Synthese der Rohstoffe wird der Herstellungsprozess und die Zusammensetzung einer CD/DVD näher beleuchtet. In Kombination mit der Abschätzung der recyclierten Mengen lässt sich zusammenfassend im letzten Kapitel dann ein (vereinfachter) Stoffkreislauf skizzieren, der die ökologische Belastung übersichtlich zeigt.
Folgendes Zitat ist wohl nicht nur auf Computer anwendbar, sondern gilt für nahezu alle Produkte der Informationsgesellschaft und Internetwirtschaft: Das Schnellste, was ein Computer macht, ist, dass er rasend schnell […]
Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den Auswirkungen und Möglichkeiten neuer, innovativer Produkt- bzw. Distributions- und Vertriebsgestaltung mittels Internet. Die IT Industrie war einer der größten Wirtschaftsmotoren der vergangenen 20 Jahre und hatte als solcher vielfältige Auswirkungen ökonomischer und ökologischer Art. Neue Produkte sind entstanden und neue Industriezweige wurden geschaffen.
Gleichzeitig entstanden auch neue ökologische Herausforderungen durch den Ressourcenverbrauch auf der einen Seite und den neuartigen Abfällen auf der anderen Seite. Wertvolle Substanzen verarbeitet in Elektronikbauteilen, Datenträgern, Kabeln etc. werden oft binnen weniger Jahre zu Abfall. Die Produktlebenszyklen in unserer schnelllebigen Gesellschaft werden immer kürzer, die Geräte veraltern in manchen Branchen bereits nach Monaten. Beispielsweise ist es bei vielen Software-Herstellern üblich, jedes Jahr neue Updates herauszubringen zumeist verpackt in einem Karton mit Handbuch und Datenträger (CD).
Gerade Software eignet sich jedoch als - im Kern - unkörperliches Produkt hervorragend zur Distribution als Online-Produkt über das Internet. Dieses Beispiel liefert auch gleichzeitig den Einstieg in diese Arbeit: Nach einer Einführung über die Entwicklung des IT-Marktes und einer Betrachtung des Softwaremarktes im speziellen, sollen die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen von herkömmlicher Software einerseits (Boxprodukt) und Download- Software andererseits (Online-Produkt) dargestellt werden. Die Analyse der ökonomischen Einsparungsmöglichkeiten erfolgt in Form einer Gegenüberstellung der Produktions- und Folgekosten bei herkömmlicher Box- Software und bei Download-Software.
Bei den ökologischen Faktoren wird in erster Linie auf die Datenträger (CD/DVD) als Hauptbestandteil von Box-Software fokussiert. Beginnend mit der Darstellung der Synthese der Rohstoffe wird der Herstellungsprozess und die Zusammensetzung einer CD/DVD näher beleuchtet. In Kombination mit der Abschätzung der recyclierten Mengen lässt sich zusammenfassend im letzten Kapitel dann ein (vereinfachter) Stoffkreislauf skizzieren, der die ökologische Belastung übersichtlich zeigt.
Folgendes Zitat ist wohl nicht nur auf Computer anwendbar, sondern gilt für nahezu alle Produkte der Informationsgesellschaft und Internetwirtschaft: Das Schnellste, was ein Computer macht, ist, dass er rasend schnell […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9174
Fiala, Markus: Wirtschaftliche und ökologische Facetten von Online-Produkten - Case-
Study: Techno-ökonomische und ökologische Analyse des konventionellen und des
Online-Vertriebes von Software
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Wirtschaftsuniversität Wien, Magisterarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
FIALA
Inhaltsverzeichnis
I
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG ... 1
2.
DIE ENTWICKLUNG DES ONLINE MARKTES ... 2
2.1
Das Zeitalter der Informationsgesellschaft... 2
2.1.1
Übergang von Atomen zu Bits ... 2
2.1.2
Übergang von Produkten zu Dienstleistungen ... 3
2.1.3
Übergang von vertikaler zu virtueller Integration... 3
2.1.4
Übergang zu sich selbst organisierenden Systemen... 4
2.1.5
Übergang von Geld zu Zeit ... 4
2.1.6
Übergang von Gewinn und Verlust zu Marktkapitalisierung ... 4
2.2 Der
Goldrausch... 5
2.3
Einflüsse von E-Commerce auf die traditionelle Wirtschaft... 8
2.3.1
Intensivierung des Wettbewerbs ... 8
2.3.2 Virtuelle
Organisationen ... 9
2.3.3 Grenzenlose
Unternehmen ... 10
2.3.4
Umgestaltung der bestehenden Wertschöpfungskette... 10
3.
DAS INTERNET ALS INSTRUMENTARIUM DER
INFORMATIONSGESELLSCHAFT... 13
3.1
Die Anfänge des Internet... 13
3.2
Grundlagen für Geschäfte über das Internet... 13
3.2.1 Internetzugang ... 14
3.2.2
Varianten und Qualität der Internetzugänge ... 15
3.2.3 Informationsangebot... 17
3.2.4
Sichere Server für den Online-Handel und Online-Transaktionen ... 18
3.2.5
Akzeptanz der ,,New Economy" ... 19
3.3
Abgrenzung Online-Shopping und Online-Produkte ... 22
3.3.1
Materielle Voraussetzungen für den virtuellen Einkauf... 22
3.3.2
Nebeneffekte des Online-Shopping... 23
3.4
Online Produkte neue Artikel rund um das und durch das Internet ... 25
3.5
Immaterieller Konsum und Sustainable Development... 27
4.
BESTANDSAUFNAHME VON ONLINE PRODUKTEN AM BEISPIEL
SOFTWARE ... 31
4.1
Entwicklung des Software Marktes... 31
4.2
Download-Software in Österreich und Deutschland... 33
4.2.1 www.amazon.de ... 34
4.2.2 www.softline.de... 35
4.2.3 www.softwarehouse.de ... 37
4.2.4 www.steckenborn.com ... 38
4.2.5 www.ixq-software-shop.de
... 39
4.2.6 www.winsoftware.de
... 41
4.2.7 www.winload.de
... 42
FIALA
Inhaltsverzeichnis
II
4.2.8 www.softwaredschungel.com ... 43
4.2.9 www.cadshop.cc... 45
4.2.10 www.softwarediskont.com... 46
4.2.11 www.waltersoftware.at... 47
4.3 Zusammenfassung
der
Bestandsaufnahme... 48
4.4
Online Produkte als Wettbewerbsvorteil... 50
5.
ÖKONOMISCHE ASPEKTE VON ONLINE PRODUKTEN ... 54
5.1 Klassisches
Boxprodukt ... 54
5.1.1 Produktionskosten ... 54
5.1.1.1 Datenträger ... 54
5.1.1.2 Handbuch... 57
5.1.1.3 Umverpackung ... 57
5.1.1.4 Arbeitszeit ... 57
5.1.1.5 Zusammenfassung der Produktionskosten ... 58
5.1.2 Transportkosten... 59
5.1.2.1 Transportverpackung... 59
5.1.2.2 Transport ... 59
5.1.2.3 Lieferzeit ... 59
5.1.3 Lagerkosten ... 59
5.1.4 Abgaben... 61
5.1.4.1 Zölle... 61
5.1.4.2 Steuern... 61
5.2 Download-Software
(Online-Produkt):... 62
5.2.2 Produktionskosten ... 62
5.2.3 Transportkosten... 62
5.2.4 Lagerkosten ... 64
5.2.5 Abgaben... 65
5.2.5.1 Zölle... 65
5.2.5.2 Steuern... 65
5.3 Zusammenfassende
Betrachtung
der ökonomischen Vorteile ... 65
6.
ÖKOLOGISCHE ASPEKTE VON ONLINE PRODUKTEN ... 67
6.1
Das MIPS Konzept... 67
6.1.1
Notwendigkeit der Ressourcenökonomie... 67
6.1.2 Entropie ... 68
6.1.2.1 Entropie-Definition... 68
6.1.2.1 Entropieverlauf bei Datenträgern (Software) ... 69
6.1.3
Methodik des MIPS Konzepts... 70
6.1.4
Der Lebenszyklus von Software... 72
6.2 Klassisches
Boxprodukt ... 73
6.2.1
Bestandteile eines Boxprodukts ... 73
6.2.1.1 Papier / Karton... 77
6.2.1.2 Datenträger ... 77
6.2.2
Chemische Zusammensetzung einer CD/DVD:... 78
6.2.3 Struktur
einer
Compact Disc / DVD ... 81
6.2.4
Der Fertigungsprozess einer CD/DVD... 83
FIALA
Inhaltsverzeichnis
III
6.2.4.1 Das Spritzgussverfahren... 84
6.2.4.2 Die Metallisierung... 85
6.2.4.3 Die Lackierung ... 85
6.2.4.4 Qualitätssicherung ... 85
6.2.4.5 Integrierte Fertigungssysteme ... 86
6.2.4.6 Fazit ... 86
6.2.5 Sammlung... 86
6.2.6 Recycling... 87
6.2.6.1 Exkurs: Recyclingexperiment im Labor... 88
6.2.6.2 Der Aufbereitungsprozess bei der Bayer AG... 89
6.2.7 Verwertungsquoten ... 91
6.2.8
Abfallminimierung durch Innovationen... 91
6.2.9 Fazit ... 92
6.3 Online
Produkt ... 93
6.3.1
Sonderfall: Sicherung auf CD-R ... 94
6.3.2
Erweiterung der Systemgrenzen... 95
7.
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK ... 97
7.1 Boxprodukte ... 97
7.2 Online
Produkte... 99
8. GLOSSAR... 102
9. LITERATURVERZEICHNIS... 103
9.1
Bücher und Studien ... 103
9.2 Skripten ... 104
9.3
Beiträge in Sammelwerken und Zeitschriften ... 104
9.4
Gesetze, Normen, Nachschlagewerke ... 105
9.5 Persönliche
Gespräche ... 105
9.6 Internet... 105
9.7 Sonstige
Quellen... 109
FIALA
Abbildungsverzeichnis
IV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1: Entwicklung des Aktienkurses und Handelsvolumens von Yahoo Inc. ... 6
Abb. 2: Entwicklung der Serveranzahl (für ecommerce) im Vergleich zum
NASDAQ-Index ... 7
Abb. 3: Internetzugänge pro 100 Einwohner ... 15
Abb. 4: Internetzugang Entwicklung in den OECD Ländern ... 16
Abb. 5: Breitbandinternetzugang Stand in den OECD Ländern... 17
Abb. 6: Sichere Server pro 100.000 Einwohner ... 18
Abb. 7: Darstellung der Internetnutzung im Vergleich zu Internetbestellungen
(Personen) ... 19
Abb. 8: Internetnutzung im Vergleich zu Online-Bestellungen (getätigt/empfangen)
von Unternehmen... 20
Abb. 9: Anteil des Online-Handels am Gesamtumsatz des Handelssektors... 21
Abb. 10: Steigender Konsumenteneinfluss mit dem Anteil des Internet am
Einkaufsprozess ... 24
Abb. 11: Beispiel für ein Online Produkt: digitale Bücher bei ebooks.com... 26
Abb. 12: Beispiel für ein Online Produkt: Video on Demand bei T-Online ... 27
Abb. 13: Lizenzvertrag zu Windows XP Pro... 32
Abb. 14: Screenshot zur Website von www.amazon.de ... 34
Abb. 15: Screenshot zur Website von www.softline.de ... 36
Abb. 16: Screenshot zur Website von www.softwarehouse.de ... 37
Abb. 17: Screenshot zur Website von www.steckenborn.com ... 39
Abb. 18: Screenshot zur Website von www.ixq-software-shop.de ... 40
Abb. 19: Screenshot zur Website von www.winsoftware.de... 41
Abb. 20: Screenshot zur Website von www.winload.de... 43
Abb. 21: Screenshot zur Website von www.softwaredschungel.com ... 44
Abb. 22: Screenshot zur Website von www.cadshop.cc... 45
Abb. 23: Screenshot zur Website von www.softwarediskont.com... 47
FIALA
Abbildungsverzeichnis
V
Abb. 24: Screenshot zur Website von www.waltersoftware.at... 48
Abb. 25: Entwicklung der E- Business Initiativen... 53
Abb. 26: Grafische Darstellung der Verpackungskosten bei CDs/DVDs ... 56
Abb. 27: Verlauf der relativen statistischen Entropie am Beispiel Zink ... 69
Abb. 28: Der ökologische Rucksack am Beispiel ,,Gold" ... 71
Abb. 29: Berechnung des MIPS Faktors... 72
Abb. 30: Flowchart für Software (unabhängig von der Distributionsform) ... 73
Abb. 31: Flowchart für Software (physisches Produkt)... 75
Abb. 32: Synthese von Polycarbonat mit Phosgen ... 79
Abb. 33: Synthese von Polycarbonat ohne Phosgen und ohne org. Lösungsmittel... 80
Abb. 34: Spurbild von CD und DVD im Vergleich... 82
Abb. 35: Grundlegende Schritte des CD-Recycling ... 90
Abb. 36: Flowchart für Software (Online Produkt) ... 93
Abb. 37: Ökologischer Kreislauf von Polycarbonat ... 98
FIALA
Tabellenverzeichnis
VI
TABELLENVERZEICHNIS
Tab. 1: Übergänge in der Wirtschaft im Zeitalter des Internet ... 2
Tab. 2: Zusammenfassung der Bestandsaufnahme in Deutschland/Österreich ... 49
Tab. 3: Erfolgsmotoren in der traditionellen Wirtschaft und in der Internetwirtschaft ... 51
Tab. 4: Verpackungskosten bei CDs/DVDs... 55
Tab. 5: Zusammenfassung der Produktionskosten... 58
Tab. 6: Entwicklung der Preise bei Computerspielen am Beispiel von ,,Knights of the
Cross"... 60
Tab. 7: Preise für Internet - Einwahlverbindungen ... 63
Tab. 8: Zusammenfassende Betrachtung Klassisches Produkt Online Produkt... 66
Tab. 9: Materialverbauch für die Produktion von 1.000.000 CDs ... 76
Tab. 10: Überblick über die gängigsten DVD Arten... 78
FIALA
Abkürzungsverzeichnis
VII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ADSL ... Asymmetric Digital Subscriber Line
AOL ... America Online
bzw. ... beziehungsweise
CD ... Compact Disc
d.h. ... das heißt
d.s. ... das sind
DSL ... Digital Subscriber Line
DVD ... Digital Versatile Disc
EC ... Electronic Commerce
EU ... Europäische Union
EUR ... Euro
g ... Gramm
GATT... General Agreement on Tariffs and Trade
GB ... Gigabyte
ISP ... Internet Service Provider
IT ... Informationstechnik
IUPAC ... International Union of Pure and Applied Chemistry
kBit/s ... Kilobit pro Sekunde
kg ... Kilogramm
kN ... Kilo-Newton
MB ... Megabyte
mm ... Milimeter
OECD ... Organization for Economic Co-operation and Development
rd. ... rund
sec ... Sekunde
SSL ... Secure Socket Layer
t ... Tonnen
u.a. ... unter anderem
UID ... Umsatzsteueridentifikationsnummer
USA ... United States of America
USt ... Umsatzsteuer
UStG ... Umsatzsteuergesetz
UV... ultraviolett
v.a. ... vor allem
WTO ... World Trade Organization
4c ... 4 Farben
FIALA
1.
Einleitung
1
1. EINLEITUNG
Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den Auswirkungen und
Möglichkeiten neuer, innovativer Produkt- bzw. Distributions- und
Vertriebsgestaltung mittels Internet.
Die IT Industrie war einer der größten Wirtschaftsmotoren der vergangenen 20 Jahre
und hatte als solcher vielfältige Auswirkungen ökonomischer und ökologischer Art.
Neue Produkte sind entstanden und neue Industriezweige wurden geschaffen.
Gleichzeitig entstanden auch neue ökologische Herausforderungen durch den
Ressourcenverbrauch auf der einen Seite und den neuartigen Abfällen auf der anderen
Seite. Wertvolle Substanzen verarbeitet in Elektronikbauteilen, Datenträgern, Kabeln
etc. werden oft binnen weniger Jahre zu Abfall. Die Produktlebenszyklen in unserer
schnelllebigen Gesellschaft werden immer kürzer, die Geräte veraltern in manchen
Branchen bereits nach Monaten. Beispielsweise ist es bei vielen Software-Herstellern
üblich, jedes Jahr neue Updates herauszubringen zumeist verpackt in einem Karton
mit Handbuch und Datenträger (CD).
1
Gerade Software eignet sich jedoch als - im Kern - unkörperliches Produkt
hervorragend zur Distribution als Online-Produkt über das Internet. Dieses Beispiel
liefert auch gleichzeitig den Einstieg in diese Arbeit:
Nach einer Einführung über die Entwicklung des IT-Marktes und einer Betrachtung
des Softwaremarktes im speziellen, sollen die ökonomischen und ökologischen
Auswirkungen von herkömmlicher Software einerseits (Boxprodukt) und Download-
Software andererseits (Online-Produkt) dargestellt werden.
Die Analyse der ökonomischen Einsparungsmöglichkeiten erfolgt in Form einer
Gegenüberstellung der Produktions- und Folgekosten bei herkömmlicher Box-
Software und bei Download-Software.
Bei den ökologischen Faktoren wird in erster Linie auf die Datenträger (CD/DVD) als
Hauptbestandteil von Box-Software fokussiert. Beginnend mit der Darstellung der
Synthese der Rohstoffe wird der Herstellungsprozess und die Zusammensetzung einer
CD/DVD näher beleuchtet. In Kombination mit der Abschätzung der recyclierten
Mengen lässt sich zusammenfassend im letzten Kapitel dann ein (vereinfachter)
Stoffkreislauf skizzieren, der die ökologische Belastung übersichtlich zeigt.
Folgendes Zitat ist wohl nicht nur auf Computer anwendbar, sondern gilt für nahezu
alle Produkte der Informationsgesellschaft und Internetwirtschaft:
,,Das Schnellste, was ein Computer macht, ist, dass er rasend schnell
veraltet!"
2
Willy Meurer
(*1934), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, Toronto
1
SNEED, H. / HASITSCHKA, M.: Software Produktmanagement, Heidelberg 2004, S. 2ff
2
72000 Aphorismen: http://www.aphorismen.de/, vom 27.10.2004
FIALA
2.
Entwicklung
2
2. DIE ENTWICKLUNG DES ONLINE MARKTES
2.1 Das Zeitalter der Informationsgesellschaft
Das Internet hat eine unvergleichliche Entwicklung hinter sich. Durch das Internet
wandelten sich die Märkte, die Konsumenten und die gesamte Gesellschaft.
Mittlerweile ist es nahezu selbstverständlich ein Buch in den USA zu bestellen oder
einen Aktienkurs live bei einem Online-Broker in Deutschland mitzuverfolgen,
während vor 10 Jahren noch kaum jemand einen Internetzugang hatte und vor 20
Jahren noch kaum jemand einen Computer besaß. Die Verbreitung der Personal
Computer (PC) und die technische - laufende - Weiterentwicklung der
Datenübertragung waren die Grundvoraussetzungen für die moderne
Informationsgesellschaft.
Das Medium Internet brachte auch eine Reihe von Veränderungen in der Wirtschaft
mit sich, die in Tab. 1 zusammengefasst dargestellt werden. Die nachfolgenden
Unterkapitel erläutern die Übergänge im Detail.
VON: ZU:
Vermögenswerten (Atomen)
Informationen (Bits)
Produkten Dienstleistungen
Vertikaler Integration
Virtueller Integration
Befehle und Kontrolle
sich selbst organisierenden Systemen
Geld Zeit
Gewinn und Verlust
Marktkapitalisierung
Tab. 1: Übergänge in der Wirtschaft im Zeitalter des Internet
Quelle:
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 66
2.1.1 Übergang von Atomen zu Bits
Informationen und der Zugang zu den Informationen werden zum entscheidenden
neuen Vermögenswert. Der Begriff ,,Wert" ist im Zeitalter des Internet von den
physischen Gegenständen, die aus Atomen bestehen, mehr und mehr auf digitale
Informationen, die aus Bits bestehen, übergegangen. Eine Folge der neuen
Informationsgesellschaft ist demnach auch, dass in vielen Fällen Informationen über
einen Vermögenswert wertvoller geworden sind als der Vermögenswert selbst.
3
Diesen Zusammenhang beschreibt das folgende Beispiel
4
anschaulich:
3
NEGROPONTE, N.: Being Digital, Vancouver 1996, S. 15ff
4
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 21
FIALA
2.
Entwicklung
3
Es ist profitabler, Informationen über Öl zu besitzen, als Öl selbst sein eigen zu
nennen. Nehmen wir an, jemand besitzt 100 Tonnen Öl, von denen jede 10 Dollar wert
ist. Anders ausgedrückt: man hat 1.000 Dollar in Öl investiert. Wenn der Ölpreis nun
um 5 Dollar pro Tonne steigt, dann gewinnt man 500 Dollar.
Aber nehmen wir jetzt an, man könnte für 1 Dollar die Option kaufen, irgendwann in
Zukunft Öl für 10 Dollar je Tonne kaufen zu können. Dann würde man kein Öl
besitzen, sondern lediglich ein Bezugsrecht. Wenn man nun die 1.000 Dollar von
vorhin zum Erwerb von 1.000 Bezugsrechten zu je 1 Dollar einsetzt, kann man wenn
der Ölpreis z.B. wie oben auf 15 Dollar steigt 1.000 Tonnen Öl virtuell um 10 Dollar
kaufen und sofort wieder virtuell um 15 Dollar verkaufen der Gewinn beträgt
abzüglich der 1.000 Dollar für die Bezugsrechte nun 4.000 Dollar.
Der Unterschied in der Auswirkung ist riesig, das Potenzial des Kapitals mehr Kapital
zu erzeugen, hat sich verachtfacht. Wie ist das möglich? Die Antwort lautet: das
Kapital war nicht an Atome, sondern vielmehr an Bits gebunden. Die Transaktionen
betrafen nicht den Wert des Öls, sondern nur die Schwankungen des Ölpreises der
Wert besteht nur in der Preisveränderung.
Je mehr Informationen man hat und je schneller und besser man sie analysiert und
verarbeitet, desto eher kann man gewinnbringende Investitionen tätigen.
Neben dem Übergang bei Vermögenswerten von körperlichen Gegenständen aus
Atomen hin zu virtuellen Informationen aus Bits gibt es noch eine Reihe anderer
Änderungen (vgl. Tab. 1), die für die Wirtschaft der Informationsgesellschaft
kennzeichnend sind, die nachfolgend näher erörtert werden.
2.1.2 Übergang von Produkten zu Dienstleistungen
Der Übergang von Produkten zu Dienstleistungen lässt sich am Beispiel einiger
erfolgreicher Internet-Firmen beobachten: der elektronische Marktplatz Ebay, die
Suchmaschine Google, der Online-Broker Ameritrade, die Jobbörse Jobpilot und viele
andere mehr - sie alle verdienen hervorragend im und am Internet - und das
ausschließlich mit Dienstleistungen.
5
2.1.3 Übergang von vertikaler zu virtueller Integration
Der Übergang von vertikaler Integration hin zu virtueller Integration ist
gekennzeichnet vom Übergang vom Konkurrenzdenken hin zur Kooperation. Während
es früher vorteilhaft war, die gesamte Wertkette in einem Unternehmen zu integrieren,
ist es nun vorteilhaft, mit den Mitbewerbern zu kooperieren und ,,kompatible"
Produkte und Systeme zu schaffen. Virtuelle Wertketten führen im
Informationszeitalter schneller zum Erfolg und sind auch kostengünstiger als
vertikale.
6
5
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 66ff
6
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 66ff
FIALA
2.
Entwicklung
4
2.1.4 Übergang zu sich selbst organisierenden Systemen
Märkte und insbesondere Online-Märkte stellen sich selbst organisierende Systeme
dar. Die natürlichen Regulatoren sind Angebot und Nachfrage. Je stärker jedoch der
Einfluss von externen Faktoren, desto reglementierter wird der Markt und verliert an
eigenständiger Organisationsfähigkeit. Beispielsweise verhindern staatliche Eingriffe
die natürliche Preisbildung (und damit die Selbstorganisation des Marktes) in einigen
Teilbereichen der Wirtschaft.
7
2.1.5 Übergang von Geld zu Zeit
Kennzeichnend hierfür ist das Sprichwort ,,Nicht die Grossen fressen die Kleinen,
sondern die Schnellen die Langsamen". In diesem Zusammenhang ist auch die
folgende Devise in vielen Unternehmen Bestandteil der Unternehmensphilosophie
geworden: ,,Besser schnell und schlecht als langsam und gut".
8
Auch wenn es sich auf den ersten Blick kundenunfreunlich anhört die Strategie lohnt
sich meist: Die Qualität der Version 1.0 des Produktes lässt natürlich sehr zu
wünschen übrig und sowohl Kunden als auch Geschäftspartner werden erklären, was
der Hersteller tun sollte, um die Sache in Ordnung zu bringen. Das Produkt ist zwar
nicht gut, aber es ist auf dem Markt und es wird darüber geredet. Wenn dann die
Version 2.0 erscheint ungefähr zu der Zeit zu der ein fehlerfreies 1.0 Produkt
möglich gewesen wäre hat der schnelle Hersteller bereits um einige Monate
Vorsprung gegenüber den Konkurrenten und ist bereits am Markt bekannt.
9
Klassisches Beispiel hierzu ist die Software Microsoft Windows das Betriebssystem
war von Anfang an nicht fehlerfrei und brachte viele Tausend Benutzer oft zur
Verzweiflung. Doch die Kunden haben es Microsoft nicht nur verziehen und willig
regelmäßig neue Versionen erstanden, sondern sogar zu einer nahezu vollkommenen
Monopolstellung verholfen.
10
2.1.6 Übergang von Gewinn und Verlust zu Marktkapitalisierung
Für viele Unternehmen ist der Gewinn alleine zur Analyse des Unternehmens nicht
ausreichend. Ein gemeinsamer Nenner zur Einschätzung von Zukunftsaussichten,
Kundenstock, Umsatzentwicklung, Gewinnsituation, Verkaufszahlen, Vorräten,
Kooperationen etc. ist der Aktienkurs. Der Börsenwert eines Unternehmens bzw. der
Wert der Aktien ist die Marktkapitalisierung.
11
Ein effizienter Aktienmarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass in den Marktpreisen alle
verfügbaren Informationen berücksichtigt sind. Auf Grund alter Informationen oder
früherer Preisentwicklungen lassen sich keine Gewinne erzielen. Die Kurse reagieren
7
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 66ff
8
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 31
9
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 66ff
10
Windows auf 96% aller Rechner: http://futurezone.orf.at/futurezone.orf?read=detail&id=211494&tmp=6620,
vom 27.2.2005
11
MOORE, G.A.: old-economy.com, Wiesbaden 2001, S. 66ff
FIALA
2.
Entwicklung
5
auf neue Informationen, auf Überraschungen. Da sich Aktienkurse in Reaktion auf
zufällige Ereignisse bilden, folgen auch sie einem Zufallsmuster.
12
Der Aktienhandel ist heute nahezu vollständig digitalisiert, das bedeutet de facto sind
keine Börsengebäude mehr nötig.
2.2 Der Goldrausch
Das Internet war für viele der Aufbruch in eine neue Welt durchaus vergleichbar mit
der Euphorie mit der Amerika von den ersten Siedlern und Eroberern nach Gold
durchsucht wurde. Jedem Rausch folgt aber auch die Ernüchterung die nicht
zwangsläufig eine komplette Desillusionierung darstellen muss, die aber wieder zur
Realität zurück kehrt.
Amerika hatte wie jeder Kontinent begrenzte Bodenschätze, bot aber eine Fülle an
neuen Möglichkeiten und Freiheiten.
Das Internet war den selben Gesetzmäßigkeiten unterworfen wie ,,reale" Märkte, bot
aber ebenfalls eine Fülle an neuen Möglichkeiten und Freiheiten.
Unternehmen müssen daher auch wenn sie ihre überwiegende Tätigkeit mit Hilfe des
Internet verrichten auch Gewinne erzielen und klaren Strategien folgen, um
überleben zu können. Dieser scheinbar offensichtliche Zusammenhang schien in den
ersten Jahren nach dem Durchbruch des Internets außer Kraft, wie die folgende
Analyse zeigt.
Bereits in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts war ein neues Phänomen an der Börse
zu beobachten: Die Preise stiegen aufgrund der Hoffnungen und Träume, nicht jedoch
wegen der Gewinne oder Dividenden der Unternehmen. Der Crash kam dann im
,,schwarzen Oktober" des Jahres 1929. Jeder war betroffen, vom Multimillionär
Rockefeller bis zum Amateurspekulanten. Da einige Investoren mit Krediten ihre
Aktien erworben hatten, konnten diese nach dem Crash die Kredite nicht mehr decken
und der Markt stürzte noch weiter ab. Bis zum Jahr 1933 waren die Kurse um bis zu
85% abgesackt.
13
In einer ähnlichen Situation befanden sich die Börsen 2000, allen voran der
amerikanische Index für Informations- & Kommunikationstechnikwerte NASDAQ. In
den Jahren 1998 und 1999 war der Boom am größten auch wenn bereits 1999 erste
Warnungen publiziert wurden.
14
Der große Crash kam dann am 24.April 2000, als der
NASDAQ Index um 40% absackte.
15
Auch hier hatten wieder viele Investoren mit
Krediten spekuliert, die nun nicht mehr zu decken waren. Dies führte dann bedingt
durch den Crash - binnen kürzester Zeit zu massiven Vermögenseinbußen und nicht
12
SAMUELSON, P.A / NORDHAUS, W.D.: Volkswirtschaftslehre, Wien/Frankfurt 1998, S. 582
13
SAMUELSON, P.A / NORDHAUS, W.D.: Volkswirtschaftslehre, Wien/Frankfurt 1998, S. 580f
14
PERKINS, M. / PERKINS, A.: The Internet Bubble: Inside the Overvalued World of High-Tech Stocks,
New York 1999, S. 5ff
15
ZYMAN, S./ MILLER, S.: E-Branding, Wiesbaden 2001, S. 19
FIALA
2.
Entwicklung
6
selten zu einer Verschuldung der privaten Investoren über Jahre hinweg. Die
Seifenblase war geplatzt, die Situation ähnlich wie 1929, allerdings beschränkte sich
der Crash weitestgehend auf die auf der NASDAQ gelisteten Aktien der
Technikbranche.
16
Ein Paradebeispiel hierfür war die Aktie des amerikanischen Internet - Suchportals
,,Yahoo"
17
ein klassischer reiner Online-Dienstleister mit reinen Online-Produkten:
Suchfunktion, Online-Werbung, Freemail, Community und vieles andere mehr.
18
Bei der Betrachtung des nachfolgenden Charts (Abbildung 1) sollte man auch dem
unteren Teil, der Darstellung des Handelsvolumens, Beachtung schenken.
Symptomatisch für die gesamte Online-Landschaft war der große Boom 1998/99 mit
einigen Hundert Millionen Transaktionen pro Woche alleine schon nur bei der
Yahoo - Aktie.
Abb. 1: Entwicklung des Aktienkurses und Handelsvolumens von Yahoo Inc.
Quelle:
NASDAQ: Yahoo Inc., 10 Jahres Chart Wochendarstellung (Symbol: YHOO), http://www.nasdaq.com/,
vom 10.01.2004
Mittlerweile ist der Boom vorbei und der ,,Wirtschaftsmotor" IT - Industrie steckt in
der Krise. Eine Krise, die jedoch von Analysten mehrfach angekündigt war. Nicht
umsonst schrieben PERKINS/PERKINS bereits 1999 von der ,,overvalued world of
16
ZYMAN, S./ MILLER, S.: E-Branding, Wiesbaden 2001, S. 19
17
NASDAQ: Yahoo Inc., 10 Jahres Chart Wochendarstellung (Symbol: YHOO), http://www.nasdaq.com/, vom 10.01.2004
18
Suchmaschine Yahoo, http://www.yahoo.com, vom 12.01.2004
FIALA
2.
Entwicklung
7
tech stocks"
19
, der Welt der überbewerteten High-Tech Aktien und das zu einem
Zeitpunkt, wo viele Aktien erst auf der Hälfte ihrer Höchstwerte angelangt waren.
Schnell kam der wirtschaftliche Umschwung nach den USA auch nach Europa und zur
restlichen Welt - auch die österreichischen ehemaligen New-Economy Stars wie z.B.
Cybertron oder YLine gibt es heute nicht mehr. Sogar der wirtschaftliche ,,Riese"
Telekom Austria musste 2000 einen sehr schwachen Börsestart hinlegen ein Grund
dafür war sicherlich die generell gespannte Lage der IT-Wirtschaft.
Der Crash der ,,New Economy" zeigte eindrucksvoll, dass auch die neuen
Unternehmen rund um das und im Internet letzten Endes den Grundregeln der
Marktwirtschaft unterliegen und auf Dauer auch Gewinne erzielen müssen, um
überleben zu können.
Das Wachstum und die Entwicklung der Branche geht aber prinzipiell weiter jedoch
angepasst an die tatsächliche Marktsituation.
20
Abbildung 2 veranschaulicht das
Wachstum der IT-Infrastruktur im Vergleich zum Börsenindex NASDAQ Composite.
Der Börsenindex bleibt trotz vermehrter IT-Investitionen im unteren Kurs-Bereich der
letzten Jahre.
Abb. 2: Entwicklung der Serveranzahl (für ecommerce) im Vergleich zum NASDAQ-Index
Quelle:
OECD (Hrsg.): "The dot com bubble may have burst but e-commerce infrastructure is still expanding" Business to
consumer electronic commerce an update on the statistics, Paris 2001, S. 10
19
PERKINS, M. / PERKINS, A.: The Internet Bubble: Inside the Overvalued World of High-Tech Stocks,
New York 1999, S. 11f
20
OECD (Hrsg.): "The dot com bubble may have burst but e-commerce infrastructure is still expanding" Business to
consumer electronic commerce an update on the statistics, Paris 2001, S. 10
FIALA
2.
Entwicklung
8
Trotz dem Crash von 2000 haben also das Internet und seine Produkte nach wie vor
Potential und eröffnen nach wie vor viele Chancen: neben dem Versandhandel bzw. E-
Commerce lassen sich vor allem im Service- & Dienstleistungsbereich sinnvolle
Anwendungsgebiete identifizieren.
21
Man denke z.B. an die Nutzung von Internet-Suchmaschinen, Online-Banking,
diversen E-Commerce Anwendungen (die vor allem im Business-to-Business Bereich
hohe Anwenderzahlen haben) und vieles andere mehr.
Das Internet hat aber nicht nur einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen, es hat auch
bestehende Strukturen verändert. Einige wichtige Aspekte dieser Veränderung sollen
nun im nachfolgenden Kapitel beispielhaft erörtert werden.
2.3 Einflüsse von E-Commerce auf die traditionelle Wirtschaft
Die wesentlichsten Szenarien, die durch E-Commerce für die bisherige traditionelle
Konsumgüterwirtschaft skizziert werden, gehen u.a. von folgenden Auswirkungen
aus:
22
· Intensivierung des Wettbewerbs
· Virtuelle Organisationen
· Grenzenlose Unternehmen
· Umgestaltung der bestehenden Wertschöpfungskette
Auch wenn nach dem im Vorkapitel erwähnten ,,Goldrausch" die
Markteinschätzungen für den E-Commerce realistischer geworden sind und klar
wurde, dass sich auch im Internet nicht jedes Engagement rechnet, wächst die
Bedeutung des Internet für die Wirtschaft weiterhin enorm.
2.3.1 Intensivierung des Wettbewerbs
Eine Intensivierung des Wettbewerbs wird vor allem durch eine verstärkte
Preistransparenz und den grenzüberschreitenden Wettbewerb eintreten.
23
Der moderne Konsument sucht gezielt im Internet über Suchmaschinen nach
Angeboten oder vergleicht über entsprechende Preisvergleichs-Portale wie
www.geizhals.at.
24
Die Folge ist ein besser informierter Kunde, der üblicherweise auch
geringe Bindungen zum Händler entwickelt. Das dominierende Vergleichskriterium
21
OECD (Hrsg.): "The dot com bubble may have burst but e-commerce infrastructure is still expanding" Business to
consumer electronic commerce an update on the statistics, Paris 2001, S. 10
22
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
23
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
24
Preisvergleichsportal Geizhals, http://www.geizhals.at, vom 10.2.2004
FIALA
2.
Entwicklung
9
für den Online-Konsumenten ist der Preis. Durch kurze Versandzeiten, attraktive
Zahlungskonditionen oder erweiterte Webseiteninhalte lassen sich zwar in geringem
Ausmaß Stammkunden generieren, in der Regel jedoch werden die so geknüpften
Bande nicht ausreichen, um einen Kunden bei gleichzeitigem Preiskampf mit
anderen Anbietern halten zu können.
25
Traditionelle Faktoren wie ein luxuriöses Ambiente oder zusätzliche Leistungen, die
das Einkaufen zu einem ,,Erlebnis" machen, bleiben nach wie vor in erster Linie dem
herkömmlichen Ladengeschäft vorbehalten. Hier liegen auch die Stärken des
traditionellen Handels bei einem durchschnittlichen Einkauf in einem Shopping
Center wird der Kunde neben den Artikeln, die er kaufen wollte, auch Artikel
erwerben, die gerade im Angebot waren, besonders auffällig platziert waren und so
fort. Die Möglichkeiten, Bedürfnisse zu wecken sind bei einer physischen
Einkaufstour wesentlich facettenreicher als bei einer virtuellen Tour. Das physische
Erlebnis, das Angreifen und Anprobieren von Artikeln bleibt dem virtuellen
Konsumenten gänzlich versagt.
26
2.3.2 Virtuelle Organisationen
Ein traditionelles Handelsunternehmen hatte (und hat) als wichtigsten Kontaktpunkt
zum Kunden stets das Ladenlokal. Mit der Verbreitung des Internet als globales
Kommunikations- & Informationssystem konnte sich jedoch nun eine Reihe an
Unternehmen etablieren, die ausschließlich über das Internet mit ihren Kunden in
Kontakt treten und mit diesen auch nahezu ausschließlich elektronisch
kommunizieren.
27
Zum Teil wurden dabei bestehende Branchen revolutioniert, bekanntestes Beispiel ist
hier wohl der Buchhändler www.amazon.com
28
. Zum Teil wurden aber auch gänzlich
neue Branchen geschaffen, wie zum Beispiel das Online-Auktionshaus
www.ebay.com
29
oder die Suchmaschine www.google.com
30
.
Das Internet ist dabei gleichzeitig Markt und Informationssystem und bringt Kunden
und Händler mit noch nie da gewesener Effizienz weltumspannend zusammen.
31
Die
Möglichkeiten der Schaffung virtueller Kontaktpunkte und der automatischen
Datenverarbeitung haben in den letzten Jahren allerdings nicht nur in Unternehmen
Fuß gefasst auch viele Verwaltungswege im Bereich der öffentlichen Verwaltung
25
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
26
BEISHEIM, O. (Hrsg.): Distribution im Aufwind, München 1999, S. 967ff
27
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
28
Software-/Buchshop Amazon, http://www.amazon.de und http://www.amazon.com, vom 27.10.2004
29
Auktionsportal Ebay, http://www.ebay.com, vom 27.10.2004
30
Suchmaschine Google, http://www.google.com, vom 27.10.2004
31
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
FIALA
2.
Entwicklung
10
können heutzutage bereits online wahrgenommen werden, so zum Beispiel das Portal
der Sozialversicherungsträger www.sozvers.at
32
.
Aber nicht nur im Bereich der Schnittstellen Kunde Unternehmen, auch in den
Unternehmen selbst hat sich einiges an der internen Organisation geändert:
Wissensmanagementsysteme, grenzüberschreitende virtuelle Projektzusammenarbeit,
Fernwartung und Teleworking sind nur einige der relevanten Stichwörter zu diesem
Themenbereich. So sinnvoll die genannten Entwicklungen in einigen Bereichen sind,
so differenziert muss man doch die Auswirkungen betrachten. So zum Beispiel kann
Teleworking zu einer höheren Effizenz und Arbeitszufriedenheit führen, kann aber
auch bei falschem Einsatz zu Problemen in der Unternehmensorganisation führen.
Insbesondere die mangelnden Kontrollmöglichkeiten, der fehlende soziale Kontakt
und Wissensaustausch sowie der Rückgang in der Kommunikation (und somit der
Rückgang bei der laufenden Abstimmung der Arbeit!) zwischen den Mitarbeitern
können zu Fehlrationalisierungen führen, die im Endeffekt mehr kosten, als sie
vordergründig gebracht haben.
33
2.3.3 Grenzenlose Unternehmen
Globalisierung und multinationale Konzerne gab es schon vor dem Zeitalter des
Internet. Durch das Internet bekommt die grenzüberschreitende Kommunikation und
der grenzüberschreitende Handel aber eine neue Dimension.
34
Parallel dazu muss man aber natürlich auch die Weiterentwicklung der
Rahmenbedingungen sehen: insbesondere in Europa erleichtert die Währungs- &
Zollunion den innergemeinschaftlichen Handel enorm. Unzählige Verbesserungen im
Welthandelsrecht, bei der Welthandelsorganisation WTO und auf Ebene der EU-
Gesetzgebung haben alte, verkrustete Strukturen aufbrechen lassen.
35
Beides zusammen, die Verbesserungen der Rahmenbedingungen für den
internationalen Handel, als auch die rasante Weiterentwicklung des Internet führten
dazu, dass auch kleinere Unternehmen mittlerweile problemlos hohe Exportquoten und
eine globale Präsenz (virtuell) vorweisen können.
36
2.3.4 Umgestaltung der bestehenden Wertschöpfungskette
Virtuelle Organisationen und grenzenlose Unternehmen bewirken auch ganz andere
Möglichkeiten in der Gestaltung der Wertschöpfungsketten. Während früher der
klassische Weg vom Hersteller über den Großhandel und Distributoren zu unzähligen
kleineren Händlern und letzten Endes zum Kunden führte, bietet das Internet nun
32
Portal der Sozialversicherungsträger, http://www.sozvers.at, vom 27.10.2004
33
Auswirkungen des Teleworking, http://www.telekooperation.de/html/kap22.html, vom 25.03.2005
34
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
35
BEISHEIM, O. (Hrsg.): Distribution im Aufwind, München 1999, S. 39ff
36
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
FIALA
2.
Entwicklung
11
gänzlich neue Formen der Vermarktung.
37
Der Hauptvorteil der klassischen Handelswege, die ,,Nähe zum Kunden", ist zwar
nach wie vor in einigen Bereichen ein wesentliches Verkaufsargument, bei einigen
Artikeln oder Artikelgruppen ist die Bedeutung aber mittlerweile durch die
Neuerungen des Internet untergeordneter. Über Webshops können auch weit entfernte
Hersteller direkt an eine große Zahl an Kunden herantreten, ohne dabei auf die
Vermittlung von Zwischenhändlern angewiesen zu sein. Eine Extremform dieser
Emanzipation der Hersteller gegenüber den Händlern findet sicherlich im
Spezialbereich der ,,reinen" Online-Produkte statt. Insbesondere bei jenen Artikeln, die
keiner physischen Transportwege (Wegfall der Logistik!) mehr bedürfen (z.B. Online-
Dienstleistungen, Download-Musik oder Download-Software) gewinnen die Hersteller
zusehends an Positionsmacht.
38
Für den Handel bedeutet dieser Machtgewinn der Hersteller nicht selten einen
Teufelskreis: Unattraktive Margen (einige Hersteller bieten ihren Händlern bereits
unwesentlich bessere Konditionen als ihren Kunden, Margen von rund 5% sind keine
Seltenheit mehr
39
), restriktive Vertriebsbeschränkungen (Mindestumsätze, Gebiets-
beschränkungen usw.)
40
oder Direktvertrieb des Herstellers in Konkurrenz mit dem
Fachhandel
41
führen zu sinkenden Umsätzen. Teilweise werden Kunden auch aktiv
abgeworben. Das folgende Beispiel ist insbesondere im Softwarebereich absolut
üblich
42
:
Der Hersteller gestaltet seine Software registrierungspflichtig, d.h. der Kunde erhält
gewisse Services erst nachdem er dem Hersteller seine persönlichen Daten übermittelt
hat. Bei vielen Software-Artikeln sind nun neben dem Hauptprodukt durch technische
oder gesetzliche Neuerungen auch regelmäßige Updates nötig (meist jährlich, vor
allem bei Buchhaltungssoftware). Durch die Registrierung hat der Hersteller nun
bereits die Kundendaten vorliegen und kann beim Erscheinen des Updates anstatt
den Weg über den Händler zu gehen dieses dem registrierten Kunden direkt ,,zur
Ansicht" zusenden. Wenn der Kunde das Update behalten möchte, zahlt er einfach die
beiliegende Rechnung direkt an den Hersteller.
43
Die Aufgabe des Händlers beschränkt sich bei diesem Szenario auf den initialen
Kontakt, die Kundengewinnung und Erstberatung. Danach übernimmt der Hersteller
die weitere Kundenbetreuung.
Ein anderer Weg mit selben Resultat wird zum Beispiel vom Softwarehersteller
Linguatec
44
eingeschlagen: der bekannte Produzent von Übersetzungssoftware bietet
37
FRITZ, W.: Electronic Commerce im Internet eine Bedrohung für den traditionellen Konsumgüterhandel?, veröffentlicht
in: FRITZ, W. (Hrsg.): Internet-Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 123ff
38
BEISHEIM, O. (Hrsg.): Distribution im Aufwind, München 1999, S. 978ff
39
Handelsmarge der Hersteller Altova http://www.altova.com und RedGate http://www.redgate.com, vom 27.02.2005
40
z.B. üblich bei Autodesk http://www.autodesk.com oder Alias Systems http://www.alias.com, vom 27.02.2005
41
z.B. Softwarehersteller Lexware http://www.lexware.de, Sage KHK http://www.sagekhk.de, vom 27.02.2005
42
FIALA, J.: Gespräche mit bzw. Erfahrungen der Geschäftsführung von www.softwarediskont.com, Jän. 2004
43
Lexware-Updateservice des Haufe-Verlags: http://www.haufe.de, vom 27.02.2005
44
Linguatec GmbH, http://www.linguatec.de, vom 27.02.2005
FIALA
2.
Entwicklung
12
seinen Händlern nur Rabatte für Vollversionen, nicht für Updates. Updates werden bei
Linguatec ausschließlich über den Hersteller direkt verkauft.
Es gibt aber auch Beispiele für eine gegensätzliche Strategie, die auf ein umfassendes
Partnernetz aufbaut: der weltweit größte Softwarehersteller Microsoft macht rund 96%
seiner Umsätze nach wie vor über Partnerfirmen.
45
Mit steigender
Unternehmensgröße und Kundenzahl ließe sich eine effektive, flächendeckende und
weltumspannende Kundenbetreuung wahrscheinlich nicht wirtschaftlich
bewerkstelligen. Aber auch kleinere Unternehmen bevorzugen oft den Vertrieb über
Handelspartner, um die Kundenbetreuung lokal optimiert bieten zu können (in der
Muttersprache der Kunden!) oder zusätzliche Risiken wie das Bonitätsrisiko der
Kunden auf die Händler abzuwälzen.
46
Fazit: Je einfacher das Produkt und je weniger Dienstleistungen rund um den Verkauf
anfallen, desto einfacher wird auch der Vertrieb direkt durch den Hersteller sein.
Durch den teilweisen Wegfall des Faktors ,,Nähe zum Kunden" und dem Wegfall von
Logistik-Dienstleistungen bei reinen Online-Produkten findet in einigen Bereichen und
bei einigen Artikeln zwar sicherlich eine Macht-Verschiebung vom Handel zum
Hersteller statt, welche Strategie aber langfristig erfolgreicher und effizienter sein wird
Partnervertrieb oder Direktvertrieb wird sich wohl erst in den kommenden Jahren
zeigen.
Das Wachstum des Internet bedeutet in jedem Fall neue, wertvolle Impulse für die
Wirtschaft und ermöglicht ein noch nie da gewesenes effizientes, weltumspannendes
Handels- & Informationssystem. Allerdings ist der Zugang zum Internet nicht jedem
ohne weiteres möglich jeder, der an der modernen Informationsgesellschaft
teilhaben möchte, benötigt auch einen Internetzugang, ein Privileg, das vielen
Gesellschaftsschichten aus finanziellen oder infrastrukturellen Gründen verwehrt
bleibt.
47
Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Online Handel sollen im nun
nachfolgenden Kapitel behandelt werden.
45
Microsoft, http://www.microsoft.com, vom 24.02.2004
46
z.B. IDM Computer, http://www.idmcomputer.com, vom 24.02.2004
47
Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/, vom 27.2.2005
FIALA
3. Das Internet
13
3. DAS INTERNET ALS INSTRUMENTARIUM DER
INFORMATIONSGESELLSCHAFT
3.1 Die Anfänge des Internet
Das Internet ist älter als meist angenommen wird bereits 1969 ist ein Vorläufer des
Internet mit dem Namen ARPANET in einer vom US-Verteidigungsministerium
gegründeten Behörde, der Advanced Research Projects Agency (ARPA), entstanden
und diente - neben den militärischen Zwecken - in ziviler Hinsicht bis in die 80er Jahre
hinein hauptsächlich der Kommunikation zwischen wissenschaftlichen
Einrichtungen.
48
Der Durchbruch gelang jedoch erst 1993 mit der Entwicklung und
Verbreitung einer grafischen Benutzeroberfläche des World Wide Web (WWW).
49
Einen wesentlichen Anteil an der rasanten Entwicklung hatte sicherlich auch die
förderliche liberale Gesetzgebung in den USA. Auch wenn die Aussage von Al Gore
in einem CNN Interview
50
"During my service in the United States congress I took the
initiative in creating the Internet." sicherlich im Angesicht des Wahlkampfes 1999
etwas übertrieben war, so darf man dennoch den wahren Kern dahinter nicht
übersehen: Gores Aussage bezog sich auf ein Gesetz von 1990, das die Entwicklung
eines "Information System Highway" für den wissenschaftlichen und erzieherischen
Sektor fördern sollte. Das Gesetz hatte damit einen sehr großen Einfluss auf das
Wachstum des damals noch kleinen Internets.
51
Der ,,Erfinder" des Internet lässt sich aber sicherlich nicht an einer Person festmachen.
Auf der einen Seite gibt es die Techniker, die Methoden zur Datenübertragung und zur
Bereitstellung von Informationen entwickelten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich
Politiker, die die Wissenschaft förderten und die gesetzlichen Rahmenbedingungen
schufen. Letztendlich gibt es aber vor allem auch einen Markt, der nach dem Internet
verlangte, der nach uneingeschränkten, weltweit vernetzten Informationen verlangte
und damit das ursprünglich kleine wissenschaftliche Projekt zu einem prägenden
Begriff unseres Zeitalters und unserer Wirtschaft machte.
3.2 Grundlagen für Geschäfte über das Internet
Prinzipiell sind technische, gesellschaftliche und finanzielle Grundlagen zu
unterscheiden, wobei die Grenzen teilweise fließend verlaufen. Fehlen beispielsweise
die finanziellen Grundlagen, wird auch die Zugangsqualität schlechter sein.
52
48
FRITZ, W. (Hrsg.): Internet Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 3
49
ZERDICK, A.: Die Internet Ökonomie, Berlin 2001, S. 152
50
GORE, A.: Interview durch Wolf Blitzer (CNN), März 1999 zitiert in:
http://de.wikipedia.org/wiki/Al_Gore, vom 14.10.2004
51
Al Gore und das Internet, http://de.wikipedia.org/wiki/Al_Gore, vom 14.10.2004
52
Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/, vom 27.2.2005
FIALA
3. Das Internet
14
Die technischen Grundlagen auf Verbraucherseite können als PC-Hardware &
Software sowie der Möglichkeit zu einem Internetzugang (Telefonanschluss)
zusammengefasst werden.
53
Als gesellschaftlichen Grundlagen können neben der gesellschaftlichen
Wertvorstellungen (z.B. Abneigung in streng islamischen Staaten als unerwünschter
westlicher Einfluss
54
) auch die Ausbildungsmöglichkeiten (Ausbildung an Schule und
Universitäten) genannt werden.
55
Diese beiden Grundlagen bedingen gemeinsam die dritte Grundlage bzw.
Voraussetzung für eine entsprechende Verbreitung in der Bevölkerung: die
Leistbarkeit der Ausbildung und Ausstattung für eine effiziente Internetnutzung.
56
3.2.1 Internetzugang
Die Infrastruktur zur Übertragung von Informationen sind der Internetzugang und die
Datenleitungen. Die nachfolgende Abbildung (Abbildung 3) zeigt, dass Österreich und
Deutschland 2001 noch unter dem OECD Durchschnitt lagen.
Es ist jedoch anzumerken, dass das Wachstum der Internetzugänge momentan einer
besonders starken Dynamik unterliegt und sich daher sowohl die Zahlen als auch die
Verhältnisse der Länder zueinander laufend ändern. 2004 verfügten z.B. in
Österreich bereits 55% über einen Internetzugang
57
, also deutlich mehr als in der
OECD Statistik von 2001 ausgewiesen waren. Die Zahlen sind daher als
Momentaufnahme zu betrachten und spiegeln die heutigen Verhätnisse nur bedingt
wider.
Den größten Nachholbedarf in Sachen Internet haben aber sicherlich noch die neuen
EU-Länder bzw. Beitrittskandidaten sowie die südeuropäischen Staaten. Hier wirkt
aber die Europäische Union bereits ausgleichend und es ist eine weitere Angleichung
zu erwarten.
58
Dramatisch ist das Informationsgefälle aber v.a. in den Entwicklungs- und
Schwellenländern diese sind noch weitgehend von der ,,New Economy"
ausgeschlossen. Dieser Mangel bedingt eine Negativspirale, die die Kluft
59
wenn
diese nicht durch ein entsprechendes Wirtschaftswachstum ausgeglichen wird
zwischen Industriestaaten und Entwicklungs- & Schwellenländern ständig größer
werden lässt:
53
FRITZ, W. (Hrsg.): Internet Marketing, Handelsblatt Bücher, Stuttgart 2001, S. 408
54
Taliban, http://de.wikipedia.org/wiki.cgi?Taliban, vom 25.3.2005
55
Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/, vom 27.2.2005
56
Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/, vom 27.2.2005
57
ORF Mediaresearch: ,,EDV Besitz und Internetzugang im Haushalt",
http://mediaresearch.orf.at/index2.htm?internet/internet_aim.htm, vom 30.8.2005
58
OECD: "Internet subscribers per 100 inhabitants (December 2000)" - Business to consumer electronic commerce an
update on the statistics, Paris 2001, S. 6
59
Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/, vom 27.2.2005
FIALA
3. Das Internet
15
Durch eine mangelhafte Ausbildung und fehlende Internet-Infrastruktur werden diese
Länder oftmals zu großen Teilen von der modernen Informationsgesellschaft
ausgeschlossen. Dieser Nachteil verringert wiederum die Chance den technischen und
wirtschaftlichen Vorsprung der Industrieländer je einzuholen.
60
Abb. 3: Internetzugänge pro 100 Einwohner
Quelle:
OECD: "Internet subscribers per 100 inhabitants (December 2000)" - Business to consumer electronic commerce
an update on the statistics, Paris 2001, S. 6
3.2.2 Varianten und Qualität der Internetzugänge
Speziell für den Markt der reinen Online-Produkte, hier wiederum vor allem für
Produkte, die aus großen Datenmengen bestehen wie z.B. Download-Software oder
Download-Filme ist noch ein weiterer Aspekt sehr wichtig: die Qualität und Kosten
der Internetverbindung. Schließlich ist Download-Software oft von beachtlicher Größe
und die Dauer zum Herunterladen über eine Modemverbindung stellt einen
wesentlichen Kostenfaktor dar sowohl bezüglich der Arbeitszeit als auch bezüglich
der Online-Gebühren.
Dem gegenüber fallen bei Breitbandverbindungen (ADSL, DSL, Kabel) üblicherweise
keine zusätzlichen Gebühren an (Flatrate) und die Arbeitszeit ist - aufgrund der
kürzeren Download-Dauer und der stabileren Verbindungsqualität - zu
vernachlässigen.
Um daher den Online Markt für viele Online-Produkte einschätzen zu können ist ein
weiterer Indikator für die IT-Infrastruktur heranzuziehen: die Anzahl der Breitband-
Internetzugänge (vgl. Abbildung 4).
Man sieht deutlich, dass Breitbandzugänge noch die Minderheit darstellen, die meisten
60
Digital Divide Network, http://www.digitaldividenetwork.org/, vom 27.2.2005
FIALA
3. Das Internet
16
Zugänge sind Einwahl-Modemverbindungen. Allerdings ist bei den
Breitbandzugängen ein starkes Wachstum feststellbar, welches sich gegenwärtig
sicherlich fortsetzt und auch in Zukunft fortsetzen wird. Besonders förderlich für die
Verbreitung der ADSL, DSL und Kabelanschlüsse sind diverse nationale und
europäische Förderprogramme (z.B. steuerliche Absetzbarkeit von neuen
Breitbandzugängen in Österreich, eEurope Initiative, udgl.). Vergleicht man die Zahl
der Internetzugänge 2000 und 1999 so ist ebenfalls ein enormes Wachstum zu
verzeichnen: rund + 30%.
61
Diese starke Dynamik in der Entwicklung führte in Österreich dazu, dass 2004 bereits
46% aller Internetzugänge Breitbandanschlüsse waren. Dabei entfällt ca. die Hälfte der
Breitbandanschlüsse auf ADSL und die andere Häfte auf Kabel, wobei die
Unterschiede regional je nach Angebot sehr groß sein können. Die OECD
Statistiken sind daher wie in Kapitel 3.2.1 erwähnt - nur als Momentaufnahme zu
betrachten und auf die heutigen Verhältnisse bedingt anwendbar.
62
Die potentielle Zielgruppe für den Online Handel wird immer größer und in Folge
somit auch für Online Produkte, wenngleich bei Download-Produkten (Software,
Musik,...) noch die Qualität des Zugangs der wesentlichste Engpass ist.
Abb. 4: Internetzugang Entwicklung in den OECD Ländern
Quelle:
OECD: "The Internet access is still growing and share of broadband is growing" Business to consumer electronic
commerce an update on the statistics, Paris 2001, S. 12
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die Länderverteilung, da
Abbildung 4 nur den OECD Durchschnitt darstellt. Betrachtet man nun ergänzend die
61
OECD: "The Internet access is still growing and share of broadband is growing" Business to consumer electronic
commerce an update on the statistics, Paris 2001, S. 12
62
ORF Mediaresearch: ,,Breitband Anschlüsse nehmen erneut zu",
http://mediaresearch.orf.at/index2.htm?internet/internet_aim.htm, vom 30.8.2005
FIALA
3. Das Internet
17
nachfolgende Abbildung (Abb. 5), so sieht man, dass Europa generell bei
Breitbandverbindungen einen Aufholbedarf hat. Interessant ist jedoch die
verhältnismäßig gute Platzierung Österreichs, was allerdings zum Großteil auf die
heimische Verbreitung des Telekabel-Netzes zurückzuführen ist.
63
In Deutschland ist das Kabelnetz zu schwach, um qualitativ hochwertige Breitband-
Internetverbindungen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Österreich konnte Telekabel in
Deutschland nicht in einem vergleichbaren Ausmaß Fuß fassen.
64
Generell lässt sich anhand von Abbildung 5 sehr gut ableiten, dass Länder mit hoher
Verbreitung und guter Ausbauqualität der Kabelnetze auch einen gewissen Vorsprung
bei den Breitbandzugängen verzeichnen können. Länder hingegen (wie Deutschland
oder Frankreich), die v.a. auf neue Netze wie DSL setzen müssen, haben noch höheren
Aufholbedarf.
Abb. 5: Breitbandinternetzugang Stand in den OECD Ländern
Quelle:
OECD: "Rollout of broadband access: uneven growth" Business to consumer electronic commerce an update on
the statistics, Paris 2001, S. 13
3.2.3 Informationsangebot
Eine weitere Voraussetzung für eine Informationsgesellschaft ist die Information (in
Form von Websites) selbst. Die effiziente Bereitstellung bzw. der effiziente Austausch
ist aber nur nach Erfüllung der technischen Grundlagen umfassend möglich.
Punkto bereitgestellter Information nehmen die skandinavischen Länder gemeinsam
mit den USA, Großbritannien und Kanada die Führungsrolle ein. Die meisten
Websites pro Einwohner gibt es in den USA, gefolgt von Norwegen, Kanada und
63
UPC
United Pan-Europe Communications,
Telekabel, www.chello.at, vom 10.4.2004
64
OECD: "Rollout of broadband access: uneven growth" Business to consumer electronic commerce an update on the
statistics, Paris 2001, S. 13
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832491741
- ISBN (Paperback)
- 9783838691749
- DOI
- 10.3239/9783832491741
- Dateigröße
- 3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Dezember)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- abfallvermeidung e-commerce internet shopping ökologie distributionseffizienz
- Produktsicherheit
- Diplom.de