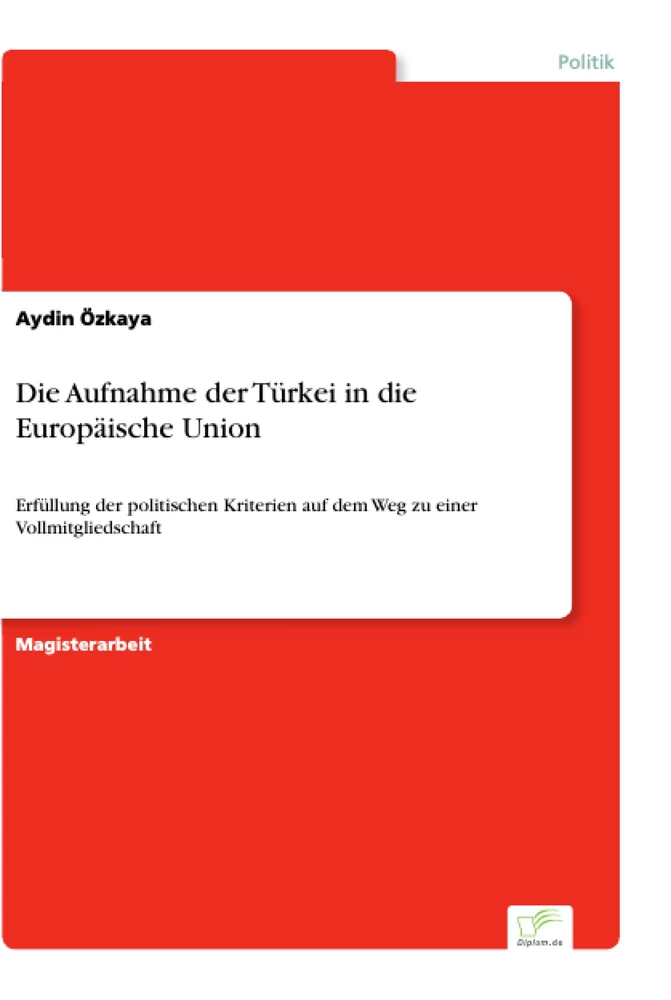Die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union
Erfüllung der politischen Kriterien auf dem Weg zu einer Vollmitgliedschaft
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden die Chancen der Türkei auf eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) untersucht. Schafft es die jetzige türkische Regierung die politischen Kriterien von Kopenhagen in einem Maße zu erfüllen, so dass die EU mit der Türkei die Beitrittsverhandlungen Ende 2004 beginnen kann?
Welche politischen Fortschritte hat die Türkei seit der Anerkennung als Beitrittskandidat 1999 in Helsinki bis heute vollzogen? Sind die Vorgaben der Europäischen Union eindeutig genug und wann kann von einer Erfüllung der Bedingungen gesprochen werden? Auf diese Fragen soll durch diese Arbeit eine Antwort gefunden werden. Da die Untersuchung der Erfüllung der politischen Voraussetzungen von Kopenhagen durch die Türkei Gegenstand dieser Arbeit sein wird, soll das wirtschaftliche Kriterium lediglich in Form einer kurzen Darstellung der Entwicklung der türkischen Wirtschaft seit etwa zwanzig bis dreißig Jahren aufgezeigt werden.
Der Wechsel zur heutigen Marktwirtschaft in der Türkei vollzog sich Anfang der achtziger Jahre, als die Regierung Demirel ein umfassendes Programm zur Sanierung der Wirtschaft verkündete und an dessen Ausarbeitung der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt war. Durch diese Wende traten Marktwirtschaft und Exportorientierung an die Stelle von Dirigismus und Importsubstitution. Die Maßnahmen beinhalteten die Abwertung der türkischen Lira, die Liberalisierung des Außenhandels und die Förderung des Exports, um ausländische Investoren anzuziehen.
Turgut Özals Reformen hatten die Türkei in wenigen Jahren durch die steigenden Exporte von einem Agrarland zu einem zunehmend industrialisierten Land gemacht. Durch die Wirtschaftsreform und dem damit einhergehenden hohen Wirtschaftswachstum mit weiter zunehmender Industrialisierung rückte die Türkei in der Klassifizierung der Weltbank und der OECD von der Gruppe der Entwicklungsländer in die Gruppe der Staaten mit mittlerem Einkommen auf.
Nach wie vor hat die Türkei jedoch Probleme mit der hohen Inflation, der ungerechten Einkommensverteilung sowie den In- und Auslandsschulden.
Außenpolitisch sehen die Kopenhagener Kriterien die Zypern-Problematik zwar offiziell nicht als Kriterium für den Beginn von Beitrittsverhandlungen, eine Lösung dieser seit 1974 geteilten Insel wird jedoch von der EU als Bedingung für eine Mitgliedschaft der Türkei angesehen. Nachdem Nordzypern ihren Antrag 1990 auf Vollmitgliedschaft in die EU stellte, sollte […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Themenabgrenzung
In der vorliegenden Arbeit werden die Chancen der Türkei auf eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) untersucht. Schafft es die jetzige türkische Regierung die politischen Kriterien von Kopenhagen in einem Maße zu erfüllen, so dass die EU mit der Türkei die Beitrittsverhandlungen Ende 2004 beginnen kann?
Welche politischen Fortschritte hat die Türkei seit der Anerkennung als Beitrittskandidat 1999 in Helsinki bis heute vollzogen? Sind die Vorgaben der Europäischen Union eindeutig genug und wann kann von einer Erfüllung der Bedingungen gesprochen werden? Auf diese Fragen soll durch diese Arbeit eine Antwort gefunden werden. Da die Untersuchung der Erfüllung der politischen Voraussetzungen von Kopenhagen durch die Türkei Gegenstand dieser Arbeit sein wird, soll das wirtschaftliche Kriterium lediglich in Form einer kurzen Darstellung der Entwicklung der türkischen Wirtschaft seit etwa zwanzig bis dreißig Jahren aufgezeigt werden.
Der Wechsel zur heutigen Marktwirtschaft in der Türkei vollzog sich Anfang der achtziger Jahre, als die Regierung Demirel ein umfassendes Programm zur Sanierung der Wirtschaft verkündete und an dessen Ausarbeitung der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt war. Durch diese Wende traten Marktwirtschaft und Exportorientierung an die Stelle von Dirigismus und Importsubstitution. Die Maßnahmen beinhalteten die Abwertung der türkischen Lira, die Liberalisierung des Außenhandels und die Förderung des Exports, um ausländische Investoren anzuziehen.[1] Turgut Özals Reformen hatten die Türkei in wenigen Jahren durch die steigenden Exporte von einem Agrarland zu einem zunehmend industrialisierten Land gemacht. Durch die Wirtschaftsreform und dem damit einhergehenden hohen Wirtschaftswachstum mit weiter zunehmender Industrialisierung rückte die Türkei in der Klassifizierung der Weltbank und der OECD von der Gruppe der Entwicklungsländer in die Gruppe der Staaten mit mittlerem Einkommen auf.[2]
Nach wie vor hat die Türkei jedoch Probleme mit der hohen Inflation, der ungerechten Einkommensverteilung sowie den In- und Auslandsschulden.
Außenpolitisch sehen die Kopenhagener Kriterien die Zypern-Problematik zwar offiziell nicht als Kriterium für den Beginn von Beitrittsverhandlungen, eine Lösung dieser seit 1974 geteilten Insel wird jedoch von der EU als Bedingung für eine Mitgliedschaft der Türkei angesehen. Nachdem Nordzypern ihren Antrag 1990 auf Vollmitgliedschaft in die EU stellte, sollte der Inselstaat am 01. Mai 2004 mit neun weiteren Staaten Mitglied der EU werden. Bis dahin sollte unter Vermittlung der UNO eine Einigung mit den türkischen Zyprioten erzielt werden, damit die Insel als ein ungeteilter föderaler Bundesstaat mit zwei eigenständigen Ländern EU-Land werden könne.
Für die Zyperntürken wäre dies die Möglichkeit gewesen, in einem geeinten Zypern der EU beizutreten und von den Vorteilen dieses Beitritts zu profitieren.[3]
Bei dem im April 2004 abgehaltenen Referendum waren jedoch die griechischen Zyprioten gegen die Anerkennung des UN-Plans, während die türkischen Zyprer zugestimmt haben. Somit ist der Versuch, Zypern zu einen, am „Nein“ der griechischen Zyprer gescheitert. Das Scheitern bedeutete zugleich einen Rückschlag für die EU-Beziehungen der Türkei. Mit einer Einigung hätte sie bereits mit einem Bein in der EU gestanden und gleichzeitig die Forderung der EU erfüllt, mit Griechenland eine Einigung über die Zypernfrage zu erzielen.
Längst ist auch in Deutschland unter den Parteien eine Debatte in Gang gekommen, ob denn die Türkei überhaupt schon EU-fähig sei.
Führende Politiker der Regierung Schröder wollen die Türkei eng an Europa binden und damit eine Stabilisierung des Landes in innen- wie außenpolitischer Hinsicht erreichen. Aber auch die SPD verlangt, dass die Kopenhagener Kriterien erst vollständig erfüllt werden müssen, um mit Beitrittsverhandlungen beginnen zu können.
Es wird argumentiert, dass die Werte der EU nicht an eine bestimmte Kultur oder Religion gebunden seien, da Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung
von Menschenrechten universell gelten und deshalb im EU-Vertrag niedergeschrieben seien. Dabei ist nach Ansicht des Bundeskanzlers Gerhard Schröder ein tiefer gesellschaftlicher Wandel in der Türkei eine notwendige Grundlage der Türkei-EU-Beziehungen.[4]
Die Union hingegen ist der Meinung, dass die Vollmitgliedschaft der Türkei nicht vorangetrieben werden solle, sondern lediglich eine „privilegierte Partnerschaft“ mit mehr Zusammenarbeit angestrebt werden müsse als bisher in der Zollunion bereits geschehen. Auch Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber lehnt eine Vollmitgliedschaft der Türkei ab und propagiert stattdessen eine stärkere Annäherung an die EU. „ Der Beitritt der Türkei übersteige die Kraft Europas und geht am Willen der Bevölkerungsmehrheit vorbei.“[5]
Damit hat die CDU/CSU eine deutliche Wende zur Haltung der Unionsregierung Mitte der 90er Jahre unter Helmut Kohl in ihrer politischen Position zu dieser Frage vollzogen. Auch die FDP hat Bedenken gegen einen baldigen Beitritt der Türkei, da das Land nicht die demokratischen Standards von EU-Staaten vorweisen könne.
1.2 Aufbau der Arbeit
Bei der Erfüllung der politischen Kriterien spielen die historischen Türkei-EU-Beziehungen eine vornehmliche Rolle. Nach einer eingehenden Beleuchtung der historischen Hintergründe wird die Annäherung der Türkei an die EU deutlich. Die Auslegung der politischen Kriterien von Kopenhagen nach ihrer Bedeutung ist Teil dieser Arbeit. Im Weiteren wird sie sich mit den Reformanstrengungen der Türkei befassen, bei denen den Fortschrittsberichten der EU-Kommission eine herausragende Bedeutung zukommt. Es gilt dann zu analysieren, ob die erzielten türkischen Gesetzesänderungen auch tatsächlich von den einzelnen staatlichen Stellen in die Praxis umgesetzt worden sind oder nicht.
Vor diesem Hintergrund sollen schließlich die Chancen der Türkei auf eine EU-Vollmitgliedschaft aktuell beurteilt werden.
2. Historischer Aufriss der Türkei-EU-Beziehungen
Die Türkei als Grenzland zwischen Europa und Asien, zwischen Christentum und Islam und zwischen östlichen und westlichen Kulturen lässt in ihrer Geschichte bereits seit Ende des 16. Jahrhunderts ein großes Interesse an Europa erkennen. Die Wurzeln europäischer Kulturen liegen umgekehrt auch in Kleinasien. Die Orientierung der Türkei nach Westen war nicht nur im Interesse der Eliten und Politiker, sondern auch ein Bedürfnis der großen Mehrheit der Bevölkerung des Landes. Der Westen ist von den Türken als ein Zentrum des Fortschritts und der Entwicklung angesehen worden.
Schon um 1800 ist der Boden für die Europäisierung des Osmanischen Reiches vorbereitet worden. Die ersten umfassenden Erneuerungen wurden im Militärbereich durchgeführt. Zunächst französische, später aber vorwiegend preußische Militärberater reorganisierten die Truppen. Die 1839 und 1856 erlassenen Grundgesetze, die zum Verbot der Diskriminierung der Nichtmuslime geführt und die Erklärung des Rechts der Scharia für ungültig erklärt haben, sind entscheidende Etappen dieser Europäisierung und der Umwandlung der traditionellen muslimischen Gesellschaft in eine bürgerliche Zivilgesellschaft. Im Jahr 1876 wurde neben einem umfassenden Umbau von Staat und Gesellschaft die erste osmanische Verfassung verabschiedet. Als mit Beginn des 20. Jahrhunderts die Verfallstendenzen immer deutlicher wurden, wuchs innerhalb der militärischen und bürokratischen Elite die Bereitschaft zu neuen umfassenden Reformen, um den Anschluss an den Westen nicht zu verlieren.
Nachdem die Türkei seit über 100 Jahren ihr gesamtes politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches System nach Westen ausgerichtet hatte, strebt sie seit den sechziger Jahren eine Aufnahme in die Gemeinschaft der europäischen Länder an.
2.1 Die ersten Weichen zu Europa seit der Staatsgründung 1923
Mit der Ausrufung der Republik Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk am 29. Oktober 1923 begann nach der Jungtürkischen Revolution ein weiterer und zugleich der wichtigste Wendepunkt der Orientierung der Türkei an Europa. Zwei wesentliche Ziele verfolgte Atatürk von Beginn an: Die Errichtung eines souveränen und unabhängigen türkischen Staates und die Modernisierung dieses Staates.[6]
Die angestrebten Reformen Atatürks stellten eine konsequente und umfassende Orientierung an Europa dar und hatten die Annäherung an den kulturellen, industriellen und wirtschaftlichen Stand der europäischen Staaten zum Ziel.
Die vielfältigen Modernisierungsversuche im Osmanischen Reich konnten aufgrund der fehlenden Infrastruktur und ihrer oberflächlichen Anwendung jedoch keinerlei tief greifende Veränderung herbeiführen. Damit diese Veränderung verwirklicht werden konnte, verbannten die neuen Machteliten alle Elemente der osmanischen Zeit aus dem Leben der neu gegründeten Republik, auch um eine Wiederkehr bzw. den Versuch eines Machtausbaus der osmanischen Staats- und Gesellschaftsstruktur zu verhindern.
Um eine Republik der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie nach westlichem Muster zu gründen, bediente sich Kemal Atatürk bei seinen Reformmaßnahmen der europäischen Gesetzgebung, die er 1926 einführte. Damit verbunden war das Frauenstimmrecht und die Einführung der Einehe (1926), aber auch die Abschaffung des Islam als Staatsreligion (1928) sowie die Einführung des lateinischen Alphabets und das Verbot des Fes als Kopfbedeckung.[7]
Zudem wurden die neuen Grundlagen der Revolutionspolitik Atatürks in die neue Verfassung aufgenommen, die aufgrund ihres Inhalts und ihrer Beschaffenheit einen außergewöhnlichen Wandlungsprozess, der alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Schichten des Staates umwälzte, herbeiführen sollte. Diese Prinzipien waren:
1. Nationalismus: Errichtung eines türkischen Nationalstaats
2. Säkularismus: Trennung von Staat und Religion und damit Austritt der Türkei aus der islamischen Staatenwelt
3. Republikanismus: Wahl der republikanischen Regierungsform unter endgültiger Abkehr von der Wiedereinführung der Kalifatsherrschaft
4. Populismus : Gleichheit der Bürger ohne Ansehen von Volkszugehörigkeit, Sprache und Religion
5. Etatismus: Bestimmende Rolle des Staates in der Wirtschaft
6. Reformismus: Postulat einer dauerhaften dynamischen Strukturveränderung von Staat und Gesellschaft[8]
Diese sechs Prinzipien bildeten nicht nur die Grundlage der geplanten Verwestlichung, sondern sollten zugleich der Etablierung der Türkei als moderner Nationalstaat dienen, der die gleiche zivilisatorische Stufe erreichen sollte, wie die führenden Nationen der Welt.
Diese Leitbilder der modernen Türkei wurden von Atatürk in einer seiner Reden folgendermaßen formuliert:
„Meine Herren, das Ziel unserer Nation, das Ideal unserer Nation ist Modernisierung in ihrer vollständigen Bedeutung. Wie Sie wissen, ist die Existenz jeder Nation, ihr Recht, in Freiheit und Unabhängigkeit zu leben, proportional zu ihren Errungenschaften auf dem Felde der Zivilisation. Erfolg auf dem Weg der Zivilisation hängt ab von der Modernisierung, von der Übernahme notwendiger Innovationen. Im Leben einer Gesellschaft, in der Wirtschaft und in den Bereichen der Wissenschaft und Technologie ist dies der einzige Weg zum Fortschritt und zur Entwicklung.“[9]
Die Türkei verfolgte außenpolitisch einen streng neutralistischen Kurs. Nach dem Friedensschluss von Lausanne, bei der die Siegermächte die Türkei am 14. Juli 1923 offiziell als souveränen Staat mit unverletzlichen Außengrenzen anerkannt hatten, erklärte sich die Türkei als statuiert, das heißt in ihren Gebietsforderungen als befriedigt.
Um das Land zu entwickeln und Europa näher zu rücken, bedurfte es außenpolitischer Ruhe und unbelasteter Beziehungen sowohl zu den Nachbarstaaten wie auch zu den Großmächten.
2.2 Assoziation der Türkei mit der EWG
Nach dem zweiten Weltkrieg trat die Türkei als Folge des kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion 1952 der NATO bei und damit wurde die Türkei als eine wichtige Südflanke der NATO in das westliche Verteidigungsbündnis integriert. Weitere Mitgliedschaften folgten, wie der Beitritt zur OSZE oder der UNESCO und die Aufnahme in den Europarat in Straßburg 1949.
Den juristischen Grundstein der EWG-Assoziation mit der Türkei legte das „Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der EWG und der Türkei“, das auch als Assoziationsabkommen (AA) oder Ankara Abkommen bezeichnet wird.[10]
Nach schwierigen Verhandlungen wurde das Abkommen schließlich am 12.09.1963 unterzeichnet und trat im darauffolgenden Jahr in Kraft. Im Abkommen sind sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Ziele der Assoziation festgelegt sowie die Rahmenbedingungen zu ihrer Verwirklichung. Um diese Ziele erreichen zu können, wurde im Assoziationsvertrag gemäß Artikel 2 Absatz 3 von je einer Vorbereitungs-, Übergangs- und Endphase ausgegangen, deren Abfolge vom Erreichen bestimmter Vorgaben abhängig gemacht wurde. Die EWG erklärte sich mit diesem Übereinkommen bereit, der Türkei bei der Überwindung besonderer wirtschaftlicher Probleme über einen bestimmten Zeitraum Hilfe zu leisten.
Diese Schritte sollten auch dem politischen Zweck dienen, einen eventuellen späteren Beitritt zu erleichtern.[11]
In der ersten Phase, der Vorbereitungsphase des EWG-Abkommens, wurde das vorläufige Protokoll und das Finanzprotokoll als Anhang dem Assoziationsvertrag beigefügt. Nach seiner Ratifizierung trat es am 01.12.1964 in Kraft. Der Inhalt der Protokolle sollte die Finanz- und Handelsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei regeln. Laut Artikel 3 Absatz 1 des Assoziationsabkommens verpflichtete sich die Türkei mit Hilfe der Gemeinschaft zur Festigung ihrer Binnenwirtschaft in der Übergangs- und Endphase, die auf sie zukommenden Verpflichtungen zu erfüllen.
Alle türkischen Regierungen zwischen 1964 und 1973 betrachteten diesen Schritt als sehr notwendig für die Entwicklung ihres Landes. Bei einem Beitritt in die EU könne die EWG als Katalysator dienen und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes beschleunigen.
Die EWG galt für die erste Demirel-Regierung (1966-1969) als die dynamischste Region der Welt in Bezug auf die ökonomische Entwicklungsrate und das Wohlstandsniveau. Folgende Maßnahmen sollten von der Türkei durchgeführt werden, um den Beitritt zu erleichtern:
1. Veränderung der Struktur der Industrie
2. Ankurbelung der Produktion
3. Vergrößerung des Exportvolumens in die Länder der EWG
4. Förderung der Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Industrie[12]
In ihrem Regierungsprogramm hieß es: „In der Tat betrachten wir das AA mit der EWG, deren Ziele und Inhalte wir unterstützen und zu der wir wichtige Wirtschafts- und Handelsbeziehungen unterhalten, als ein Element, das eine beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung in eine positive Richtung erlaubt.“[13]
Doch die Interessen und Ziele der türkischen Regierungen während der Vorbereitungsphase konnten nicht wunschgemäß in die Tat umgesetzt werden, das bedeutet, die Türkei importierte aus dem EWG-Raum mehr als in die gleiche Region exportiert wurde. Hinzu kamen zu Beginn der siebziger Jahre nach dem Militärputsch von 1971 mehrere politische und wirtschaftliche Krisen, in denen zerstrittene Koalitionsregierungen für eine mehr oder weniger verfahrene Lage sorgten.[14]
In der Übergangsphase (1970-1995) sollten gemäß Artikel 4 des AA „die Vertragsparteien aufgrund gegenseitiger Verpflichtungen die schrittweise Einrichtung einer Zollunion (ZU) zwischen der Türkei und der Gemeinschaft“ sowie „die Annäherung der türkischen Wirtschaftspolitik und derjenigen der Gemeinschaft“ gewährleisten. Bereits auf der 5. Tagung des Assoziationsrats im Mai 1967 forderte Ministerpräsident Süleyman Demirel, die Verhandlungen über den Einstieg in die Übergangsphase mit Beginn des Jahres 1970 einzuleiten, denn die „Türkei, die über ein großes wirtschaftliches Potential verfügt, will dieses Potential nutzen und dadurch sowohl ihre eigene Entwicklung beschleunigen als auch für die Gemeinschaft nutzenbringend wirken. Sie will einen eigenen positiven Beitrag zur Gemeinschaft leisten und im selben Maße davon profitieren.“[15]
Diese Übergangsphase sollte auch die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei regeln und zwar in zwei Stufen bis zum 01.12.1986.[16]
Nach Überlegungen der türkischen Regierung sollte diese Frage im Rahmen der Verhandlungen über das Zusatzprotokoll gelöst werden, da die EWG-Länder diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt ablehnten.
Infolge der Beitrittsanträge von Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen, wurde einer schnellen Überleitung zur Übergangsphase besondere Bedeutung beigemessen. Daher sollte noch vor Beginn der Beitrittsverhandlungen mit den jeweiligen Ländern die Aushandlung erweiterter Handelsbegünstigungen für türkische Produkte durch eine baldige Aufnahme der Verhandlungen über die zweite Phase erreicht werden.
Auch der türkische Zolltarif sollte an den gemeinsamen Außentarif etappenweise angeglichen werden. Maßnahmen, die die Landwirtschaft, die Freizügigkeit der Arbeitskräfte, den Dienstleistungsverkehr und die Angleichung der Wirtschaftspolitik betreffend, sollten sowohl von der Gemeinschaft als auch von der Türkei gleichermaßen ergriffen werden. In dem Bestreben, den beschleunigten Aufbau der türkischen Wirtschaft zu fördern, beteiligte sich die Gemeinschaft im Rahmen der Assoziation an den Maßnahmen zur Entwicklung des Landes. Dafür stellte sie ein Darlehen bereit, das zur Erhöhung der Produktivität der türkischen Wirtschaft beitragen sollte.[17]
Kurz nach der Unterzeichnung des Zusatzprotokolls gab es Kritik aus den Reihen der Opposition sowie Teilen der Industriekammern der Türkei, da das Protokoll nicht auf dem Prinzip der Reziprozität basiere. Trotz dieser Kritik an einzelnen Punkten des Zusatzprotokolls wurde die Ratifizierung von beiden Parteien mit einer deutlichen Mehrheit vollzogen.
Die „Gerechtigkeitspartei“, die im November 1979 an die Macht kam und traditionell eine betont prowestliche Außenpolitik verfolgte, reaktivierte die Beziehungen mit der EG. Die neuen im Juni 1980 verfassten Beschlüsse des Assoziationsrates schienen einen definitiven Kurswechsel zu signalisieren. So wurde unter anderem neben der Anpassung der Zollsätze für landwirtschaftliche Erzeugnisse bis Januar 1987 auch das vierte Finanzprotokoll verabschiedet. Dieses Protokoll sah weitere Haushaltsmittel der EG-Mitgliedstaaten zur Finanzierung von Projekten und zur Steigerung der Produktivität der türkischen Landwirtschaft vor.[18]
Obwohl nach dem Militärputsch vom 12. September 1980 die neue vom Militär eingesetzte Regierung am EG-Kurs ihrer Vorgängerin festhielt, verschlechterten sich die Beziehungen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und der Beschneidung demokratischer Rechte und Freiheiten in der Türkei, so dass das vierte Finanzprotokoll bis auf den heutigen Tag nicht freigegeben wurde. Die Parlamentswahlen vom 6. November 1983 und die danach eingeleiteten internen Liberalisierungsmaßnahmen entspannten das Verhältnis zur EG wieder. So wurde auf der Tagung des Rates am 17. Februar 1986 unter dem Punkt „Allgemeine Angelegenheiten der EG“ ein Papier mit dem Titel „Vorschläge für die schrittweise Normalisierung der Beziehungen“ beschlossen.[19]
Die letzte Phase der Assoziation, die von 1995 bis 1999 dauerte, wurde wiederum vom Erreichen bestimmter Vorgaben abhängig gemacht. Mit der Bildung der Zollunion zwischen der Türkei und der EU nahm die Türkei eine Sonderstellung in den Außenbeziehungen der EU ein. Im Interesse der EG wurde der Türkei ein Bündel substantieller Maßnahmen, die den Anliegen und Bedürfnissen dieses Landes entsprechen, vorgeschlagen.
Ferner ging es um die Wiederaufnahme und Erweiterung der finanziellen sowie um eine Vertiefung der politischen und kulturellen Bindungen. Insgesamt sollte die türkische Industrie in den kommenden Jahren einen erheblichen Strukturwandel mit einem starken Modernisierungsschub erfahren. Vor allem wurde die Bedeutung der Türkei als Produktionsstandort mit gut ausgebildeten und dennoch billigen Arbeitskräften größer und zwar nicht nur für die europäischen Investoren, die bereits mehr als die Hälfte der ausländischen Direktinvestitionen tätigten. Der industrielle Strukturwandel hätte deshalb aller Voraussicht nach die ohnehin hohe Arbeitslosigkeit weiter steigen lassen. Die Integration der südeuropäischen Länder, wie Portugal, Spanien und Griechenland in den europäischen Markt verlief wesentlich leichter als die der Türkei. Sie konnten als Mitgliedstaaten erhebliche Hilfen aus den Regional- und Sozialfonds sowie aus anderen Quellen in Brüssel in Anspruch nehmen, die der Türkei als lediglich assoziiertes Mitglied verwehrt blieben.
2.3 Bildung einer Zollunion zwischen der Türkei und der EU am 01.01.1996
Die Türkei setzte nach langen schwierigen Verhandlungen im Jahre 1995 einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Türkei-EU-Beziehungen. Erst am 31. Dezember 1995 wurde nach Überwindung einiger politischer Hürden die letzte Phase des Assoziationsabkommens mit der Errichtung der Zollunion eingeleitet und die türkische Wirtschaft in den europäischen Wirtschaftsraum EWR integriert.[20]
Das Abkommen konkretisierte und erweiterte die Verpflichtungen beider Vertragsparteien aus dem Zusatzprotokoll vom 23. November 1970 zum Assoziierungsabkommen vom 12. September 1963 und löste somit das Zusatzprotokoll hinsichtlich der Inhalte der Zollunion ab.[21]
Damit wurde die Türkei der einzige Staat, mit dem die EU eine ZU eingegangen ist, ohne dass dieser Mitglied der EU geworden wäre oder eine konkrete Perspektive darauf hätte. Alle tarifären und nicht tarifären Handelsschranken wurden abgeschafft, so dass ein freier Warenverkehr stattfinden konnte; der Dienstleistungsverkehr war ausgenommen. Außerdem wurden die Rechtsvorschriften, technischen Normen und Vorschriften in vielen Bereichen an den EU-Standard angeglichen sowie Regeln zum Schutz des geistigen Eigentums aufgestellt. Eine Wettbewerbsbehörde wurde eingerichtet und staatliche Subventionen für die Industrie wurden gestrichen. Für die Landwirtschaft sollten bis ins Jahr 2005 Übergangsregelungen gelten. Für einige Bereiche in der Kohle- und Stahlindustrie waren Ausnahmeregelungen bis 1999 vorgesehen. Diese Zollunion funktioniert bis dato ohne größere technische Probleme. Das Handelsvolumen mit der EU konnte beträchtlich gesteigert werden; die Importe in die Türkei nahmen zwar vorübergehend wesentlich stärker zu als die Exporte in die EU, was zu einer absoluten, nicht aber relativen Erhöhung des Außenhandelsbilanzdefizits führte. Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen aber nicht im erwarteten Ausmaß, da auf Grund instabiler politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse sowie Korruption das Vertrauen in die türkische Wirtschaft offensichtlich fehlte. Dennoch setzte die Zollunion einen erstaunlichen Modernisierungsprozess der Industrie in Gange, der sich in einer Verbilligung, verbesserten Qualität und einer größeren Vielfalt der Produkte niederschlug und auch zu einer besseren Ausbildung der Arbeitskräfte führte. So konnte die Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Wirtschaft wesentlich gesteigert werden und viele Firmen konnten ausländische Partner finden. Im Rahmen der Zollunion sollte die Türkei eine Finanzhilfe aus dem MEDA-Programm erhalten, die allerdings durch ein Veto Griechenlands und den Entscheid des Europäischen Parlaments im September 1996 nicht ausgezahlt wurde. Begründet wurde dies mit den mangelnden Fortschritten in der Demokratisierung, der Menschenrechtssituation und der Zypernfrage, obwohl dieses Programm zur Förderung der Demokratie und Menschenrechten bestimmt war. Dennoch erhielt die Türkei beträchtliche Finanzhilfen im Rahmen anderer Programme, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen werden soll.
Einen schweren Rückschlag erlitten die Beziehungen durch die Feststellung der EU am Luxemburger Gipfel 1997, dass die Türkei zwar für einen Beitritt geeignet sei, aber nicht in die Liste der Beitrittskandidaten aufgenommen und damit vorderhand vom Beitrittsprozess ausgeschlossen wurde. Dennoch wurden auf der Grundlage von Artikel 28 des Assoziationsvertrags und auf Beschluss des Rates von Luxemburg von der Kommission eine „Europäische Strategie für die Vorbereitung der Türkei auf die Mitgliedschaft“ erarbeitet und im November 1998 legte die Kommission ihren „Bericht über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt“ vor. So konnte die Arbeit wieder intensiviert werden, obwohl der politische Dialog auf Eis gelegt war.
2.4 Erlangung des Kandidatenstatus in Helsinki 1999
Trotz der Gespräche zwischen den Kommissionsdienststellen und den türkischen Behörden bezüglich der Europäischen Strategie kam es nach dem Luxemburger Gipfeltreffen 1997 zu einer deutlichen Abkühlung der türkisch-europäischen Beziehungen, da wegen des Beschlusses des Europäischen Rates von Luxemburg die Hoffnung der Türkei auf einen Beitritt zur EU schwand. Die nachfolgenden Bestrebungen seitens der EU, die Beziehungen wieder zu beleben, scheiterten diesmal an der ablehnenden Haltung der türkischen Regierung. Aufgrund des völligen Stillstands auf politischer Ebene konnte der Assoziationsrat lange Zeit nicht tagen.[22]
Nachdem die darauffolgenden Tagungen des Rates ohne konkrete Ergebnisse für die Türkei verlaufen waren, erreichten die bilateralen Beziehungen wieder einen Tiefpunkt. Die politische Haltung der EU löste in der Türkei eine heftige Debatte darüber aus, warum die Türkei noch vor den Toren Europas warten müsse. Wegen dieser Überlegungen setzte sich die türkische Regierung zunehmend mit der Frage auseinander, ob sie die türkische Außenpolitik neu definieren und dementsprechend die Angelegenheit der EU den sonstigen Außenbeziehungen der Türkei unterordnen solle und machte infolgedessen die weitere Entwicklung der Beziehungen ihres Landes zur EU von den Vorbehalten der Europäer abhängig.[23] Die Türkei kündigte im Juni 1999 nicht nur eine Revision der Zollunion an, sondern drohte auch mit einer Zurückziehung des Beitrittsantrages vom 14. April 1987, wenn ihrem Land nicht der Status eines offiziellen Beitrittskandidaten eingeräumt werden würde.
Angesichts dieser Lage erkannte der Europäische Rat auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am 11. Dezember 1999 in Helsinki endlich die Türkei als Beitrittskandidaten an.[24]
Durch diese Anerkennung einer gleichberechtigten Behandlung der Türkei mit anderen Beitrittsaspiranten eröffneten sich nun für das Land am Bosporus neue europäische Perspektiven. Die Türkei wurde folglich nicht mehr als „Sonderfall“ behandelt und sollte demnach auf der Grundlage derselben Kriterien, die auch für die übrigen Länder gelten, Mitglied der Union werden können.[25]
Zur Vorbereitung der Türkei auf einen Beitritt wurde ein verstärkter politischer Dialog vorgesehen, dessen Schwerpunkt auf der Erfüllung der politischen Beitrittskriterien, vor allem auf der Einhaltung der Menschenrechte und der Lösung der Grenzstreitigkeiten mit Griechenland sowie dem Zypernkonflikt, liegen sollte. Mit dem Beschluss von Helsinki wurde der Türkei jedoch keine konkrete Beitrittsperspektive gegeben und auch kein fester Zeitpunkt für den Beginn von Beitrittsverhandlungen genannt. Vielmehr blieb weiterhin unklar, wann dies geschehen solle, da die Verhandlungen mit der Türkei erst dann aufgenommen werden sollten, wenn sie die politischen Kriterien von Kopenhagen von 1993 erfüllt habe.
[...]
[1] Vgl. Steinbach, Udo, Auf dem Weg zu einer wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft, in: Informationen zur Politischen Bildung, Bonn 2002, S. 50
[2] Vgl. Öymen, Onur, Die Türkische Herausforderung, Köln 2001, S. 114
[3] Vgl. Zippel, Wulfdiether, Spezifika einer Südost-Erweiterung der EU, Baden-Baden 2003, S. 128
[4] Vgl. Verhandlungen in Kopenhagen – Streit in Berlin, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.12.2002, Nr. 290, S. 2
[5] Stoiber, Edmund, Verhandlungen in Kopenhagen - Streit in Berlin, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.12.2002, S. 2
[6] Vgl. Yesilyurt, Zuhal, Die Türkei und die Europäische Union, Osnabrück 2000, S. 24
[7] Vgl. Steinbach, Udo, Grundlagen und Anfänge der Republik, in: Informationen zur Politischen Bildung, Bonn 2002, S. 10
[8] Vgl. ebd., S. 10
[9] Zitiert nach: Atatürks Reden und Erklärungen, Band III, S. 68
[10] Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der EWG und der Türkei, in: Amtsblatt der EG, Nr.217 vom 29.12.1964, S. 3687 ff.
[11] Kramer, Heinz, Westeuropa und die Türkei: Auf dem Weg zum 13. Mitglied der EG, Ebbenhausen 1988, S. 62
[12] Dagli/Aktürk, Band II, S. 107
[13] Vgl. ebd., S. 127
[14] Vgl. Yesilyurt, Zuhal, Die Türkei und die Europäische Union, Osnabrück 2000, S. 43
[15] Zitiert nach: Ilkin, Selim, A Short History of the Turkey with the EC (1962-1983), Manuskript, Istanbul 1984, S. 11
[16] Vgl. Yesilyurt, Zuhal, Die Türkei und die Europäische Union, Osnabrück 2000, S. 44
[17] Vgl. Art.1 des Finanzprotokolls
[18] Vgl. 27. Bericht über die Tätigkeit des Rates vom 21.1.-31.12.1979, S. 135
[19] Vgl. Kommission der EG, Vorschläge für die schrittweise Normalisierung der Beziehungen, Brüssel 3/1986, S. 1
[20] Vgl. European Union-Turkey Customs Union, in: www.deltur.cec.int/english/ei-union
vom 12.04.04
[21] Vgl. Yesilyurt, Zuhal, Die Türkei und die Europäische Union, Osnabrück 2000, S. 137
[22] Vgl. Regelmäßiger Bericht der Kommission über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt von 1999, KOM (1999) 513, endg., S. 6
[23] Vgl. Jakobs, Adam, Die Beziehungen der Türkei zur EU und die Frage des türkischen Beitritts, Aus Politik und Zeitgeschichte, Bonn 2000, Bd.29/30, S. 22 f.
[24] Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Rates, in: http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec99_de.htm, 12.05.04
[25] Vgl. http://europa.eu.int/council/off/conclu/1999/htm vom 12.05.04
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832491604
- ISBN (Paperback)
- 9783838691602
- Dateigröße
- 708 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – Philosophische Fakultät, Politikwissenschaft
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- verhandlung kopenhagener kriterien reform eu-kommission beitritt
- Produktsicherheit
- Diplom.de