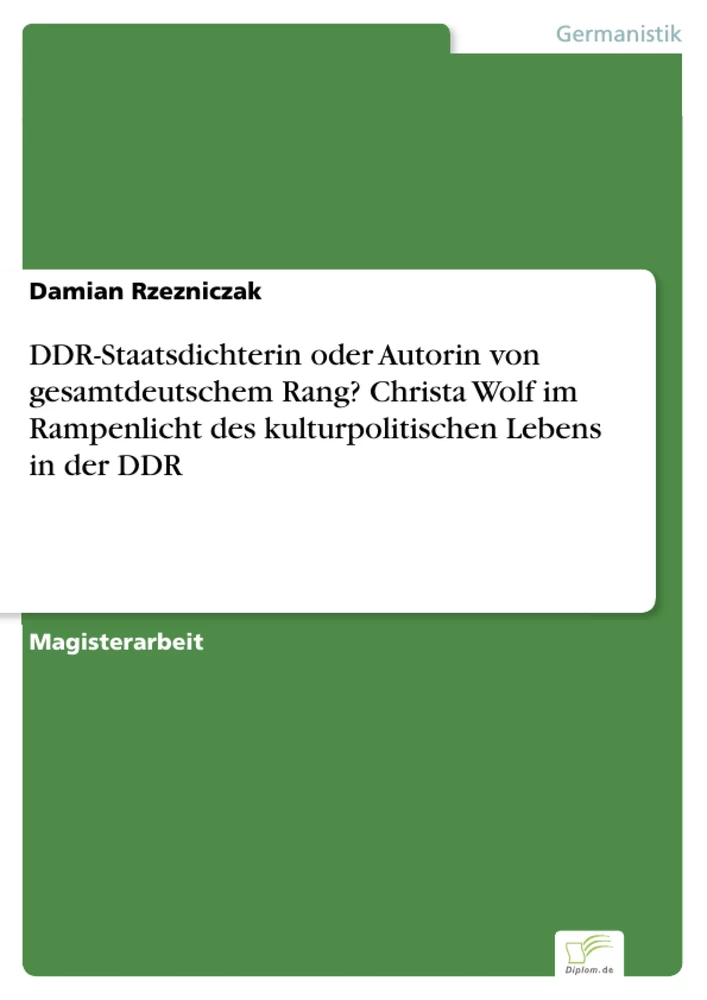DDR-Staatsdichterin oder Autorin von gesamtdeutschem Rang? Christa Wolf im Rampenlicht des kulturpolitischen Lebens in der DDR
Zusammenfassung
Mir scheint, für das bessere Verständnis zwischen Ost- und Westdeutschen wäre manches gewonnen, wenn man begreifen würde, dass Staat und Gesellschaft nicht gleichzusetzen sind. Die DDR war kein monolithischer, sich über vierzig Jahre gleich bleibender Block. Im Verlauf ihrer Geschichte entwickelte sich immer mehr ein eigenständiges gesellschaftliches Leben, in dem ich alle Varianten von Verhaltensweisen beobachte von der absoluten Anpassung bis zur absoluten Gegnerschaft.
Diese Worte Christa Wolfs aus einem Gespräch anlässlich ihres 70. Geburtstags im Jahre 1999 weisen darauf hin, was dieser Autorin bedeutsam war und warum uns ihre Werke gerade im vereinten Deutschland Einblicke erlauben wie wenige andere. Ihre literarischen Texte bieten ein sehr viel authentischeres Gesellschaftsbild, als expositorische Texte aus der DDR-Zeit zu leisten vermögen, da diese in keiner Weise die Möglichkeit hatten, sich dem ideologischen Erwartungshorizont und der damit verbundenen Zensur zu entziehen. Diese Feststellung lässt unbestritten den Schluss zu, die Autorin Christa Wolf zu den bekanntesten und einer der beliebtesten Schriftstellerin der Nachkriegszeit aufzuführen. In der DDR war sie nicht nur eine angesehene Schriftstellerin, sondern auch eine der interessantesten und wichtigsten Persönlichkeiten im politischen und kulturellen Leben. Sie wurde sehr oft in ihrer Heimat wegen ihrer kritischen Haltung massiv kritisiert; nach der Wende wurde ihr öffentlich eine exorbitante Nähe zur Regierung der DDR vorgeworfen. Im Jahre 1989 wurde sie massiv vom westdeutschen Kritiker Marcel Reich-Ranicki angegriffen und von ihm als Staatsdichterin attackiert.
Christa Wolf stand damit im Jahre 1990 im Zentrum des so genannten deutsch-deutschen Kulturstreites. Es ist jedoch ein Indiz dafür, welche Bedeutung dieser Autorin im Kanon deutscher Literatur in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zukommt. Christa Wolf engagierte sich schon während des Wiedervereinigungsprozesses mit vielen Reden und hatte für eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik plädiert, was ihr von so mancher Seite verübelt wurde. Die Veröffentlichung ihres Werkes Was bleibt erregte jedoch grandioses Aufsehen. Die Presse der ehemaligen Bundesrepublik- zuvor meist äußerst positiv gegenüber den Werken der Autorin ging plötzlich zu einer extrem scharfen Kritik über. Der Inhalt des Buches behandelt etwas für den DDR-Staat nichts Ungewöhnliches: die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Zur Person. Die wichtigsten biografischen Stationen im Leben und Werk von Christa Wolf
2. Rezeption der ausgewählten Werke von Christa Wolf im Westen und im Osten
2.1. Schreiben unter dem Einfluss des „Bitterfelder Weges“. „Der geteilte Himmel“ als literarischer Durchbruch und Paradewerk des sozialistischen Realismus
2.2. Prosa der subjektiven Authentizität und das erste Werk gegen die DDR-Zensur: „Nachdenken über Christa T.“
2.3. Abrechnung mit Faschismus..„Kindheitsmuster“
2.4. Gegenwartsprobleme hinter historischer Kulisse in „Kein Ort. Nirgends“
2.5. „Frauen und Frieden als Hauptthemen im erfolgreichsten Werk der Schriftstellerin: „Kassandra“
2.6. Autorin als Befürworterin der globalen Abrüstungspolitik: „Störfall“
2.7. „Was bleibt“ als Auslöser des gesamtdeutschen Literatur Streits und der so genannten Christa-Wolf-Debatte
3. Abrechnung mit der eigenen Stasi-Vergangenheit nach der Veröffentlichung der Christa-Wolf-Akte
3.1. Inhalt der „Täter-Akte“
3.2. „Eine Auskunft“ als Auslöser der Stasi-Debatte
4. „Staatsdichterin“ versus „gesamtdeutsche Autorin“: zur eigentlichen Rolle von Christa Wolf im kulturpolitischen Leben der DDR
Schlussbetrachtung .
Streszczenie
Literaturverzeichni
Vorwort
„Mir scheint, für das bessere Verständnis zwischen Ost- und Westdeutschen wäre manches gewonnen, wenn man begreifen würde, dass Staat und Gesellschaft nicht gleichzusetzen sind. Die DDR war kein monolithischer, sich über vierzig Jahre gleich bleibender Block. Im Verlauf ihrer Geschichte entwickelte sich immer mehr ein eigenständiges gesellschaftliches Leben, in dem ich alle Varianten von Verhaltensweisen beobachte – von der absoluten Anpassung bis zur absoluten Gegnerschaft.“ [1]
Diese Worte Christa Wolfs aus einem Gespräch anlässlich ihres 70. Geburtstags im Jahre 1999 weisen darauf hin, was dieser Autorin bedeutsam war und warum uns ihre Werke gerade im vereinten Deutschland Einblicke erlauben wie wenige andere. Ihre literarischen Texte bieten ein sehr viel authentischeres Gesellschaftsbild, als expositorische Texte aus der DDR-Zeit zu leisten vermögen, da diese in keiner Weise die Möglichkeit hatten, sich dem ideologischen Erwartungshorizont und der damit verbundenen Zensur zu entziehen. Diese Feststellung lässt unbestritten den Schluss zu, die Autorin Christa Wolf zu den bekanntesten und einer der beliebtesten Schriftstellerin der Nachkriegszeit aufzuführen. In der DDR war sie nicht nur eine angesehene Schriftstellerin, sondern auch eine der interessantesten und wichtigsten Persönlichkeiten im politischen und kulturellen Leben. Sie wurde sehr oft in ihrer Heimat wegen ihrer kritischen Haltung massiv kritisiert; nach der Wende wurde ihr öffentlich eine exorbitante Nähe zur Regierung der DDR vorgeworfen. Im Jahre 1989 wurde sie massiv vom westdeutschen Kritiker Marcel Reich-Ranicki angegriffen und von ihm als „Staatsdichterin“ attackiert.
Christa Wolf stand damit im Jahre 1990 im Zentrum des so genannten deutsch-deutschen Kulturstreites.[2] Es ist jedoch ein Indiz dafür, welche Bedeutung dieser Autorin im Kanon deutscher Literatur in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zukommt. Christa Wolf engagierte sich schon während des Wiedervereinigungsprozesses mit vielen Reden und hatte für eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik plädiert, was ihr von so mancher Seite verübelt wurde. Die Veröffentlichung ihres Werkes ‚Was bleibt’ erregte jedoch grandioses Aufsehen. Die Presse der ehemaligen Bundesrepublik- zuvor meist äußerst positiv gegenüber den Werken der Autorin – ging plötzlich zu einer extrem scharfen Kritik über. Der Inhalt des Buches behandelt etwas für den DDR-Staat nichts Ungewöhnliches: die Überwachung der Protagonistin durch die allgegenwärtige ‚Stasi’, den Staatssicherheitsdienst – eine Tatsache, die dann im Jahre 1993 in einem Band des Luchterhand Verlages dokumentiert wurde.[3] Dieses Thema war schon kurz nach der Wende eingehend in den deutschen Medien dargestellt und analysiert worden, also allgemein bekannt: Rund hunderttausend vollzeitige sowie etwa eine halbe Million nebenamtliche Mitarbeiter erlaubten eine fast lückenlose Kontrolle des autokratischen Staates über seine Bürger. Was also erregte die Gemüter?
Als ihr Werk ‚Was bleibt’ – schon zehn Jahre zuvor (1979) geschrieben – kurz nach der Wende etwas überarbeitet auf den Markt kam, wurde in den ersten Rezensionen vor allem der Zeitpunkt der Veröffentlichung kritisiert. Ulrich Greiner verweist mit einer gewissen Selbstgerechtigkeit in der Zeitung ‚Zeit’ darauf, dass die Veröffentlichung vor dem 09. November 1989, also vor dem Mauerfall, eine „Sensation gewesen wäre, die sicherlich das Ende der Staatsdichterin Christa Wolf und vermutlich ihre Emigration zur Folge gehabt hätte“.[4] Auch wurde der Umstand gerügt, dass die Autorin das zehn Jahre alte Manuskript nach der Wende überarbeitet hat. „Was da überarbeitet wurde, wissen wir nicht; doch gerade, dass es im Dunkeln bleibt, macht dieses bislang letzte Buch der bekannten Schriftstellerin der DDR so ungemein symbolisch. Seine schmale Wahrheit ist schon die überarbeitete Wahrheit. Sein Mut ist schon die revidierte Form von Mut. Seine Selbstbezichtigungen sind schon die korrigierte Form von Selbstbezichtigungen.“[5]
Plötzlich also wurde Christa Wolf als Staatsdichterin abgestempelt, ihr Mut bezweifelt und ihr sogar schlechtes Deutsch vorgeworfen. Vor allem der Vorwurf ihres Verbleibens in der DDR zeugt von Unverständnis, denn eine Emigration war keine Alternative für die Autorin. Nicht nur persönliche Gründe wie ein alter Vater und ihre Töchter schlossen für sie ein Verlassen des Landes aus, sondern weil die DDR nicht nur ihre geographische und ideologische, sondern auch ihre literarische Heimat war, wie sie es noch im Dezember 1998 formuliert hatte: „Ich bin eigentlich nur an diesem Lande brennend interessiert gewesen. Die scharfe Reibung, die zu produktiven Funken führte, fühlte ich nur mit aller Verzweiflung, dem Kaltgestellt sein, den Selbstzweifeln, die das Leben hier bringt. Das war mein Schreibgrund.“[6] Christa Wolf wollte schreiben, speziell für die Menschen in der DDR, sie wollte die Konflikte mitgestalten, die sich aus dieser zeitgeschichtlichen Situation ergaben. Das hat sie auf ihre Weise in souveräner Art getan. Die Tatsache, dass viele ihrer Bücher in der DDR nur mit Schwierigkeiten veröffentlicht werden konnten, zeugt davon, wie sehr sie sich am Rande dessen bewegt hat, was in der DDR akzeptabel war. In der Tat enthielten ihre Texte für die Leser in der DDR Informationen und Denkanstöße, wie sie eben im Feuilleton der DDR-Zeitungen nicht zu finden waren, ein Aspekt, der auch von Walter Jens in seiner Verteidigung von Christa Wolf hervorgehoben wurde: „Welche konsequente Absage an harmonische Weltbilder und stattdessen welch eine Entschlossenheit, innerhalb der sozialistischen Gesellschaft Widersprüche sichtbar zu machen!“[7] Dabei sollte betont werden, dass dies nicht ohne bedeutendes persönliches Risiko geschah, denn alle Publikationen, auch die der prominentesten Autoren der DDR, unterlagen der Zensur.
Christa Wolf war jederzeit bestrebt, ihren Beitrag zur Veränderung jenes ‚real existierenden’ Staates zu leisten, indem sie versuchte, durch ihre Werke den intellektuellen Freiraum zu erweitern. Das konnte aber nur geschehen, wenn sie dort auch weiterhin veröffentlichen konnte. Die DDR war ihrer Auffassung nach reformfähig; jedenfalls verkörperte dieser Staat für sie und andere die einzige Hoffnung auf Verwirklichung einer idealen Gesellschaftsform auf deutschem Boden. Dabei handelte es sich um die Vision einer humanen, wahrhaft demokratischen und gleichzeitig sozialistischen Gesellschaftsordnung, an der die Autorin auch noch festhielt, als es immer klarer wurde, dass sie zum Scheitern verurteilt war, dass sich ihre Hoffnung als Utopie erwiesen hatte.
Um möglichen Vorurteilen vorzubeugen und diese schwierige Periode deutscher Vergangenheit in ihrer Komplexität besser zu begreifen, kurz, um dazu beizutragen, die „Mauer in den Köpfen“ abzubauen, ist insbesondere für die junge Generation in den alten sowie in den neuen Bundesländern ein besseres und möglichst wirklichkeitsnahes Verständnis jener Zeit wichtig. Die Tatsache, dass die Werke Christa Wolfs viel gelesen worden sind und auch weiterhin gelesen werden, lässt den Schluss zu, dass Christa Wolf auch im 21. Jahrhundert ihren Platz als bedeutende deutsche Autorin behaupten wird. Ihr Werk wird gewiss weiterhin gelesen werden - nicht nur, weil es zu einem besseren Verständnis der deutschen Zweistaatlichkeit verhilft, sondern ebenso, weil es die geopolitischen Grenzen des DDR-Staates in vielfältiger Weise auf hohem künstlerischen Niveau und mit grundsätzlichen, allgemein menschlichen Fragen durchbrochen hat.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich den Vorwurf des westdeutschen Feuilletonisten Reich-Ranicki auseinander legen und aufzeigen, inwiefern man die Person Christa Wolf zu einer Staatsdichterin interpretieren kann, die letztlich nichts mit dem SED-Staat gemein hatte beziehungsweise in welcher Form man von einer gesamtdeutschen Schriftstellerin ausgehen kann. Hierzu möchte ich mich nicht nur ihrer literarischen Werke bedienen, vielmehr müssen diese um biographische, politische und kulturelle Wertungen ergänzt werden. Erst die Erörterung und Analyse dieser vielfältigen Facetten kann ein wahrheitsgetreues und vollständiges Bild dieser bedeutsamen Schriftstellerin formen.
Die Untersuchungen fokussieren grundsätzlich auf drei Themenkreise. Zunächst werden die wichtigsten biographischen Daten im Leben und Werk der Autorin behandelt. Weiter werde ich auf die Rezeption ausgewählter Werke eingehen, wobei sowohl die Rezeption im Osten als auch im Westen Deutschlands detailliert berücksichtigt und abgegrenzt wird. Ihre Werke, deren Inhalt und Rezeptionen zeugen am ehesten vom Wirken und Schaffen der Autorin. Daher wird zusätzlich zu jedem Werk auch den Hintergrund seiner Entstehung erklärt. Weiter werden zwei gesamtdeutsche Literaturdebatten, in deren Zentrum sich Christa Wolf befand, eingehend untersucht. Wie bereits eingangs dargelegt, beziehen sich die meisten Denunziationen, Angriffe und Vorwürfe seitens westdeutscher Kritiker auf die Stasi-Vergangenheit der Autorin, ihre Stellung hierzu und ihrem Werk ‚Was bleibt’. Abschließend möchte ich die wichtigsten Etappen im Leben von Christa Wolf, in denen sie politisch außerordentlich präsent war und die strikt ihre eigentliche Stellung im SED-Staat präsentiert, schildern und interpretieren.
Die Arbeit schließt mit einer eigenen Schlussbetrachtung.
1. Zur Person. Die wichtigsten biografischen Stationen im Leben und Werk von Christa Wolf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Christa Wolf wurde am 18. März 1929 als Tochter von Herta Ihlenfeld und Otto Ihlenfeld in damaligem Landsberg an der Warthe (heute Gorzów Wielkopolski) geboren. Zusammen mit dem drei Jahre jüngeren Bruder wuchs Christa Ihlenfeld in materiell gesicherten Verhältnissen auf. Die Eltern gehörten zum aufstrebenden, arbeitsamen Mittelstand. Sie führten zusammen ein Lebensmittelgeschäft, wovon sie sich und ihren beiden Kindern bis Mitte der 40er Jahre ein materiell stabiles Leben sichern konnten. Christa wuchs in einem milden protestantischen Geist der Rechtschaffenheit auf. Sie behauptet von sich, sie „sei ein gut erzogenes, aber aufmüpfiges Kind gewesen. Sie wurde am Jahrestag der Revolution von 1848 geboren und ihre Mutter bezeichnete sie als ein richtiges Revolutionsbaby, weil sie ganz bestimmte Standpunkte einfach nicht aufgab“.[8]
Obwohl die Eltern der protestantischen Konfession angehörten, war für sie die Kirche als Institution kein Ort, der ihr alltägliches Leben bestimmte. So schickten sie ihre Tochter im Jahr 1943 eher den religiösen Großeltern zuliebe als aus eigener innerer Überzeugung zur Konfirmation. Für Christa Wolf war die Vorbereitung dieser Feierlichkeit sowie die Konfirmation selbst eine Zeremonie, welcher sie der ganzen Zeit volle Respektlosigkeit zeigte.
Zur Schule ging sie umso viel lieber als zur Kirche. Sie war eine ehrgeizige und fleißige Schülerin. Zu Hause kam sie mit Literatur kaum in Berührung. Als Kind verschlang sie aber wahllos Bücher, die gängig und verfügbar waren, nicht unbedingt Nazibücher, aber umso mehr ‚Autoren zweiter Klasse’ wie Bindig, Carossa, Jelusich, Grimm oder Johst. In der Oberschule befasstete sie sich fast ausschließlich mit nazistischen Pflichtlektüren, welche die junge Schülerin durch ihre chauvinistischen und kriegsbegeisterten Inhalte von der wahren Literatur total absperrten. Wie in vielen deutschen Schulen nach Hitlers Machtergreifung lernte auch Christa Wolf schon mit sieben Jahren ihre Moral deformierende Sprüche, wie „Seele ist Rasse von innen gesehen. Rasse ist Seele von außen gesehen“[9]. Als Kind im Nazi-Staat musste sie auch hassen lernen; zu Hassobjekten wurden Juden und Kommunisten, obwohl sie so richtig keinen der beiden kannte. Deshalb funktionierte auch diese Widerwärtigkeit gegen diese Menschen nicht in der Form, wie man es sich vorstellte. Deutsch war eins ihrer Lieblingsfächer und schon in der Schulzeit versuchte sie eigene Texte zu schreiben. „Schreiben entsprach dem kindlichen Wunsch, sich zu verwandeln, eine Andere zu sein und die Begrenztheit des eigenen Lebens zu überwinden“[10]
Am 01.09.1939 war Christa Wolf gerade zehn Jahre alt. Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges brachte auch in ihr Leben viele Veränderungen ein. Die Atmosphäre im Hause Ihlenfeld war eher gedrückt, die Familie war wenig von oft herrschender Kriegsbeigeisterung mitgenommen. Ihre Heimatstadt war in den ersten vier Jahren nicht betroffen von den Kampffolgen; deshalb war der Glaube an den Endsieg Hitlers ziemlich lange im damaligen Landsberg an der Warthe spürbar. Doch Ende des Jahres 1944 wurde die Stimmung immer unheimlicher. Am 29. Januar 1945 flüchtete Familie Ihlenfeld wie Tausende Landsberger Familien vor den Sowjets in Richtung Westen.
Die Flucht war eines der traumatischsten Erlebnisse im Leben von Christa Wolf. Sie geriet in einen Schockzustand und wurde zum ‚Blickwechsel’ gezwungen, war erschrocken über die eigene Schuld – beginnende Ahnung, an das Falsche geglaubt zu haben. Es verlor alles an Halt, was ihre Weltanschauung und Ethik fundamentierte. Der ganze Glauben erwies sich nur als Illusion, eine abrupt zerplatzte Seifenblase.
Familie Wolf ließ sich in den ersten zwei Jahren nach 1945 in Gammelin bei Schwerin nieder. Dort leistete Christa Wolf einen Beitrag zum Lebensunterhalt der ganzen Familie, indem sie als Schreibkraft beim Bürgermeister täglich arbeitete.
Im Jahre 1947 zog sie mit ihren Eltern nach Bad Frankenhausen, wo sie wieder das Gymnasium besuchte und mit Erfolg das Abitur ablegte. In der Oberschule las sie zum ersten Mal „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers, die sie später als Vorbildsschriftellerin jahrelang bei ihrem schriftstellerischen Schaffen begleitete.
Im November 1948 wurde sie Mitglied der FDJ und ein halbes Jahr später trat Christa Wolf der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands bei. „Anfangs war sie eine überzeugte Sozialistin, aber je mehr das Regime der SED verfiel und sich abzeichnete, dass es dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft eher hinderlich war, desto mehr entfernte und distanzierte sich Christa Wolf auch von diesem Regime.“[11]
Als am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik gegründet wurde, begann sie ihr Deutsch- und Geschichtestudium an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Hier lernte sie ihren späteren Ehemann Gerhard Wolf kennen. Aus der später geschlossenen Ehe gingen die Kinder Anette und Katrin hervor. Gerhard Wolf beeindruckte sie mit seinen literarischen Kenntnissen und hatte auch einen bedeutenden Einfluss auf ihre spätere schriftstellerische Aktivität. Christa Wolf verfiel am Anfang ihrer intensiven Leserschaft dem jungen Goethe, Luckács und Rilke. Ihre literarischen und literaturtheoretischen Horizonte wurden durch den gegenseitigen Lektürenaustausch mit ihrem Ehemann stetig erweitert. Ihre ersten literaturkritischen Texte erschienen schon während der Studienzeit.[12]
Als Gerhard Wolf eine Stelle als Hilfsredakteur beim Rundfunk in Leipzig bekam, setzte Christa Wolf in Leipzig ihr Germanistikstudium fort. Ihre Diplomarbeit mit dem Thema ‚Probleme des Realismus im Werk Hans Falladas’ schrieb sie bei Hans Meyer. In der auf einer geliehenen Schreibmaschine getippten Arbeit bemühte sich die junge Studentin Fallada nachzuweisen, wie sehr „seine kleinbürgerliche Ideologie dem Realismus seiner Romane geschadet“ habe.[13]
Nach ihrem Studienabschluss im Jahre 1953 arbeitete sie sechs Jahre lang als Lektorin und Herausgeberin beim Verlag ‚Neues Leben’ im Deutschen Schriftstellerverband. In den Jahren 1958 und 1959 war sie als Redakteurin der Zeitschrift ‚Neue Deutsche Literatur’ tätig und von 1959 bis 1962 arbeitete sie als freie Mitarbeiterin des ‚Mitteldeutschen Verlages’ in Halle. Ihr schriftstellerisches Debüt mit einem Prosawerk war die Erzählung ‚Moskauer Novelle’, die nur im Osten veröffentlicht wurde, wo sie auch viel Beachtung fand. Diese Liebesgeschichte im Kontext des ‚Bitterfelder Weges’ mit der Nachkriegsproblematik im Hintergrund ist im Westen nie auf dem Buchmarkt erschienen.
Familie Wolf zog 1962 nach Kleinmachnow, einem kleinem Ort bei Berlin, wo Christa Wolf als professionelle, freiberufliche Schriftstellerin zu arbeiten begann, indem sie zuerst Briefe und Tagebücher schrieb. Unmittelbare Popularität und Kritik brachte der Schrifstellerin des sozialistischen Realismus mit Sicherheit ihr 1963 veröffentlichter Roman ‚Der geteilte Himmel’, der mit seiner Erstauflage von 160 000 Exemplaren sofort vergriffen war. Ausgezeichnet für dieses Werk wurde sie mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste. In dem Roman setzt sie sich mit Problemen des gespalteten Deutschlands auseinander. Das Buch fand auch bald eine Verfilmung von Regisseur Konrad Wolf.
Im Jahre 1964 erhielt sie den Nationalpreis III. Klasse für Kunst und Literatur und wurde im Jahre 1974 Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Sie konnte sich frei bewegen, reiste zu zahlreichen Lesungen und Vorträgen oder folgte Einladungen von Universitäten in die Bundesrepublik und verschiedene andere westliche Länder, sie reiste sogar in die USA, Schottland, Italien und in die Schweiz, wo sie Gastvorträge hielt.[14]
Als Kandidatin des ZK der SED, einer Funktion, die sie von 1963 bis 1967 innehatte, setzte sie sich öffentlich im Jahre 1965 bei dem 11. SED-Plenum gegen die restriktive Kulturpolitik, Bevormundungen gegen Autoren sowie gegen dogmatische Fehleinschätzungen ein.
In dieser Periode entstand eine gespannte Beziehung zum SED-Staat DDR, die mit dem Ausscheiden aus dem Gremium begann und sich später unter anderem auf die minimierten Auflagen und stillen Kämpfe mit der Zensur ihrer Neuerscheinungen auswirkte.
Das im Jahre 1968 erschienene Buch ‚Nachdenken über Christa T.’ erzählt von den wichtigsten Lebensstationen einer kürzlich an Leukämie verstorbenen Bekannten nach dem Motto Johannes R. Bechers „Was ist das: Dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen?“. Die im Roman erzählte Geschichte ist auch eine Sammlung von Gedanken, Erinnerungen, Rückblicken und Reflexionen der Erzählerin über ihren eigenen Schreibprozess und ihre Subjektivität. Nach dem anfänglichen Druckverbot betrug die Erstauflage dieses Buches nur 800 Exemplare, was eine Folge der DDR-Zensurpolitik war.
Mit der Veröffentlichung ihres Werkes ‚Kindheitsmuster’ im Jahre 1976 etablierte sich Christa Wolf endgültig im deutschen Literaturbetrieb. In dieser Erzählung beschrieb sie ihre Kindheit im Dritten Reich und teilte die Schuld der Nazi-Zeit jedem Deutschen zu. Derartige Verhaltensmuster wie Autoritätsgläubigkeit, Misstrauen, Intoleranz und Veränderungsmechanismen thematisieren dieses Werk.
Trotz der gespannten Beziehungen mit dem SED-Gremium engagierte sie sich immer öffentlich gegen kulturelle Missstände in der DDR. Im Jahre 1976 intervenierte sie zusammen mit vielen anderen AutorenInnen in einem Protestbrief gegen die Ausbürgerung vom Schriftsteller und Liedermacher Wolf Biermann. Durch diese Stellungnahme verlor sie ihre Mitgliedschaft im Ostberliner Ausschuss der Schriftstellervereinigung der DDR.
Im Jahre 1979 erschien auf dem Buchmarkt ihr Werk ‚Kein Ort. Nirgends’. Deutsche Geschichte wird Christa Wolf zum Steinbruch für ein fiktives Gespräch, für Gedanken und Gefühle, die bis heute gültig sind. Es ist die Beschreibung einer Begegnung zwischen Heinrich von Kleist und Karoline von Günderrode als ein Vorwort zu ihren Selbstmorden. Das Buch fand in der Presse eine breite Resonanz und wurde bald zum Verkaufsschlager.
In den siebziger Jahren vertieften sich viele Freundschaften zu anderen deutschen Autorinnen, die eine deutliche Auswirkung auf ihre späteren Prosawerke hatten. Der Tod ihrer drei Kolleginnen: Brigitte Reimann, Ingeborg Bachmann – beide 1973 und Maxie Wander im Jahre 1977 beeinflußte eine spürbare Einsensibilisierung in ihren darauffolgenden Werken.
Mit der im Frühjahr 1983 im Luchterhand-Verlag Darmstadt erschienenen Erzählung ‚Kassandra’ greift sie auf antike Motive zurück. Mit der Bearbeitung des Kassandramythos behandelte die Schriftstellerin das Motiv des Handelns wider besseren Wissens und unternahm zugleich den Versuch, eine "weibliche Ästhetik" zu schaffen. Die Darstellung der matriarchalisch geprägten Kultur beinhaltet differenzierte Kritik an den patriarchalischen Strukturen der heutigen Gesellschaft.[15]
Im Jahre 1987 erschien ‚Störfall . Nachrichten eines Tages’, eine Erzählung, welche die Gedanken der Erzählerin über die Zukunft vor dem Hintergrund des Tschernobylunfalls beschreibt. Im gleichen Jahr wurde Christa Wolf mit dem Nationalpreis 1. Klasse der DDR ausgezeichnet.
Mit der Wende gab es viel negativen Wirbel um die Person Christa Wolf. Nachdem sie im Juni 1989 aus der SED ausgetreten war, mischte sie sich mit Reden, offenen Briefen und Lesungen stets in die aktuellen politischen Geschehnisse ein. Am 28. November 1989 gehörte sie mit Stephan Heym, Volker Braun und Friedrich Schorlemmer zu den Erstunterzeichnern des ‚Aufrufs für unser Land’, der sich für die Weiterexistenz einer eigenständigen DDR und gegen die Vereinnahmung durch die Bundesrepublik einsetzte.
Im Jahre 1990 erschien das Prosastück ‚Was bleibt’ – eine 1979 geschriebene autobiographisch geprägte Erzählung, in der sie das Psychogramm einer vom Staatssicherheitsdienst der DDR überwachten Frau zeichnete. Das Buch löste heftige Kontroversen aus, nachdem Wolf selbst in den Verdacht geriet, als Informantin der Staatssicherheit tätig gewesen zu sein.
Bis Mitte der neunziger Jahre hatte es Christa Wolf nie leicht mit ost- und westdeutschen Kritikern. In der DDR wurde sie massiv kritisiert wegen ihrer kritischen Haltung, nach der Wende wurde sie öffentlich wegen zu großer Nähe zur Regierung der DDR angegriffen.
Seit 1990/1991 beschäftigte sich Christa Wolf nach ihrem Werk ‚Kassandra’ wieder mit einem mythologischen Stoff, diesmal unter dem Aspekt, dass unsere Kultur, wenn sie in die Krise gerät, immer wieder in die gleichen Verhaltensmuster gerät, indem sie Menschen an den Rand der Gesellschaft stellt und sie unter Druck stellt. Herabsetzung des Fremden, mangelnde Zivilcourage und Fremdenfeindlichkeit sind Hauptprobleme dieses Buches. Christa Wolf stellt mit ihrer Hauptfigur Fragen wie: Wozu brauchen wir Sündenböcke? Welche Rolle spielen Menschenopfer in der Geschichte und Vorgeschichte?
Das Buch erfreute sich großer Leserpopularität und stand mit mehr als 100000 verkauften Exemplaren innerhalb weniger Monate rasch auf den Bestsellerlisten.
Im Januar 1993 erschienen die so genannten ‚Täter Akte’ - Stasi Dokumente, die zu zeigen scheinen, dass Christa Wolf Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre eine Zeit lang für die Stasi arbeitete. Der Stern von Christa Wolf in der öffentlichen Meinung begann zu sinken. Die veröffentlichten Dokumente erregten viele heftige Diskussionen und Empörung über die angebliche Zusammenarbeit der Schriftstellerin mit dem ostdeutschen Spitzelapparat.
Nach dieser Hetzjagd auf ihre Person zog sie sich aus dem öffentlichen Leben in Deutschland zurück und ging in die USA. In den darauf folgenden Jahren veröffentlichte sie drei Werke ‚Auf dem Weg nach Tabou’, ‚Medea’ und ‚Leibhaftig’, in denen sie ihre deutsch-deutsche Vereinigungs- und Ausgrenzungserfahrung bearbeitete.
Im Jahre 1999 kam eine Sammlung ihrer in den letzten Jahren vereinzelt veröffentlichten Reden, Aufsätze und Erzählungen unter dem Titel ‚Hierzulande, Andernorts’ heraus. Sie drückte hier unter anderem ihre Gedanken und Gefühle gegenüber dem vereinten Deutschland und ihrer DDR-Vergangenheit aus.
Das 2003 veröffentlichte Buch ‚Ein Tag im Jahr’ ist Christa Wolfs momentan aktuellstes Werk, in dem sie kurze Beiträge zum 27. September jeden Jahres in der Zeitspanne von 1960 bis 2000 leistet.
Christa Wolf wurde bislang mit über zwölf wichtigen literarischen Preisen geehrt, unter anderem im Jahre 1963 mit dem Heinrich-Mann-Preis, im Jahre 1972 mit dem Theodor-Fontane-Preis für Kunst und Literatur, im Jahre 1980 mit dem Georg-Büchner-Preis, im Jahre 1985 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur und im Jahre 1987 mit dem Geschwister-Scholl-Preis.
2. Rezeption der ausgewählten Werke von Christa Wolf im Westen und im Osten
2.1. Schreiben unter dem Einfluss des „Bitterfelder Weges“. „Der geteilte Himmel“ als literarischer Durchbruch und Paradewerk des sozialistischen Realismus.
Mit der Erzählung „Der geteilte Himmel“, der Geschichte einer Liebe, welche im Sommer 1961 an der Teilung Deutschlands scheitert, erlang Christa Wolf im Jahre 1963 ihren Durchbruch. Es war eine Zeit, in der die Impulse des ‚Bitterfelder Weges’ noch unmittelbaren Einfluss auf die Literatur in der DDR ausübten. Die Erzählung, welche zunächst als Fortsetzungsroman in einer Frauenzeitschrift veröffentlicht wurde, erscheint als Buch im Jahre 1963 durch Herausgabe des Mitteldeutschen Verlages. Es fand eine unbeschreiblich positive Resonanz, so dass die Autorin mit ihrem Ehemann Gerhard Wolf im Jahre 1964 das Drehbuch für die gleichnamige DEFA-Verfilmung schrieben. Der Film, welcher unter der Regie von Konrad Wolf gedreht wurde, fand ebenso wie das Buch ein großes Publikum. Beides wurde in der DDR zu mehr als einem Bestseller gekrönt.
Es ist eine Geschichte, die von der siebzehnjährigen Frau Rita Seidel und dem jungen Mann Manfred Herrfurth handelt. Die Erzählung ereignet sich in Ostdeutschland, beginnt etwa sechs Monate vor dem Mauerbau und endet kurz danach. Sie beginnt mit der merkwürdigen Begegnung des Landmädchens Rita und dem in der Stadt wohnenden Manfred bei einem Tanz. Später zieht Rita nach Leipzig zu Manfred, wo er auch arbeitet, um dort ein Studium als Lehrerin aufzunehmen. Während ihres Studiums arbeitet sie in einem Waggonwerk, da ihr anempfohlen ist, als Lehrerin auch praktische Berufserfahrungen mitzubringen. Manfred, der in einer zerstrittenen Familie aufwächst, arbeitet als Chemiker. Er verliert den Glauben an das sozialistische Wirtschaftssystem, nachdem Wirtschaftsfunktionäre der DDR ein von ihm kreiertes Entwicklungsprojekt abgelehnt haben. Aus diesem Grund flüchtet er in den Westen. Rita möchte ihn besuchen und reist ihm deshalb nach. Manfred möchte im Westen bleiben, wo Rita sich jedoch fremd fühlt; deshalb trennen sich ihre Wege. Kurz darauf wird die Mauer gebaut. Rita erleidet einen Unfall und fällt ins Koma, aus dem sie später im Krankenhaus erwacht. Aus dem Sanatorium erzählt sie auch die ganze Geschichte mit Manfred und ihrem Leben in der Stadt.
Die wichtigsten Motive dieser Erzählung sind die deutsche Teilung, das Leben in der DDR, der Kontrast zwischen BRD und DDR und der Mauerbau. Im Jahre 1961 spitzte sich die Krise der SED-Herrschaft immer mehr zu, der Strom der Flüchtlinge gen Westen schwoll immer mehr an, immer mehr Menschen verließen die DDR. Zuletzt waren es mehr als zehntausend Menschen in einem Monat, welche – vor allem über die offene Grenze in Berlin – in die Bundesrepublik Deutschland flüchteten. Die DDR-Regierung griff zum letzten Mittel: Sie schloss am 13. August 1961 die Sektorengrenze in Berlin und ließ alle Verbindungen zwischen West- und Ostberlin schlagartig unterbrechen. Nun durchzog Berlin eine Mauer, quer durch Deutschland verlief ein Todesstreifen, eine hermetische Grenze. Walter Ulbricht hatte sein Volk nunmehr eingemauert. Zwei Jahre später, im Jahre 1963, erschien die Erzählung „Der geteilte Himmel“ von der damals noch jungen und weitestgehend unbekannten Autorin Christa Wolf.
Das Buch „Der geteilte Himmel“ ist die allegorische Darstellung der Krise des SED-Systems und ihrer Überwindung durch die Kraft der Jugend; sie ist das exemplarische, künstlerische Dokument über die politische und gesellschaftliche Atmosphäre der DDR zu Anfang der sechziger Jahre, hauptsächlich über die geistige Haltung der jungen sozialistischen Intelligenz, über die Hoffnungen und Selbsttäuschungen, die sie mit dem Mauerbau verband. Damit ist die nachgelieferte Rechtfertigung des Mauerbaues als Akt der Abwehr gegen eine Aggression aus dem Westen verknüpft, ein ideologischer Anbau mit einer schönen Aussicht auf die neue DDR. Diese Sicht ergibt sich aus der Umdeutung der Einschließung des eigenen Volkes zur Voraussetzung für einen nunmehr ungestört möglichen Aufbau des Sozialismus.
Auf der Handlungsebene erzählt das Buch die Entwicklungsgeschichte der siebzehnjährigen Frau namens Rita und der plötzliche und unerwartete Wechsel ihrer Weltbezüge, welche aus der vorgezeichneten und ruhigen Bahn eines Lebens an der Peripherie des Weltgeschehens ins Zentrum der historischen Bewegungen gerät, nämlich in das Zentrum der Trinität von Geschichte, Leben und Partei. Die formalen Konstruktionsmerkmale des literarischen Werkes Christa Wolfs sind Rahmenhandlung und Retrospektive. Die Rahmenhandlung umfasst den Zeitraum von August 1961 bis Oktober 1961; es ist die Zeit des Aufenthaltes der Heldin im Sanatorium, die Zeit vom Kollaps bis zur Genesung. Die retrospektiv behandelte Zeit umfasst die Phase von August 1959 bis August 1961. Dabei ist zu beachten, dass die Rahmenhandlung nur einen Vorwand darstellt, bei dem sich der Erzähler nicht an die Binnenperspektive der Personen bindet, welche er als Ich-Erzählungen einfügt, vielmehr erzählt er aus der Außenperspektive eines allwissenden Erzählers, welche eine mit dem Anspruch auf eine objektive Weltdeutung verknüpfte Erzählhaltung darstellt. Krise und Krankheit der Heldin dienen als Haltung für das als Erinnerung konzipierte Erzählverfahren. Die Erzählung setzt nach Ritas Kollaps ein, das heißt nach dem Tod des alten Subjektes, auf dessen Vorgeschichte sie sich zurückwendet, um am Ende als Ergebnis der Erinnerung die Geburt eines neuen Subjektes zeigen zu können. Diese Vorgeschichte ist als ein sozialistischer Bildungsweg gestaltet, seine Hauptstationen sind Hochschule und Betrieb.
Im Zentrum der Zeitgeschichte dieses Werkes steht die Systemkrise der SED-Herrschaft in den Jahren 1958 bis 1961; sie zwingt die SED zur Reaktion. Die bekannte Antwort besteht zunächst im Mauerbau. Weiter versucht die SED, durch eine Änderung ihrer Wirtschaftspolitik, mit dem so genannten „Neuen Ökonomischen System der Planung und Leitung“ sowie dem Versuch der Entwicklung neuer Technologien, eine spürbare Produktionssteigerung und damit den Anschluss an das Weltniveau zu erreichen. Die SED reagiert auch im Bereich Kulturpolitik, vor allem aber im Bereich Jugendpolitik wird sie aktiv, denn sie nimmt den Kampf um die Seele der Jugend auf, indem sie die rigiden Fesseln etwas lockert und der Jugend gewisse Mitsprachemöglichkeiten einräumt. Die so genannten „Reformen“ sind vielmehr Modifikationen an den bestehenden Mechanismen der SED-Macht und dienen ausschließlich dem Ziel, die Stabilität der Macht zu erhöhen beziehungsweise die verfassungsrechtliche und soziale Monopolmacht der SED zu festigen und zu sichern, was auch heißt, die innere Zustimmung der Menschen zu ihr zu erhöhen, die jedoch fehlt. Daher schlägt das Buch verschiedene Strategien ein. Ein auffälliges Beispiel ist das Wort ‚Frieden’. Seine Bedeutungsvielfalt wird eingeschränkt und als identisch mit ‚Sozialismus’ gleichgesetzt, denn nur in dieser Verknüpfung soll von Frieden sinnvoll gesprochen werden können. Umgekehrt verfährt Christa Wolf mit dem Wort ‚Westen’, das in eine Reihe gestellt wird mit Kapitalismus, Imperialismus und Faschismus. Am Ende dieser Reihe steht dann das Wort ‚Krieg’. Daraus ergibt sich die semantische Gleichung: Sozialismus gleich Frieden, Kapitalismus gleich Krieg. Die andere Seite des Problems, gemeint ist die Bedrohung des Systems von innen durch die Fluchtbewegung und die ökonomische Krise, die Abwendung von der neuen Gesellschaft durch massenhafte Abwanderung in den Westen und Stagnation in der Produktion, spielt das Werk dagegen in seiner Bedrohlichkeit herunter.
Das Problem an der Abwanderung in den Westen zeigt Christa Wolf an der Figur des Chemikers Manfred Herrfurth. Diese Figur ist gekennzeichnet durch übersteigerten Egoismus und Ehrgeiz. Zudem ist sie schon Klassenfeind durch Herkunft, da sein Vater bekanntlich auch in den Westen „abgehauen“ ist. In der Figur Herrfurths entwirft die Erzählung ein Bild des inneren Feindes. Dieser innere Feind ist für viele Missstände in der Gesellschaft und in der Produktion mitverantwortlich, er ist nicht nur objektiver Agent des Imperialismus, vielmehr ist er auch Fall der Psychopathologie. Aus der Perspektive dieser Konstruktion erscheint die reale Schwächung des Sozialismus durch die Massenabwanderung umgekehrt als die symbolische Stärkung, denn wenn erst der innere Feind als Agent des äußeren Feindes aus dem Land eliminiert worden ist, dann kann endlich ohne seine Sabotage der Aufbau des Sozialismus vorangehen. Weiter ist der Chemiker die Kontrastfigur der Heldin, denn er hat die DDR und seine Geliebte verlassen, weil er einen übersteigerten Egoismus besitzt, seine berufliche und wissenschaftliche Karriere bedeutet ihm mehr als die gesellschaftliche Verantwortung in der Ganzheit und auch mehr als die Liebe. Er ist nach Westberlin gegangen, um skrupellos als Angestellter jener Chemiekonzerne, die seinerzeit schon durch Auschwitz profitierten, seine skrupellosen Forschungen weiter zu betreiben. Ein defizitärer Charakter erscheint so als Komplement einer reaktionären politischen Gesinnung.
Die Figur Rita repräsentiert in dem Buch das Modell einer gelingenden Politisierung, das heißt die Einsicht in die Dominanz des Politischen über das Private. In dieser Figur wird zudem ein Modell des künftigen Führungspersonals entworfen. Politische, fachliche und kommunikative Kompetenz sind jene von der Autorin herausgestellten Eigenschaften, über die der neue Leistungstypus verfügen muss. Da die Heldin eine Frau ist, verfügt sie noch über eine natürliche Qualität; sie hat Einfühlungsvermögen, Herz und Wärme. Durch die Ausstattung mit diesen traditionellen Attributen der Weiblichkeit erhält die Heldin eine weitere Kompetenz zugesprochen, nämlich soziale Kompetenz im Sinne einer weitreichenden integrativen Wirkung. Damit vereinigt die Heldin idealtypisch jene Anforderungen, welche die Zeit des so genannten ‚Neuen Sozialismus’ an einen politischen Helden stellt. Sie gewinnt die Fähigkeit zur Entscheidung für den Sozialismus allerdings nicht aus nachvollziehbaren Gründen, sondern aus der Tiefe eines höheren Lebenssinns. Die Maxime ihres Handelns ist daher nicht verallgemeinerungsfähig, gleichwohl soll ihre Entscheidung als allgemeines Handlungsgesetz für die Daheimgebliebenen gelten. Dieser Widerspruch führt zu einem weiteren Widerspruch der in Christa Wolfs Erzählung vertretenen Sozialismusvorstellung. Er besteht darin, aus den Bedingungen der Unfreiheit, nämlich der Einschließung des Volkes hinter der Mauer, eine Gesellschaft des Freien schaffen zu wollen. Alle heutigen Hinweise auf Reformen im Zuge einer neuen SED-Politik nach dem Mauerbau können bestenfalls graduelle Abstufungen innerhalb eines steinernen Gehäuses der Hörigkeit, nämlich des Machtmonopols der SED angeben.
Zu bemerken ist ferner, dass sich Christa Wolf wohl selbst in Ritas Rolle sieht, da das Werk „Der geteilte Himmel“ sehr viele autobiographische Elemente trägt. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass Christa Wolf selbst einst als Schreibkraft tätig war und ebenso in einer Waggonfabrik gearbeitet hat. Ferner musste sie sich ebenso wie die Heldin der Erzählung einem längeren Krankenhausaufenthalt unterziehen.
Im Jahre 1963 wurde Christa Wolf durch die Akademie der Künste mit dem Heinrich-Mann-Preis geehrt. Die Erzählung galt als sozialistische Nationalliteratur, von der „eine Bejahung neuer Art“[16] ausging, so begründete die Akademie die Preisverleihung. Die Festansprache zur Preisverleihung hielt Alfred Kurella, der „die künstlerische Erfassung wichtiger Seiten des sozialistischen Lebensgefühls“ lobte.[17] Jörg Magenau schreibt in Christa Wolfs Biographie, dass die Verleihung dieses Preises der einzige Moment in Christa Wolfs Leben bis zum Jahre 1989 war, wo der später erhobene Vorwurf, sie sei eine ‚Staatsdichterin’, jemals eine Berechtigung hätte.[18] Das Buch erregte derartig öffentliches Interesse, dass eine heftige Diskussion unter Literaturkritikern entbrannte. Günter Wirth rezensierte die Erzählung in der Berliner ‚Neuen Zeit’ vom 04.04.1963. Er betonte, dass beide Protagonisten „im Verlauf der Handlung den typischen Entwicklungsgang ihrer Klassen illustrierten“.[19] Auch in den anderen Zeitungsrezensionen war der Einfluss literaturkritischer Maßstäbe der fünfziger Jahre, der sich in den formal-dogmatischen Forderungen nach Optimismus, Allgemeinverständlichkeit und einem positiven Helden äußert, unverkennbar.[20] Eduard Zak schrieb einen kritischen Beitrag zu diesem Buch im ‚Sonntag’ vom 19.05.1963 und bewertet die Erzählung fast als vorbildlich in jeder Hinsicht. In der Protagonistin Rita sieht er eine positive Heldin, die ein neues, sozialistisches Menschenbild darstellt.[21] Dieter Alert und Hubert Weltzelt stellten ihren Standpunkt in der ‚Freiheit’ am 31.08.1963 dar. Sie brachten in ihrem Beitrag vor allem ihre Zweifel an der ideologischen Anschauung der Autorin zum Ausdruck. Sie schien ihnen keine überzeugte Sozialistin zu sein und damit kann sie „die verändernde Kraft der (DDR-) Gesellschaft nicht an den Leser vermitteln“.[22] Die halleschen Literaturkritiker vermissten in der Erzählung auch die positive Rolle der Partei. Die von der SED-Bezirkszeitung Halle ‚Freiheit’ veröffentlichten Betrachtungen stießen aber auf allgemeines Unverständnis. Ausführlich beschäftigte sich beispielsweise Professor Dr. Hans Koch, seinerzeit erster Sekretär des Deutschen Schriftsteller-Verbandes der DDR, mit den Argumenten der Freiheit-Autoren und kam zu dem Schluss, „dass wir mit einer derartigen Charakterisierung eines wichtigen Buches, das ein Mitglied unseres Vorstandes schrieb, keinesfalls einverstanden sind“.[23] Durch einen offenen Brief vom Zirkel schreibender Autoren in Ammendorf an die Redaktion der Zeitung ‚Freiheit’ erfuhr Christa Wolf Unterstützung zu ihrem Werk. Sie schrieben: „Wir finden (in der Erzählung) das Leben in unserem Betrieb ungeschminkt wieder“. Der einzige geäußerte Einwand bestand darin, dass die Autorin die in ihrem Werk geschilderten Tatsachen realitätsnaher hätte darstellen können. Nach dem Heinrich-Mann-Preis wurde Christa Wolf der Nationalpreis III. Klasse verliehen, den die Autorin selbst aber als „belastend“ empfand.[24]
Auch im Westen wurde man in dieser Zeit auf die junge DDR-Autorin aufmerksam, die sich trotz des Mauerbaus zu den Idealen des Sozialismus bekennt und den ‚Bitterfelder Weg’ befürwortet. Christa Wolfs Erzählung lenkte in der BRD als erstes Buch einer DDR-Autorin größeres öffentliches Interesse auf sich. „Zahlreiche Kritiker westdeutscher Zeitungen lasen die Erzählung als programmatisches Beispiel für die Emanzipation der DDR-Autoren von den starren Prinzipien des Sozialistischen Realismus“.[25] Die meisten Kritiker gingen aber über den rein ideologischen Bereich nicht hinaus und fokussierten daher das Werk nur vereinzelt unter literarischen Gesichtspunkten. Hans-Georg Soldat schrieb im Tagesspiegel, dass in der Erzählung ein deutliches Abkommen von „Schwarzweißmalerei“ bei der Darstellung der sozialistischen Realität zu bemerken sei. Die Schilderung der drüben herrschenden differenzierten Verhältnisse sieht er in realistischen den Alltag präziser darstellenden „Grautönen“ gezeichnet.[26] Andererseits gab es aber auch Kritiken, welche die veränderte Schreibweise bei Christa Wolf nur als „eine kunstvolle Strategie Ideologie in Literatur umzusetzen, deuteten“.[27] Walter Osten, ein weiterer bundesdeutscher Kritiker, bewertete es als eine zweckgebundene ‚Mauer-Literatur’, obwohl seiner Meinung nach ein leichtes Abkommen vom allgemeingültigen sozialistischen Realismusschema zu bemerken sei. Eine sehr zutreffende Würdigung des Buches erfasste im Jahre 1964 Hans Bunge: „Die Tatsache, dass ein solches Buch in der DDR wegen seiner Tendenz ausgezeichnet und gleichzeitig angegriffen wird, ist nicht nur für die Literatur oder die Kritik bedeutsam: sie markiert vor allem einen politischen Drehpunkt“. Er sah in der Schriftstellerin viel Potential und meinte, dass sie eine Autorin sei, die ein besseres Klima für die Literatur in der DDR schaffen könnte.[28]
[...]
[1] Löffler, Sigrid; Ich will authentisch erzählen. Ein Zeit-Gespräch zum 70. Geburtstag von Christa Wolf; In: Die Zeit; 18.03.1999; S. 31
[2] Ausführliche Analysen und Materialien sind in den folgenden Werken zu finden: Deiritz, Karl / Krauss, Hannes; Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder „Freunde, es spricht sich schlecht mit gebundener Zunge“; Hamburg; 1991 / Wittek, Bernd; Der Literaturstreit im sich vereinigenden Deutschland; Marburg; 1997 / Schmidt, Karl-Wilhelm; Was bleibt und die „Christa-Wolf-Debatte“; In: Praxis Deutsch; 1995; S. 45 ff. / Anz, Thomas; „Es geht nicht um Christa Wolf“. Der Literaturstreit im vereinigten Deutschland; Frankfurt am Main; 1995
[3] Vinke, Hermann; Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspiegel und Dialog. Eine Dokumentation; Hamburg; 1993 (Christa Wolf wurde auch der Mitarbeit in den Jahren 1959 bis 1962 beschuldigt. Sie hat bestätigt, dass sie von Stasi-Leuten wegen Kooperation angesprochen wurde und ohne ihr Wissen den Decknamen „Margarete“ erhielt, jedoch nie aktiv gewirkt hat.)
[4] Greiner, Ulrich; Mangel an Feingefühl; In: Die Zeit; 08.06.1990; S. 13
[5] Schirmmacher, Frank; Dem Druck des härteren, strengeren Lebens standhalten; In: Frankfurter Allgemeine Zeitung; 02.06.1990
[6] Schreiben im Zeitbezug. Gespräch mit Aafke Steenhuis; In: Wolf, Christa; Im Dialog. Aktuelle Texte; Frankfurt am Main; 1990; S. 148
[7] Jens, Walter; Plädoyer gegen die Preisgabe der DDR-Kultur. Fünf Forderungen an die Intellektuellen im geeinten Deutschland; Rede in Potsdam am 11.06.1990; In: Süddeutsche Zeitung; 16. / 17.06.1990
[8] Jörg Magenau: Christa Wolf, Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003, S. 24 f.
[9] Ebda, S. 26
[10] Ebda, S. 31
[11] www.informatik.hu-berlin.de/~thalheim/dokumente/wolf/christa-wolf.html
[12] Jörg Magenau: Christa Wolf, Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg 2003, S.54
[13] Ebda, S.58
[14] http://www.bildung.hessen.de/mversuch/tv-weiser/wolf_himmel/wolf_himmel_bio.htm
[15] Kommentar aus dem Internet zu Kassandra. Vier Vorlesungen. Eine Erzählung. Berlin, DDR, Weimar: Aufbau, 1983.
[16] von Ankum, Katharina: Die Rezeption von Christa Wolf in Ost und West. Von ‚Moskauer Novelle’ bis ‚Selbstversuch’. Amsterdam - Atlanta 1992. S. 64
[17] Ebda; S. 65
[18] Magenau, Jörg: Christa Wolf, Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg 2003. S.137
[19] von Ankum, Katharina: Die Rezeption von Christa Wolf in Ost und West. Von ‚Moskauer Novelle’ bis ‚Selbstversuch’. Amsterdam - Atlanta 1992.; S. 65
[20] Ebda; S. 65
[21] Ebda; S. 66
[22] Ebda, S.69
[23] Ebda; S. 67
[24] Magenau, Jörg: Christa Wolf, Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg 2003. S. 142
[25] von Ankom; 1992; S. 81
[26] Ebda S. 81
[27] Ebda; S. 81
[28] Magenau; S. 142
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832488376
- ISBN (Paperback)
- 9783838688374
- DOI
- 10.3239/9783832488376
- Dateigröße
- 685 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Moderne Sprachen und Literatur, Filologii Germanskiej
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Juni)
- Note
- 1,6
- Schlagworte
- staatsdichterin frauenliteratur kassandra stasi deutsche literatur
- Produktsicherheit
- Diplom.de