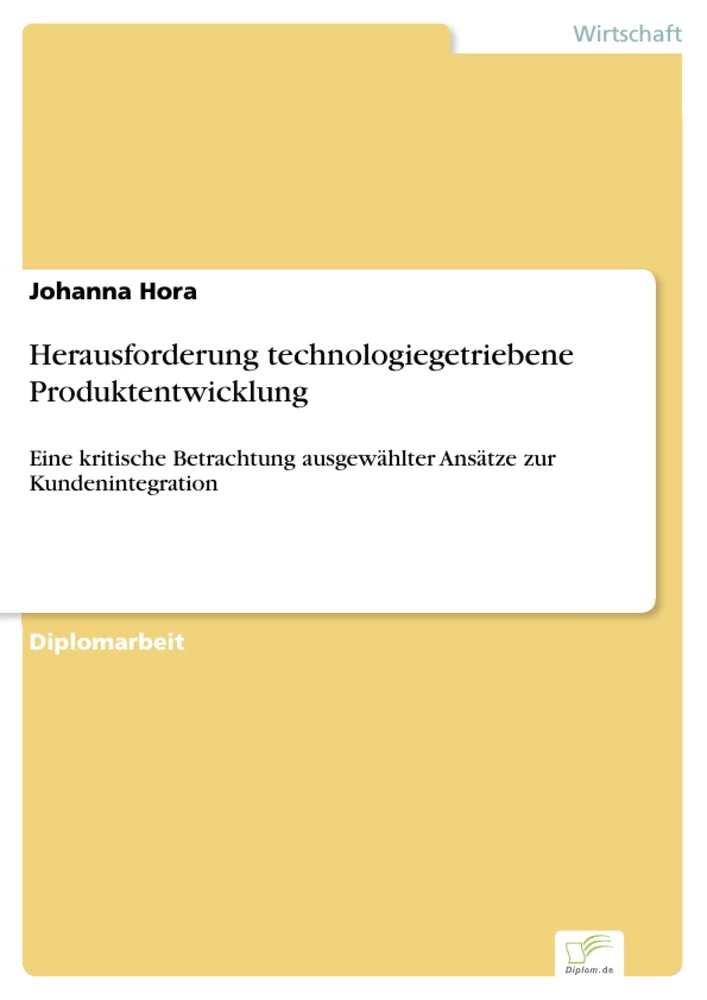Herausforderung technologiegetriebene Produktentwicklung
Eine kritische Betrachtung ausgewählter Ansätze zur Kundenintegration
©2005
Diplomarbeit
91 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
In Zeiten eines verschärften Wettbewerbes, einer zunehmenden Marktsättigung und eines Machtzuwachses auf Kundenseite gewinnt die Orientierung am Kunden zunehmend an Bedeutung. Eine wichtige Aufgabe des Unternehmens besteht folglich darin, die angebotenen Produkte an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Durch eine Erfüllung bzw. Übererfüllung dieser Bedürfnisse wird es dem Unternehmen möglich, zunächst Zufriedenheit und später Loyalität auf Seiten der Kunden aufzubauen. Die Kundenloyalität stellt einen zentralen Treiber des Unternehmenserfolges dar und beeinflusst somit die Zukunft des Unternehmens.
Entsprechend dieser Zusammenhänge ist es von großer Bedeutung, die Kunden möglichst früh in den Prozess der Produktentwicklung zu integrieren. Besteht für ein geplantes Produkt noch kein Markt, gestaltet sich dieses Unterfangen jedoch schwierig. Eine derartige Situation kann im Rahmen eines technology push auftreten.
Ein technology push umfasst die Entwicklung innovativer Problemlösungen auf Basis neuer naturwissenschaftlicher bzw. technologischer Erkenntnisse. Unternehmen sehen sich in diesem Kontext drei zentralen Herausforderungen gegenübergestellt. Erstens fällt es den Kunden schwer, Anforderungen an durch die neuen Technologien möglich werdende Produkte zu bilden. Sie sind in ihrer real world experience gefangen. Zweitens zeigt sich die vollständige und verständliche Artikulation der Anforderungen an neue Produkte problematisch. Es besteht sticky information auf Kundenseite. Drittens muss beachtet werden, dass die tatsächlich geäußerten Anforderungen auch korrekt identifiziert und in die Produktentwicklung integriert werden.
Die üblichen Methoden der Produktentwicklung und Marktforschung sind für die Bewältigung dieser Herausforderungen nur von begrenztem Nutzen. Quantitative Marktforschungsuntersuchungen etwa sind klassischerweise darauf ausgelegt, repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Da der Markt für das geplante Produkt jedoch noch nicht existent ist, gilt es repräsentative Aussagen über eine zukünftige Grundgesamtheit zu treffen. Dies stellt eine schwer erfüllbare Aufgabe dar. Wird den Untersuchungen der heutige Kundenstamm zu Grunde gelegt, können zumeist nur inkrementelle Innovationen erzielt werden. Folglich bedarf es geeigneterer Methoden zur Bewältigung der Herausforderungen technologiegetriebener Produktentwicklung.
Als viel versprechend stellt sich hierbei das trial and error learning […]
In Zeiten eines verschärften Wettbewerbes, einer zunehmenden Marktsättigung und eines Machtzuwachses auf Kundenseite gewinnt die Orientierung am Kunden zunehmend an Bedeutung. Eine wichtige Aufgabe des Unternehmens besteht folglich darin, die angebotenen Produkte an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Durch eine Erfüllung bzw. Übererfüllung dieser Bedürfnisse wird es dem Unternehmen möglich, zunächst Zufriedenheit und später Loyalität auf Seiten der Kunden aufzubauen. Die Kundenloyalität stellt einen zentralen Treiber des Unternehmenserfolges dar und beeinflusst somit die Zukunft des Unternehmens.
Entsprechend dieser Zusammenhänge ist es von großer Bedeutung, die Kunden möglichst früh in den Prozess der Produktentwicklung zu integrieren. Besteht für ein geplantes Produkt noch kein Markt, gestaltet sich dieses Unterfangen jedoch schwierig. Eine derartige Situation kann im Rahmen eines technology push auftreten.
Ein technology push umfasst die Entwicklung innovativer Problemlösungen auf Basis neuer naturwissenschaftlicher bzw. technologischer Erkenntnisse. Unternehmen sehen sich in diesem Kontext drei zentralen Herausforderungen gegenübergestellt. Erstens fällt es den Kunden schwer, Anforderungen an durch die neuen Technologien möglich werdende Produkte zu bilden. Sie sind in ihrer real world experience gefangen. Zweitens zeigt sich die vollständige und verständliche Artikulation der Anforderungen an neue Produkte problematisch. Es besteht sticky information auf Kundenseite. Drittens muss beachtet werden, dass die tatsächlich geäußerten Anforderungen auch korrekt identifiziert und in die Produktentwicklung integriert werden.
Die üblichen Methoden der Produktentwicklung und Marktforschung sind für die Bewältigung dieser Herausforderungen nur von begrenztem Nutzen. Quantitative Marktforschungsuntersuchungen etwa sind klassischerweise darauf ausgelegt, repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Da der Markt für das geplante Produkt jedoch noch nicht existent ist, gilt es repräsentative Aussagen über eine zukünftige Grundgesamtheit zu treffen. Dies stellt eine schwer erfüllbare Aufgabe dar. Wird den Untersuchungen der heutige Kundenstamm zu Grunde gelegt, können zumeist nur inkrementelle Innovationen erzielt werden. Folglich bedarf es geeigneterer Methoden zur Bewältigung der Herausforderungen technologiegetriebener Produktentwicklung.
Als viel versprechend stellt sich hierbei das trial and error learning […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8729
Fingerle, Johanna: Herausforderung technologiegetriebene Produktentwicklung -
Eine kritische Betrachtung ausgewählter Ansätze zur Kundenintegration
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Ludwig-Maximilians-Universität München, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
I
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis...I
Abbildungsverzeichnis...III
Anhangsverzeichnis ... IV
Abkürzungsverzeichnis... V
1 Einleitung ...1
1.1 Problemstellung...1
1.2 Vorgehensweise ...4
2 Bedeutung der Integration von Kunden in den Produktentwicklungs-
prozess ...5
2.1 Charakteristika von Kunden des Konsumgüterbereichs und Kunden
des Investitionsgüterbereichs ...5
2.2 Chancen der Kundenintegration in den Produktentwicklungsprozess ...7
2.3 Risiken der Kundenintegration in den Produktentwicklungsprozess...9
2.4 Produktentwicklungsprozess ...11
3 Technologiegetriebene Produktentwicklung ...13
3.1 Grenzen klassischer Marktforschungsmethoden...13
3.2 Zentrale Herausforderungen technologiegetriebener Produkt-
entwicklung...15
3.2.1 ,,Real world experience" der Kunden ...15
3.2.2 ,,Sticky needs" der Kunden...18
3.3 Bewältigung der Herausforderungen technologiegetriebener
Produktentwicklung durch Experimentieren ...20
3.3.1 Grundlagen des Experimentierens ...20
3.3.2 Iteratives Grundmodell des Experimentierens nach Thomke...23
3.3.3 Überblick über die Methoden des Experimentierens ...26
II
3.3.4 Kriterien zur Bewertung der Methoden des
Experimentierens...29
4 Rapid Prototyping als Methode des Experimentierens...31
4.1 Grundlagen des Rapid Prototyping...32
4.2 Prozess des Rapid Prototyping ...34
4.2.1 Erweiterung der ,,real world experience" ...34
4.2.2 Abgreifen von ,,sticky user needs"...35
4.2.3 Analyse der aufgedeckten Kundenbedürfnisse...37
4.3 Kritische Würdigung ...41
5 Toolkits als Methode des Experimentierens ...44
5.1 Grundlagen der Toolkits ...45
5.2 Zentrale Anforderungen an Toolkits ...47
5.3 Entwicklung von Toolkits ...48
5.4 Kritische Würdigung ...50
6 Lead User als Methode des Experimentierens ...53
6.1 Charakteristika von Lead Usern ...53
6.2 Vorgehensweise der Lead User Methode ...54
6.3 Kritische Würdigung ...58
7 Schlussbetrachtung ...62
7.1 Zusammenfassung ...62
7.2 Ausblick ...64
Anhang ...65
Literaturverzeichnis... VI
III
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1: Iteratives Grundmodell des Experimentierens nach Thomke...24
Abb. 2: Kriterien zur Bewertung der Methoden des Experimentierens...30
Abb. 3: Der Rapid Prototyping Prozess...34
Abb. 4: Kundenanforderungen im Kano-Modell der Kundenzufriedenheit ...39
IV
ANHANGSVERZEICHNIS
Anhang 1: Zentrale Studien zu dem Zusammenhang von Erfahrungen und
Problemlösungsverhalten... 65
Anhang 2: Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung... 68
Anhang 3: Vorgehensweise des Empathic Design... 70
Anhang 4: Vorgehensweise der ZMET... 72
Anhang 5: Kano-Auswertungstabelle... 74
V
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
CDTM =
Center
for
Digital
Technology and Management
CS-coefficient = Customer Satisfaction Coefficient
DBW =
Die
Betriebswirtschaft
Marketing ZfP = Marketing Zeitschrift für Forschung und Praxis
ZfB
= Zeitschrift für Betriebswirtschaft
Zfbf =
Schmalenbachs
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche
Forschung
ZMET =
Zaltman
Metaphor
Elicitation Technique
1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
In Zeiten eines verschärften Wettbewerbes, einer zunehmenden Marktsättigung
und eines Machtzuwachses auf Kundenseite gewinnt die Orientierung am
Kunden zunehmend an Bedeutung. Eine wichtige Aufgabe des Unternehmens
besteht folglich darin, die angebotenen Produkte
1
an den Bedürfnissen der
Kunden auszurichten. Durch eine Erfüllung bzw. Übererfüllung dieser Bedürf-
nisse wird es dem Unternehmen möglich, zunächst Zufriedenheit und später
Loyalität auf Seiten der Kunden aufzubauen. Die Kundenloyalität stellt einen
zentralen Treiber des Unternehmenserfolges dar und beeinflusst somit die
Zukunft des Unternehmens.
Entsprechend dieser Zusammenhänge ist es von großer Bedeutung, die
Kunden möglichst früh in den Prozess der Produktentwicklung zu integrieren.
Besteht für ein geplantes Produkt noch kein Markt, gestaltet sich dieses Unter-
fangen jedoch schwierig.
2
Eine derartige Situation kann im Rahmen eines
,,technology push"
auftreten.
3
Ein ,,technology push" umfasst die Entwicklung
innovativer Problemlösungen auf Basis neuer naturwissenschaftlicher bzw.
technologischer Erkenntnisse.
4
Unternehmen sehen sich in diesem Kontext drei
zentralen Herausforderungen gegenübergestellt. Erstens fällt es den Kunden
schwer, Anforderungen an durch die neuen Technologien möglich werdende
Produkte zu bilden. Sie sind in ihrer ,,real world experience" gefangen.
5
Zweitens zeigt sich die vollständige und verständliche Artikulation der
1
Da sich eine klare Trennung von Produkt und Dienstleistung zunehmend schwierig gestal-
tet, vgl. hierzu bspw. Kotler/Bliemel (1999), S. 670, wird im Rahmen dieser Arbeit davon
abgesehen, eine explizite Unterscheidung zu treffen.
2
Vgl. Lüthje (2000), S. 1.
3
Auf einem ,,technology push" basieren bspw. Produkte im Bereich von Lasern, Kernkraft-
werkstechnik und Kunststofftechnologie, vgl. Geschka (1988), S. 24. Zu detaillierteren Aus-
führungen zu einem ,,technology push" vgl. Pfeiffer (1971), S. 97ff.
4
Im Allgemeinen weisen entsprechende Entwicklungsaufgaben eine hohe Komplexität, Neu-
igkeit und Variabilität sowie eine geringe Strukturiertheit auf, vgl. Picot et al. (1988), S. 120.
5
Vgl. Leonard/Rayport (1997), S. 103; vgl. Hippel, v. (1988), S. 102f.
2
Anforderungen an neue Produkte problematisch.
6
Es besteht ,,sticky
information" auf Kundenseite.
7
Drittens muss beachtet werden, dass die tat-
sächlich geäußerten Anforderungen auch korrekt identifiziert und in die
Produktentwicklung integriert werden.
8
Die üblichen Methoden der Produktentwicklung und Marktforschung sind für die
Bewältigung dieser Herausforderungen nur von begrenztem Nutzen. Quantitati-
ve Marktforschungsuntersuchungen etwa sind klassischerweise darauf ausge-
legt, repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Da der Markt für das geplante Pro-
dukt jedoch noch nicht existent ist, gilt es repräsentative Aussagen über eine
zukünftige Grundgesamtheit zu treffen. Dies stellt eine schwer erfüllbare Aufga-
be dar. Wird den Untersuchungen der heutige Kundenstamm zu Grunde gelegt,
können zumeist nur inkrementelle Innovationen erzielt werden.
9
Folglich bedarf
es geeigneterer Methoden zur Bewältigung der Herausforderungen technolo-
giegetriebener Produktentwicklung.
Als viel versprechend stellt sich hierbei das ,,trial and error learning" bzw. das
Experimentieren dar. Das Experimentieren kann als iterativer Prozess, aus den
Schritten ,,Design", ,,Build", ,,Run" und ,,Analyze", betrachtet werden.
10
Im Zuge
des Experimentierens wird es möglich, zu einem frühen Zeitpunkt im Entwick-
lungsprozess, wichtige Informationen über Funktionalität und Herstellbarkeit
des neuen Produktes zu erhalten. Zudem wird deutlich, inwieweit das Produkt
den Kundenanforderungen gerecht wird.
11
Entwicklungskosten sowie Entwick-
lungszeit können verringert werden.
12
Das Experimentieren ist als abstrakte
Vorgehensweise zu verstehen. Eine Umsetzung erfolgt im Zuge konkreter Me-
thoden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden drei Methoden beleuchtet.
6
Der Neuigkeitsgrad, der durch die Technologien möglich werdenden Produkte, bestimmt
sich im Kontext der vorliegenden Arbeit aus der Wahrnehmung des Kunden. Es handelt
sich um eine kognitive Neuheit, vgl. Specht (1979), S. 47.
7
Vgl. Hippel, v. (1994), S. 430ff.
8
Vgl. Möller et al. (2003), S. 313; vgl. Lüthje (2000), S. 314.
9
Vgl. Lüthje (2000), S. 21f.
10
Vgl. Thomke (1998), S. 744f.
11
Vgl. Thomke/Bell (2001), S. 310.
12
Vgl. Thomke (1998), S. 743.
3
Die erste Methode stellt das Rapid Prototyping dar. ,,Rapid prototyping is used
by developers to quickly generate an inexpensive, easy to modify (and often
physical) prototype that can be tested against the actual use environment and
allows ,,real" experimentation."
13
Bedeutend ist hierbei, dass dem Kunden die
Möglichkeit gegeben wird, im Rahmen der Nutzung von Prototypen, konkrete
Erfahrungen zu sammeln, die dabei helfen, seine ,,real world experience" zu
erweitern. Zudem wird durch den zusätzlichen Einsatz von speziellen Markt-
forschungsmethoden ein ,,semantic space" geschaffen, innerhalb dessen der
Kunde leichter seine ,,sticky needs" artikulieren kann.
14
Die zweite Methode zur Überwindung der Herausforderungen technologie-
getriebener Produktentwicklung stellt der Einsatz von Toolkits dar. ,,Toolkits for
user innovation is an emerging alternative approach in which manufacturers
actually abandon the attempt to understand user needs in detail in favor of
transferring need-related aspects of product and service development to
users."
15
Indem den Kunden von Seiten des Unternehmens die technischen
Möglichkeiten zur Umsetzung innovativer Ideen bereitgestellt werden, kann der
Entwicklungsprozess zu großen Teilen auf Kundenseite stattfinden. Eine Über-
tragung der ,,sticky user information" ist nicht mehr nötig, die Schnittstellen zwi-
schen Unternehmen und Kunden können reduziert werden.
16
Die dritte Methode besteht in dem Lead User Ansatz. Lead User zeichnen sich
nach von Hippel
17
durch zwei zentrale Eigenschaften aus. Zum einen haben
Lead User bereits heute Bedürfnisse, welche die Masse der Anwender erst in
Zukunft verspüren wird. Lead User können demnach bei der Prognose künftiger
Bedürfnisse von großer Hilfe sein. Zum anderen profitieren Lead User stark von
der Entwicklung neuer Produkte. So haben viele bereits Prototypen entwickelt.
Eine Umsetzung der Bedürfnisse in konkrete Produktanforderungen ist dem-
nach teilweise schon erfolgt.
13
Thomke (1998), S. 747.
14
Vgl. Möller et al. (2003), S. 314.
15
Hippel, v./Katz (2002), S. 821.
16
Vgl. ebenda, S. 823f.
17
Vgl. Hippel, v. (1988), S. 107.
4
Zentrale Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit ist, die Herausforderungen
technologiegetriebener Produktentwicklung, insbesondere die begrenzte ,,real
world experience" der Kunden und die ,,stickiness" von Kundenanforderungen,
zu beleuchten. Des Weiteren gilt es, das Experimentieren und dessen konkrete
Ausgestaltungen als Lösungsansatz vorzustellen und deren Eignung zur Über-
windung der dargestellten Herausforderungen zu bewerten.
Folgende Fragen sind dabei von besonderem Interesse:
- Wie äußert sich die Gefangenheit in der ,,real world experience" und worin
liegen die Ursachen dieser Gebundenheit an das Vertraute? Wodurch zeich-
net sich ,,sticky information" aus?
- Wie gestaltet sich das ,,trial and error learning" und welche prinzipiellen Mög-
lichkeiten zur Überwindung der Herausforderungen technologiegetriebener
Produktentwicklung sind ihm inhärent? Welche konkreten Methoden sind mit
dem Experimentieren verbunden?
- Sind die dargestellten Methoden des Experimentierens vorteilhaft? Welche
Risiken bzw. Nachteile bestehen?
1.2 Vorgehensweise
Das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit dient der Darlegung von Problemstel-
lung und Vorgehensweise.
Im zweiten Kapitel wird auf die Motivation der Integration von Kunden in den
Produktentwicklungsprozess eingegangen. Hierzu gilt es zunächst eine Unter-
scheidung zwischen Kunden des Konsumgüterbereichs und des Investitions-
güterbereichs zu treffen. Es erweist sich als sinnvoll, für den weiteren Verlauf
der Arbeit eine Fokussierung auf den Konsumgüterbereich vorzunehmen.
Weiter werden zentrale Chancen und Risiken der Kundenintegration für Herstel-
ler und Kunden dargestellt. Es folgt ein kurzer Einblick in die typische Gestal-
tung des Produktentwicklungsprozesses.
Das dritte Kapitel widmet sich der technologiegetriebenen Produktentwicklung.
Die zentralen Herausforderungen dieser Vorgehensweise werden dargelegt und
das Experimentieren, als Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen, vor-
gestellt. Es folgt ein Überblick über drei zentrale Methoden des Experimentie-
rens. Abschließend werden Bewertungskriterien, die der kritischen Bewertung
der einzelnen Methoden dienen, erarbeitet.
5
In den Kapiteln vier, fünf und sechs werden die ausgewählten Methoden des
Experimentierens Rapid Prototyping, Toolkits und Lead User näher be-
leuchtet. Zudem erfolgt eine kritische Betrachtung des jeweiligen Beitrags zur
Überwindung der Herausforderungen technologiegetriebener Produktentwick-
lung.
Die Arbeit endet in Kapitel sieben mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse
sowie einem Ausblick.
2 Bedeutung der Integration von Kunden in den Produkt-
entwicklungsprozess
Im Zuge verschärften Wettbewerbes und zunehmender Macht auf Kundenseite,
nimmt die Bedeutung der Kundenorientierung stetig zu. Für die Zukunftsfähig-
keit eines Unternehmens ist es daher zentral, die angebotenen Produkte an den
Anforderungen und Erwartungen der Kunden auszurichten. Um dies realisieren
zu können, bietet es sich an, Kunden möglichst frühzeitig in den Produkt-
entwicklungsprozess zu integrieren.
Im Rahmen des vorliegenden Kapitels werden zunächst Kunden des Konsum-
güterbereichs von Kunden des Investitionsgüterbereichs abgegrenzt (2.1).
Weiter werden die im Allgemeinen mit der Integration von Kunden in den Pro-
duktentwicklungsprozess verbundenen Chancen (2.2) und Risiken (2.3) erör-
tert. Abschließend erfolgt eine kurze Auseinandersetzung mit der typischen
Gestaltung eines Entwicklungsprozesses (2.4).
2.1 Charakteristika von Kunden des Konsumgüterbereichs und Kunden
des Investitionsgüterbereichs
Eine Diskussion der Kundenintegration in den Produktentwicklungsprozess er-
fordert eine separate Betrachtung von Kunden des Investitionsgüterbereichs
und Kunden des Konsumgüterbereichs.
18
Generell kann davon ausgegangen
werden, dass Kunden des Konsumgüterbereichs über ein geringeres Exper-
tenwissen als Kunden des Investitionsgüterbereichs verfügen. Dies lässt
sich anhand der notwendigen Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an
18
Eine Unterscheidung von Konsum- und Investitionsgüterbereich soll im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit anhand der Zielgruppe, d.h. organisationale vs. private Nachfrager, erfolgen,
vgl. Backhaus (1995), S. 7f.; vgl. Lüthje (2000), S. 31.
6
unterschiedlichsten Konsumproblemen begründen. Den von Kunden des
Investitionsgüterbereichs gelieferten Informationen kann demnach eine größere
Bedeutung beigemessen werden. Des Weiteren zeichnen sich Kunden des
Investitionsgüterbereichs durch eine höhere Motivation zur Teilnahme an der
Produktentwicklung aus.
19
Kunden des Konsumgüterbereichs hingegen verste-
hen ihre Rolle eher als passiv.
20
Der Konsumgüterbereich ist durch einen zumeist indirekten Kontakt von Her-
steller und Kunde gekennzeichnet. Der Einsatz von Absatzmittlern erschwert
es, Informationen zu Anforderungen und Erwartungen der Kunden zu erlangen.
Bedürfnisse von Seiten der Kunden werden häufig nicht erfasst bzw. nicht an
den Hersteller weitergegeben, da der Handel eigene Interessen verfolgt. Die
Identifikation von Kundenbedürfnissen im Investitionsgüterbereich gestaltet sich
hingegen einfacher. Der Investitionsgüterbereich ist durch den Direktvertrieb
geprägt, es herrschen langjährige und feste Beziehungen zu den Kunden vor.
Etwaige Probleme können direkt von dem Kunden erfragt bzw. von diesem an
den Hersteller weitergegeben werden.
21
Der dargestellten Priorisierung von Kunden des Investitionsgüterbereichs zur
Integration in den Produktentwicklungsprozess entgegen, soll im Rahmen der
vorliegenden Arbeit eine Fokussierung auf Kunden des Konsumgüterbereichs
erfolgen. Dies beruht auf der Annahme, dass sich eher Kunden des Konsum-
güterbereichs als Kunden des Investitionsgüterbereichs den Herausforderungen
technologiegetriebener Produktentwicklung gegenüber sehen. Diese Vermu-
tung wird zum einen durch die bereits erwähnte Auseinandersetzung mit einer
Vielzahl an unterschiedlichen Konsumproblemen gestützt. Eine Konzentration
des Kunden auf die Lösung eines oder weniger Probleme ist kaum möglich,
eine Erweiterung der ,,real world experience" bezüglich der wahrgenommenen
Probleme bleibt ihm weitestgehend verwährt. Zum anderen basiert die dar-
gestellte Annahme auf einem im Konsumgüterbereich vorherrschenden hohen
19
Vgl. Czerwonka et al. (1976), S. 162; vgl. Hansen (1982), S. 35; vgl. Hansen/Raabe (1991),
S. 172; vgl. Kirchmann (1994), S. 81; vgl. Schuh (1991), S. 10.
20
Vgl. Czerwonka et al. (1976), S. 147.
21
Vgl. Geschka (1988), S. 28.
7
Anteil emotionaler Anforderungen.
22
Diese Anforderungen sind häufig durch
eine gewisse ,,stickiness" geprägt, eine Artikulation fällt schwer.
2.2 Chancen der Kundenintegration in den Produktentwicklungsprozess
Chancen der Beteiligung von Kunden an der Entwicklung einer Problemlösung
bestehen sowohl auf Kunden- als auch auf Herstellerseite. Diese Potenziale gilt
es zu erfassen und auszuschöpfen.
23
Hierzu ist eine, der jeweiligen Situation
entsprechende, optimale Gestaltung der Kundenintegration notwendig. Stell-
schrauben hierfür stellen u.a. Zeitpunkt, Art und Intensität der Integration,
Fähigkeit und Bereitschaft der Kunden, die passenden Informationen zu liefern
sowie Art und Ausmaß der Information, die auf Kundenseite notwendig sind,
dar.
24
Chancen auf Kundenseite
Eine Beteiligung an der Produktentwicklung ist für den Kunden durch eine Viel-
zahl an hiermit verbundenen Chancen motiviert. Zentralen Beweggrund der Be-
teiligung stellt die Lösung wahrgenommener Anwendungsprobleme dar. Dem
Kunden ist es zumeist nicht möglich, im Rahmen seiner eigenen Ressourcen,
adäquate Lösungen zu schaffen. Es erweist sich demnach als notwendig, mit
einem Hersteller zu interagieren. Im Zuge dieser Zusammenarbeit kann der
Kunde sowohl für ihn bedeutende Produkteigenschaften durchsetzen, als auch
für ihn unnötige kostenaufwändige Produkteigenschaften vermeiden.
25
Des
Weiteren besteht für den Kunden die Möglichkeit, an Wissen zu gewinnen. An
dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass der Hersteller eher über technologie-
bezogene, der Kunde hingegen vielmehr über nutzungsbezogene Informationen
verfügt.
26
Im Rahmen dieser Situation ,,(...) ist ein beidseitiger Lernprozeß
erforderlich, bei dem die beiden Parteien ihre Informationsdefizite ausgleichen
22
Vgl. Geschka (1988), S. 28.
23
Vgl. Leonard-Barton (1995), S. 94.
24
Vgl. Campbell/Cooper (1999), S. 509; vgl. Gruner (1997), S. V; vgl. Leonard-Barton (1995),
S. 95.
25
Vgl. Kirchmann (1994), S. 33.
26
Vgl. Gemünden (1980), S. 27; vgl. Gemünden (1981), S. 30f.
8
und ihrem Gegenüber das jeweils fehlende Wissen vermitteln".
27
Folglich wird
dem Kunden relevantes technologiebezogenes Wissen von Seiten des Herstel-
lers zur Verfügung gestellt. Zudem entsteht im Rahmen der Zusammenarbeit
neues Wissen.
28
Weiter zeigt sich eine frühzeitige Auseinandersetzung des
Kunden mit der neuen Problemlösung als positiv. Es können früh Erfahrungen
gesammelt und potenzielle Nutzungsmöglichkeiten durchdacht werden. Dies
liefert eindeutige Vorteile bei Handhabung und Instandhaltung des neuen Pro-
duktes.
Darüber hinaus ist eine Partizipation des Kunden am Entwicklungspro-
zess mit finanziellen Anreizen verbunden. Zum einen besteht die Option einer
finanziellen Entschädigung des Kunden für seine Anstrengungen. Zum anderen
können durch den Einsatz der neuartigen Problemlösung Kosteneinsparungen
realisiert werden.
29
Außerdem kann der Kunde von einer geringeren Anzahl an
Fehlentwicklungen profitieren. Die bei einer Fehlentwicklung entstandenen
Kosten werden üblicherweise auf die Verkaufspreise weiterer Produkte im
Portfolio des Herstellers umgelegt. Dies kann durch die Integration von Kunden
und die damit verbundene verbesserte Erfüllung von Anforderungen verhindert
werden.
30
Chancen auf Herstellerseite
Die Integration von Kunden in die Produktentwicklung ist auch auf Hersteller-
seite durch mehrere Faktoren motiviert.
Hersteller sehen sich heutzutage hohen Forschungs- und Entwicklungsausga-
ben sowie großen Risiken möglicher Fehlentwicklungen gegenübergestellt.
31
Die Zusammenarbeit mit Kunden soll diese Risiken vermindern.
32
Dies ist mög-
lich, indem der Hersteller Zugang zu relevanten nutzungsbezogenen Informa-
tionen des Kunden erlangt bzw. neues Wissen im Rahmen der Zusammen-
arbeit entsteht. Der Wissenszugewinn stellt demnach auch auf Herstellerseite
27
Gemünden (1981), S. 31; vgl. Gemünden (1980), S. 27.
28
Vgl. Kirchmann (1994), S. 33.
29
Vgl. ebenda, S. 35f.
30
Vgl. Hansen/Raabe (1988), S. 3.
31
Vgl. Crawford (1977), S. 51; vgl. Gruner (1997), S. VIII; vgl. Trommsdorff (1991), S. 179.
32
Vgl. Hansen/Raabe (1988), S. 4; vgl. Kirchmann (1994), S.33.
9
eine bedeutende Motivation dar. Durch die frühzeitige Integration des Kunden
und dessen Wissen in die Produktentwicklung kann eine gesteigerte Akzeptanz
der erzielten Ergebnisse von Kundenseite bewirkt werden.
33
Die Wahrschein-
lichkeit, ein Produkt am Zielmarkt vorbeizuentwickeln, sinkt. Kostspielige und
zeitaufwändige nachträgliche Anpassungen des Produktes an Kundenanforde-
rungen können vermieden werden.
34
Zusätzlich kann durch die Integration von
Kunden in den Entwicklungsprozess die Effektivität des Prozesses an sich
gesteigert und damit auch ein schnelleres ,,time to market" realisiert werden.
35
Wie implizit bereits angedeutet, besteht die zentrale Motivation der Kunden-
integration durch den Hersteller in der Steigerung der Kundenzufriedenheit.
Diese positive Wirkung resultiert zum einen aus der Wertschätzung, die dem
Kunden durch die Integration von Seiten des Herstellers entgegengebracht
wird. Zum anderen wird es durch den Zugang zu nutzungsbezogenen Informa-
tionen leichter möglich, bestehende Erwartungen an die neue Problemlösung
von Kundenseite zu erfüllen bzw. überzuerfüllen. Basierend auf einer hohen
Kundenzufriedenheit entstehen zunehmend Loyalität und Vertrauen bei den
Kunden. Langfristig gesehen hat dies positive Auswirkungen auf Umsatz, Ge-
winn, Rendite und Unternehmenswert. Dies liegt u.a. in gesicherten künftigen
Cash Flows, sinkenden Transaktionskosten und einer geringeren Preiselastizi-
tät auf Kundenseite begründet. Des Weiteren steigern sich Einkaufsvolumen
und -häufigkeit, es besteht ein Cross-Selling Potenzial. Folglich gilt es festzu-
halten, dass durch die frühzeitige Integration von Kunden in den Entwicklungs-
prozess Kundenzufriedenheit generiert werden kann, die langfristig gesehen
einen entscheidenden Beitrag zum Überleben des Unternehmens leistet.
36
2.3 Risiken der Kundenintegration in den Produktentwicklungsprozess
Generell kann davon ausgegangen werden, dass die Risiken einer Kunden-
integration in die Produktentwicklung als eher gering einzustufen sind. Darüber
hinaus üben die Nachteile keinen negativen Einfluss auf den Erfolg eines neuen
33
Vgl. Hansen/Raabe (1991), S. 173; vgl. Leonard-Barton (1995), S. 92; vgl. Schuh (1991),
S.6.
34
Vgl. Campbell/Cooper (1999), S. 509; vgl. Hansen (1982), S. 30; vgl. Schuh (1991), S. 6f.
35
Vgl. Campbell/Cooper (1999), S. 508.
36
Vgl. Heskett et al. (1994), S. 164ff.; vgl. Matzler/Hinterhuber (1998), S. 26.
10
Produktes aus.
37
Dementsprechend kann angenommen werden, dass die
Chancen einer Kundenintegration die Nachteile dieser überwiegen.
Risiken auf Kundenseite
Die mit einer Integration von Kunden in die Produktentwicklung verbundenen
Nachteile beziehen sich u.a. auf den hohen Zeitaufwand, der beispielsweise mit
der Erarbeitung und Präsentation von Vorschlägen für neue Produkte
verbunden ist. Für den geleisteten Einsatz erfolgt unter Umständen kein finan-
zieller Ausgleich.
38
Des Weiteren sieht sich der an der Produktentwicklung be-
teiligte Kunde einem Trittbrettfahrerproblem gegenübergestellt, da weitere
Kunden von seinen Beiträgen zur Lösungsgestaltung profitieren, ihn dafür
jedoch nicht belohnen.
39
Risiken auf Herstellerseite
Generell besteht im Rahmen der Kundenintegration die Gefahr, vorwiegend
inkrementelle Innovationen hervorzubringen, die lediglich mit einem geringen
und kurzfristigen Erfolgspotenzial verbunden sind. ,,Beim Verwender existieren
Barrieren, so daß man ein Festhalten am Status quo vorzieht oder nur kleinere
Innovationsschritte wagt."
40
Darüber hinaus können Zielkonflikte zwischen tech-
nologiebezogenen Anforderungen des Herstellers und nutzungsbezogenen
Anforderungen des Kunden auftreten.
41
Zudem ist Konfliktpotenzial im ,,Not
Invented Here"-Syndrom zu sehen. Daneben ist ein Abfluss von schützenswer-
ten Informationen an die Konkurrenz denkbar.
42
Ein weiteres Risiko stellt die
Verteilung von Rechten an geistigem Eigentum dar. Der Hersteller muss sich
eventuell dazu verpflichten, Lizenzgebühren, Beteiligungen am Innovations-
gewinn oder entsprechende Abfindungen an den Kunden zu entrichten. Hierzu
bedarf es allerdings eines neuartigen und eigenständigen Beitrags des Kunden
37
Vgl. Gruner (1997), S. 67.
38
Vgl. Leonard-Barton (1995), S. 96f.
39
Vgl. Hansen (1982), S. 35.
40
Gemünden (1981), S. 31.
41
Vgl. Kirchmann (1994), S. 28.
42
Vgl. ebenda, S. 29f.; vgl. Schuh (1991), S. 10.
11
zur Produktentwicklung.
43
Zusätzlich kann es zu einer Vernachlässigung des
unternehmensinternen nutzungsbezogenen Wissensaufbaus und damit zu einer
gewissen Abhängigkeit vom Kunden kommen.
44
Für den Hersteller ist es essen-
tiell, sich dem Kunden gegenüber aufgeschlossen zu zeigen, um die Beziehung
zu diesem nicht zu gefährden. Die im Rahmen der Zusammenarbeit gewonne-
nen Informationen sollten für den Markt im Allgemeinen einsetzbar sein.
45
2.4 Produktentwicklungsprozess
Nachdem in der vorangegangenen Darstellung ausführlich auf die Bedeutung
der Kundenintegration in die Produktentwicklung eingegangen wurde, soll nun
eine Auseinandersetzung mit dem Produktentwicklungsprozess an sich erfol-
gen. Generell kann davon ausgegangen werden, dass Aufbau und Ablauf des
Produktentwicklungsprozesses in Abhängigkeit zu der jeweiligen Branche ste-
hen. Eine Differenzierung ist vor allem in Hinblick auf die Konsum- und
Investitionsgüterbranche sinnvoll. Ursache hierfür sind unterschiedliche Stück-
zahlen, Fertigungstechniken und Kundenanforderungen.
46
In der Literatur finden sich eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen über
den Aufbau eines Produktentwicklungsprozesses wieder.
47
Die Anzahl an
Prozessphasen ist dabei von der unterschiedlich starken Ausgestaltung einzel-
ner Aktivitäten abhängig. Eine geeignete Darstellung des Produktionsprozesses
sollte zum einen eine klare Abgrenzung verschiedener Aktivitäten ermöglich,
zum anderen jedoch auch Übersichtlichkeit bewahren.
48
43
Vgl. Hansen/Raabe (1988), S. 16f.
44
Vgl. Campbell/Cooper (1999), S. 509; vgl. Kirchmann (1994), S. 30f.
45
Vgl. Hansen (1982), S. 35; vgl. Leonard-Barton (1995), S. 96.
46
Vgl. Geuer (1996), S. 6.
47
Vgl. Connell/Shafer (1989), S. 73; vgl. Geuer (1996), S. 9ff.; vgl. Gruner (1997), S. 65f.; vgl.
Hansen (1982), S. 27; vgl. Hansen/Raabe (1991), S. 184; vgl. Hippel, v. (1988), S. 25; vgl.
Schlicksupp (1999), S. 14; vgl. Urban/Hauser (1993), S. 38.
48
Vgl. Gruner (1997), S. 63f.
12
Exemplarisch soll im Folgenden das sechsstufige Phasenmodell nach Gruner
49
betrachtet werden.
Phase 1: Produktideenfindung
50
, -bewertung, -auswahl
Phase 2: Produktkonzepterstellung, -bewertung, -auswahl
Phase 3: Produkt-, Projektdefinition: Festlegung der notwendigen Aufgaben;
Überführung der Wünsche und Vorstellungen in technische Anfor-
derungen
Phase 4: Konstruktionsentwurfserstellung, -bewertung, -auswahl: technische
Problemlösung von Phase 3
Phase 5: Prototyperstellung, -bewertung, -auswahl
Phase 6: Markteinführung
Die Integration von Kunden kann prinzipiell in jeder der genannten Phasen er-
folgen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Kunden über die für die Partizipation
notwendigen Fähigkeiten verfügen. So bedarf es beispielsweise für die Erstel-
lung von Konstruktionsentwürfen naturwissenschaftliches und technisches Wis-
sen sowie Expertenwissen in Bezug auf die entsprechende Produktgruppe.
51
,,Der Beitrag des Anwenders zur Problemlösung in einer Innovationsphase kann
von einem unpräzisen Hinweis bis hin zu einer detailliert ausgearbeiteten
Lösungsmöglichkeit reichen. Dazwischen liegt ein Kontinuum von unterschied-
lich präzisierten Beiträgen zur Problemlösung."
52
Prinzipiell ist die Unterstützung
durch den Kunden gerade in den ersten beiden Phasen ,,Idee" und ,,Konzept"
von hoher Relevanz. Dem Kunden wird es möglich, bedeutsame nutzungs-
bezogene Informationen in den Entwicklungsprozess einzubringen.
53
Der klassische, marktgetriebene Produktentwicklungsprozess ist stark analyse-
lastig. So werden in den frühen Phasen u.a. Konzepttest, Fokusgruppe,
49
Vgl. Gruner (1997), S. 65f.
50
Zu einer ausführlichen Darstellung von Methoden zur Ideenfindung vgl. Schlicksupp (1999).
51
Vgl. Kirchmann (1994), S. 90.
52
Ebenda, S. 80.
53
Vgl. ebenda, S. 101; vgl. Kleef, v. et al. (2005), S. 181.
13
Conjoint-Analyse, Quality Function Deployment
54
und Delphi-Methode einge-
setzt. Ergebnis des klassischen Produktentwicklungsprozesses sind vorwie-
gend kontinuierliche inkrementelle Innovationen, die die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens gewährleisten. Es ist von zentraler Bedeutung, von Anfang
an das richtige Konzept zu verfolgen. Im Gegensatz hierzu steht der technolo-
giegetriebene Produktentwicklungsprozess. Aufgrund der höheren Unsicherheit
in Bezug auf Technologie, Markt und Timing sind die dargestellten Analyse-
instrumente wenig zielführend (siehe 3.1). Sinnvoller ist ein experimentelles
Vorgehen im Sinne eines ,,trial and error learnings" (siehe 3.3.2).
55
3 Technologiegetriebene Produktentwicklung
Wie bereits dargestellt, wird im Rahmen einer marktgetriebenen Produktent-
wicklung zumeist auf klassische Marktforschungsmethoden zurückgegriffen.
Treten neue Technologien auf, stoßen diese Methoden jedoch sehr bald an ihre
Grenzen (3.1). Den Kunden ist es häufig nicht möglich, sich Anforderungen an
auf den neuen Technologien basierende Produkte bewusst zu machen. Des
Weiteren bestehen Schwierigkeiten, etwaige Vorstellungen für den Hersteller
vollständig und verständlich zu formulieren (3.2). Eine Integration des Kunden
auf Basis klassischer Marktforschungsmethoden ist nicht mehr zielführend. Es
müssen neue Möglichkeiten gefunden werden, Kundenanforderungen korrekt
zu identifizieren und umzusetzen. Einen viel versprechenden Ansatz stellt hier-
bei das Experimentieren dar (3.3).
3.1 Grenzen klassischer Marktforschungsmethoden
Im Rahmen einer nachfrageinduzierten Produktentwicklung werden zumeist
klassische Marktforschungsmethoden eingesetzt, um die bereits im Markt be-
stehenden Anforderungen und Erwartungen aufzugreifen.
56
Die Initiative zu
Veränderungen geht dabei vom Hersteller und nicht vom Kunden aus.
57
Die
Methoden sind quantitativ ausgerichtet und erheben den Anspruch, für die
54
Vgl. zu Quality Function Deployment Akao (1992) und Griffin/Hauser (1993).
55
Vgl. Lynn et al. (1996), S. 27.
56
Vgl. Hansen/Raabe (1991), S. 172; vgl. Hippel, v./Sonnack (1999), S. 2.
57
Vgl. Hansen (1982), S. 29; vgl. Lender (1991), S. 82f.; vgl. Lindhoff/Ölander (1982), S. 170;
vgl. Schuh (1991), S. 8.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832487294
- ISBN (Paperback)
- 9783838687292
- DOI
- 10.3239/9783832487294
- Dateigröße
- 562 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Betriebswirtschaftslehre, Information, Organisation und Management
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Mai)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- lead user toolkits rapid prototyping
- Produktsicherheit
- Diplom.de