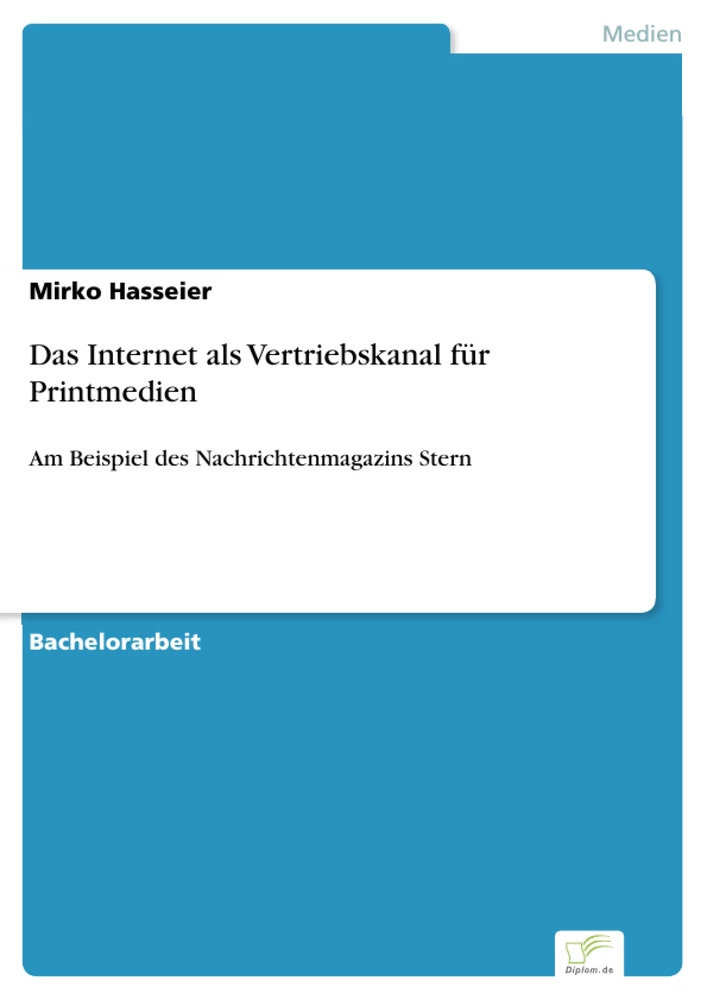Das Internet als Vertriebskanal für Printmedien
Am Beispiel des Nachrichtenmagazins Stern
Zusammenfassung
In den Anfangsjahren des Internets gab es bei Verlagen in Deutschland die Befürchtung, dass der Online-Vertriebsweg die klassischen Vertriebswege kannibalisieren würde. Mittlerweile hat sich der Online-Vertrieb neben den klassischen Vertriebswegen etabliert und ist zu einer festen und eigenständigen Größe herangewachsen. Besonders in Bezug auf die Neukundengewinnung durch Abonnements.
Die Abonnementauflage bildet innerhalb der Gesamtauflage von Zeitschriftenverlagen eine stabile und kalkulierbare Größe. Daher ist es wichtig, Kunden zu gewinnen und für einen längeren Zeitraum an das Unternehmen zu binden. Aus der Kundenbindung ergeben sich für Zeitschriftenverlage Potenziale, die aus Wiederkäufen, Cross-Selling und positiver Mund-zu-Mund-Werbung resultieren.
Zeitschriftenverlage in Deutschland setzen verstärkt auf das Medium Online zur Neukundengewinnung, da das Internet über Eigenschaften verfügt, die die klassischen Offline-Medien nicht besitzen. Über das Internet lassen sich neue Zielgruppen gewinnen und auch regionale Märkte wie die neuen Bundesländer erschließen. Dabei sind rechtliche Vorschriften einzuhalten, außerdem muss darauf geachtet werden, dass auf den Nutzer zugeschnittene Zahlungsformen angeboten werden.
Bei den Werbemitteln ist zu konstatieren, dass diese um ein Vielfaches kostengünstiger sind als Werbeformen aus den Offline-Medien. Der Werbeerfolg im Internet ist messbar, im Speziellen durch Online-basierte Abrechnungsmodelle. Zusätzlich findet im Internet ein Imagetransfer statt, der unabhängig von den so genannten Klicks erzielt wird.
Zeitschriftenverlage, die sich in Zukunft durch Erfolg im Internet auszeichnen wollen, müssen sich der Innovationsgeschwindigkeit im Internet anpassen. Innovationen mit einschneidender Tragweite treten in kürzeren und zunehmend diskontinuierlichen Abständen auf.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbstractII
Abstract in deutscher SpracheII
Abstract in englischer SpracheIII
AbbildungsverzeichnisIV
InhaltsverzeichnisV
1.Einleitung1
1.1Zielstellung1
1.2Aufbau der Arbeit1
2.Medienunternehmen2
2.1Vorbemerkungen zu Medienunternehmen2
2.2Zeitschriftenverlage3
2.2.1Typologie der Zeitschriftenverlage3
2.2.2Fachzeitschriften3
2.2.3Publikumszeitschriften3
2.2.4Wertschöpfungskette der Zeitschriftenverlage4
2.2.5Erlösformen von Zeitschriftenverlagen5
2.3Internetunternehmen7
2.3.1Die Entstehung des Internets7
2.3.2Typologie von […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Zielstellung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Medienunternehmen
2.1 Vorbemerkungen zu Medienunternehmen
2.2 Zeitschriftenverlage
2.2.1 Typologie der Zeitschriftenverlage
2.2.2 Fachzeitschriften
2.2.3 Publikumszeitschriften
2.2.4 Wertschöpfungskette der Zeitschriftenverlage
2.2.5 Erlösformen von Zeitschriftenverlagen
2.3 Internetunternehmen
2.3.1 Die Entstehung des Internets
2.3.2 Typologie von Internetunternehmen
2.3.3 Spezifika des Mediums Internet
2.3.4 Erlösformen für Internetunternehmen
2.4 Zeitschriftenverlage und Internetaktivitäten
3 Neukundengewinnung in Zeitschriftenverlagen
3.1 Neukundengewinnung als Bestandteil der Kundenbeziehungen
3.1.1 Der Kundenbindungsprozess
3.1.1.1 Kundenakquisitionsphase
3.1.1.2 Kundenbindungsphase
3.1.1.3 Kundenrückgewinnungsphase
3.2 Ziele der Neukundengewinnung
3.3 Produktdifferenzierung als Instrument der Neukundengewinnung
3.4 Vertriebsstrukturen der Zeitschriftenverlage
3.5 Direktmarketing als Instrument der Neukundengewinnung
4 Neukundengewinnung für Zeitschriften im Internet
4.1 Ziele der Neukundengewinnung im Internet
4.2 Online-Marketing
4.3 Zahlungsverkehr
4.4 Rechtliche Bedingungen
5 Neukundengewinnung für stern im Internet
5.1 Der Zeitschriftentitel stern
5.2 Neukundengewinnung des stern am Beispiel „Alternative Medizin“
5.2.1 Die Kampagne
5.2.2 Organisationsstruktur
5.2.3 Umsetzung
5.2.4 Ergebnis und Fazit der Kampagne
6. Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Monographien und Sammelwerke
Internet
Studien
Vorträge
1 Einleitung
1.1 Zielstellung
Die Aufgabe des Vertriebs in Zeitschriftenverlagen ist in erster Linie die Bereitstellung der Zeitschrift für den Leser. Die allein reicht jedoch nicht aus, um sich auf dem Markt zu behaupten. Deshalb ist jeder Verlag darum bemüht, neue Leser für sein Produkt zu gewinnen. Dieser Aspekt der Neukundengewinnung ist der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit, allerdings mit der Beschränkung auf den Vertriebskanal Internet.
Der Zeitschriftenmarkt ist einer der am härtesten umkämpften Medienmärkte in Deutschland. Jedes Jahr geben die Verlage mehrere Millionen Euro für die Neukundengewinnung aus, denn die Erlöse auf dem Rezipientenmarkt bilden die wirtschaftliche Grundlage des Erfolges. Es wird versucht die künftigen Leser mit Prämien und Rabatten an die Zeitschriften zu binden. Inwieweit sich das Internet dabei als attraktiver Zusatzkanal eignet, soll in dieser Arbeit erörtert werden.
Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über die Maßnahmen, die Verlage unternehmen, um Leser zu gewinnen und vertraglich zu binden. In diesem Zusammenhang werden die Möglichkeiten des Internets für eine erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie diskutiert.
1.2 Aufbau der Arbeit
Nach einer kurzen Einführung und Darlegung der Aufgabenstellung werden im zweiten Kapitel die Medienunternehmen mit besonderem Bezug auf Zeitschriftenverlage und Internetunternehmen dargestellt. Kapitel drei behandelt die Neukundengewinnung in Zeitschriftenverlagen, Kapitel vier die Neukundengewinnung im Internet. Im fünften Kapitel wird die Neukundengewinnung von Zeitschriften am Beispiel des stern über die Internetpräsenz stern.de detailliert betrachtet. Die vorliegende Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel sechs und dem Quellenverzeichnis.
2 Medienunternehmen
2.1 Vorbemerkungen zu Medienunternehmen
Medienunternehmen erzeugen, bündeln und vertreiben Informationen und Unterhaltung und nutzen dazu die Massenmedien.[1] Massenmedien sind technische Mittel, die Informationen und Güter bei räumlicher und/oder zeitlicher Trennung zwischen Kommunikationspartnern an ein voneinander getrenntes Publikum übermitteln.[2] Sie lassen sich in vier Bereiche klassifizieren: Print (Zeitungen, Zeitschriften, Buch), Rundfunk (Radio, TV), Speichermedien (Video-Kassetten, CD, DVD) und Netze (Internet).[3]
In Deutschland sind Medienunternehmen privat organisiert – mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie arbeiten gewinnorientiert.[4] Medienunternehmen schaffen durch die Verbreitung von Informationen eine gesellschafts- und demokratierelevante Öffentlichkeit und stehen aufgrund dieser besonderen Verantwortung unter der Aufsicht des Staates.[5] Wegen ihres Manipulationspotenzials hat der Gesetzgeber mit dem Artikel 5 des Grundgesetztes, der die Verpflichtung zur Meinungs- und Informationsvielfalt enthält, eine Regelung vorgegeben, die eine solche Einflussnahme unterbinden soll.[6]
Die Medien werden als „vierte Gewalt“ bezeichnet, neben der Judikative, der Exekutive und der Legislative.[7] Sie übernehmen Kritik- bzw. Kontrollfunktionen und machen Vorgänge in Verwaltung, Politik, Rechtsprechung oder anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen transparent.[8]
2.2 Zeitschriftenverlage
2.2.1 Typologie der Zeitschriftenverlage
Zeitschriftenverlage vermitteln Informationen, Texte und Bilder an ihre Kunden und bedienen sich dabei des Trägermediums Papier.[9] Die Inhalte sind von den Zeitschriftenkunden ohne zeitliche Beschränkung nutzbar. Zeitschriften lassen sich in Publikums-, Fach- und Kundenzeitschriften sowie in konfessionelle Presse, Anzeigenblätter, amtliche Blätter und kommunale Amtsblätter typologisieren.
Die zwei wichtigsten Zeitschriftenarten sind Publikums- und Fachzeitschriften. 2003 existierten auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt insgesamt 5923 Titel, von denen 2300 auf Publikumszeitschriften und 3623 auf Fachzeitschriften entfielen.[10]
2.2.2 Fachzeitschriften
Fachzeitschriften legen ihren Fokus auf die von der anvisierten Zielgruppe geforderten Inhalte, z.B. auf wissenschaftliche, technische oder wirtschaftliche Themen. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger definiert den Begriff Fachzeitschrift wie folgt: „Als Fachzeitschriften (hierzu zählen auch alle wissenschaftlichen Zeitschriften) gelten alle periodischen Druckwerke, die mit der Absicht eines zeitlich unbegrenzten Erscheinens mindestens viermal jährlich herausgegeben werden und sich in erster Linie mit beruflich relevanten Inhalten befassen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Zeitschriften unentgeltlich abgegeben werden oder nicht.“[11]
2.2.3 Publikumszeitschriften
Publikumszeitschriften wenden sich an eine breite Zielgruppe mit aktuellen Themen und allgemeinverständlichen Informationen, die einen unterhaltenden Charakter haben. Die Erscheinungsweise von Publikumszeitschriften reicht von wöchentlich über 14-täglich, monatlich oder zweimonatlich bis zu vierteljährlichen Publikationen.[12]
Eine weit verbreitete Klassifizierung von Publikumszeitschriften ist die in General- bzw. Special-Interest-Zeitschriften.
General-Interest-Zeitschriften (z.B. TV Spielfilm) sind für die breite Masse konzipiert und bieten ihren Lesern allgemein verständliche Informationen und/oder Unterhaltung.[13]
Special-Interest-Zeitschriften publizieren auch für die breite Masse, aber zu bestimmten Schwerpunkten (z.B. Schöner Wohnen) und bereiten die Themen so auf, dass sie allgemein verständlich sind.
2.2.4 Wertschöpfungskette der Zeitschriftenverlage
Die Wertschöpfungskette durchläuft verschiedene Stufen bis zum fertigen Produkt für den Endverbraucher. Die Herstellungsprozesse von Zeitschriften lassen sich wie in Abbildung 1 dargestellt in fünf Stufen unterteilen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 : Wertschöpfungskette von Zeitschriften [14]
Die Erstellung der Inhalte erfolgt in den ersten beiden Stufen der Wertschöpfungskette. Im Rahmen der journalistischen Recherchearbeiten wird Wissen gesammelt. Bezugsquellen können z.B. Autoren, Nachrichten-, Presse- und Bildagenturen, Journalisten und staatliche Einrichtungen sein. Die Redaktionsarbeit wird vom redaktionellen Konzept bestimmt, das im Wesentlichen durch die publizistische Zielsetzung geprägt ist (z.B. bezüglich politischer Ausrichtung, Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder journalistischer Qualität).[15]
In den ersten beiden Produktionsstufen werden ebenfalls Leistungen für den Werbemarkt (z.B. Printanzeigen) erbracht. Die Akquisition und Platzierung von Werbung übernehmen die Anzeigenabteilungen. Um Werbepartner zu gewinnen, treten Anzeigenabteilungen direkt an Anzeigenkunden bzw. an Werbeagenturen heran. Immaterielle Leistungen auf dem Anzeigenmarkt sind oft erklärungsbedürftig. Verkaufte Auflage[16], Reichweite[17], Verbreitung[18] und redaktionelles Umfeld sind Bestandteile der Qualität eines Werbeträgers und müssen den Werbungtreibenden oder den sie vertretenden Werbeagenturen erläutert werden.[19] Große Verlage haben aus diesem Grund einen aufwändigen Betreuungsapparat eingerichtet, der den Anzeigenkunden meist gratis zahlreiche Dienstleistungen rund um das eigentliche Produkt zur Verfügung stellt, z.B. Zielgruppenanalysen. In der dritten Stufe erfolgen das Zusammenfügen der Inhalte und der Anzeigen sowie die grafische Aufbereitung des Produktes. Die eigentliche Produktion, der Druck, ist Gegenstand der vierten Stufe. Bei großen Verlagshäusern sind Druckereien feste Bestandteile des Unternehmens.
Die fünfte Stufe umfasst den gesamten Vertrieb der fertigen Printprodukte. Der Vertrieb erfolgt über Groß- und Einzelhandel, Abonnement oder sonstige Vertriebsformen, wie beispielsweise Lesezirkel.[20]
Anhand der Wertschöpfungskette lässt sich erkennen, dass Zeitschriften Verbundprodukte sind, die aus einer Verzahnung von Einzelleistungen bestehen. Sie bieten Informations- und Unterhaltungsinhalte auf dem Lesermarkt und Werberaumleistung auf dem Werbemarkt an.[21]
2.2.5 Erlösformen von Zeitschriftenverlagen
Zeitschriftenverlage finanzieren sich hauptsächlich durch Erlöse auf dem Rezipienten- und Werbemarkt. Auf dem Werbemarkt durch den Verkauf von Werberaumleistungen in Form von Anzeigen, Beilagen, Beiklebern/ Warenproben, Beiheftern, etc. Dies ist die wichtigste Erlösquelle, hier werden 70% der Erlöse generiert.[22]
Auf dem Rezipientenmarkt erzielen Zeitschriftenverlage Erlöse durch die Mediennutzung der Rezipienten, die ein Entgelt zu entrichten haben. Hierbei ist in transaktionsabhängige und transaktionsunabhängige Mediennutzung zu unterscheiden.[23] Bei transaktionsabhängigem Entgelten zahlt ein Rezipient für die einmalige Nutzung der Zeitschrift. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Leistungsmenge und ist im Einzelhandel anzutreffen. Transaktionsunabhängige Erlöse definieren sich über die Möglichkeit der Nutzung, z.B. beim Abonnementverkauf.[24]
Die verschiedenen angebotenen Leistungen auf dem Werbe- und Rezipientenmarkt können nicht voneinander losgelöst betrachtet werden, sie bedingen sich sogar.[25] Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen Werbe- und Rezipientenmarkt. Höhere Werbeerlöse führen zu mehr Spielraum bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Zeitschriften. So können durch qualitative und attraktive Inhalte zusätzliche Zielgruppen erschlossen werden. Das wiederum führt zu höheren Erlösen auf dem Werbemarkt. Dieser Kreislauf wird als Anzeigen-Auflagen-Spirale bezeichnet.[26]
Eine weitere Erlösquelle ist der Vertrieb von Merchandising-Produkten. Zeitschriften werden mit zusätzlichen Produkten angereichert, z.B. Jahreskalendern oder Büchern.
Weitere klassische Erlösquellen sind der Rechte- und Lizenzhandel. Dabei geht es häufig um Teilrechte für geografisch eingegrenzte Ausgaben, z.B. Lizenzausgaben für bestimmte Länder.[27]
2.3 Internetunternehmen
2.3.1 Die Entstehung des Internets
Die Entstehungsgeschichte des Internets lässt sich bis ins Jahr 1969 zurückverfolgen: Ein Netzwerk mit verschiedenen Rechnerknotenpunkten zwischen Universitäten in den USA wurde gestartet.[28] In den darauf folgenden Jahren wurde es weiterentwickelt. Durchbruch und Popularität erzielte jedoch erst der multimediale Teil des Internets, das Word Wide Web (WWW). Anfänglich für eine überschaubare, klar definierbare Nutzergruppe gedacht, hat sich das Internet mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Alltagskultur vieler Menschen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen entwickelt. Maßgeblich dazu beigetragen hat die einfache und anwenderfreundliche Bedienung. Im Jahr 2004 benutzen 35,7 Millionen Menschen gelegentlich das Internet.[29]
2.3.2 Typologie von Internetunternehmen
Internetunternehmen agieren in elektronischen Netzen, in denen materielle und immaterielle Güter sowie Dienstleistungen gegen kompensatorische Leistungen ausgetauscht werden. Die Unterstützung, Abwicklung und Aufrechterhaltung von Leistungsaustauschprozessen wird in der Fachsprache Electronic Business genannt.[30]
Im Prozess des Leistungsaustausches treten verschiedene Akteure auf: Unternehmen (Business) und Konsumenten (Consumer) wie auch öffentliche Institutionen (Administration). Diese Akteure können unterschiedlich miteinander agieren. In Abbildung 2 sind die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Interaktionsmustermatrix des Electronic Business [31]
Die häufigsten anzutreffenden Formen sind Business-to-Consumer, Business-to-Business und Consumer-to-Business.[32] Nach der Studie „Kommerzielle deutsche Webseiten 2004“, die vom Bundesverband Digitaler Wirtschaft (BVDW) e.V. herausgegeben wurde, sind 33% aller deutschen Internetseiten im Business-to-Consumer-Bereich und 21% im Business-to-Business-Bereich angesiedelt.[33]
Anbieter und Empfänger sind grundsätzlich nicht fixiert, sie können innerhalb eines Leistungsaustauschprozesses variieren. Offeriert ein Unternehmen eine Leistung an Konsumenten, so ist das Unternehmen im Business-to-Consumer-Bereich tätig. Reagiert der Konsument auf das Angebot des Unternehmens, so stellt diese Variante den Consumer-to-Business-Bereich dar. Bezieht ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen eine Leistung über das Internet, so besteht eine Beziehung im Umfeld des Business-to-Business-Bereiches.
2.3.3 Spezifika des Mediums Internet
Eine Besonderheit des Internets ist die Ubiquität, der ortsungebundene Datenabruf.[34] Die zeitliche Unabhängigkeit ist eine zusätzliche Komponente, die die Attraktivität des Internets auszeichnet. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, jederzeit Angebote zu konsumieren. Zusätzlich zeichnet sich das Internet durch drei weitere Eigenschaften aus: Interaktivität, Hypermedialität und Multimedialität.[35]
Das wichtigste Merkmal von Interaktivität ist, dass im Kommunikationsprozess übertragende Inhalte sich auf Inhalte beziehen, die in vorhergegangenen Kommunikationsprozessen übertragen wurden.[36] Wird im Internet ein Artikel veröffentlicht, hat der Nutzer die Möglichkeit, per E-Mail zu reagieren.
Informationen, die Nutzer über das Internet beziehen, liegen in hypermedialer Form vor.[37] Informationseinheiten sind dabei nicht linear organisiert, sondern es besteht die Möglichkeit, die Informationseinheiten an verschiedenen Stellen abzulegen.[38] Hypermedialität hat für den Nutzer den Vorteil, dass die Informationsmengen im Internet über weiterführende Links konsumierbar sind.
Der multimediale Aspekt des Internets wird dadurch gewährleistet, dass auf den Internetseiten eine kombinierte Zusammenstellung von Text, Bild, Ton und Bewegtbildern erfolgen kann.[39] Je komplexer die Darstellung mehrerer multimedialer Effekte, desto mehr Erlebniswert kann dem Nutzer vermittelt werden.[40]
2.3.4 Erlösformen für Internetunternehmen
Bei den Erlösformen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die verschiedenen Modelle variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Sie lassen sich in direkte und indirekte sowie transaktionsabhängige und transaktionsunabhängige Erlösgenerierung einteilen.[41]
[...]
[1] Vgl. Schumann, M./ Hess, T.: Grundfragen der Medienwirtschaft. 2002. S. 43.
[2] Vgl. Gabler (Hrsg.): Wirtschaftslexikon. 2004. S. 2001.
[3] Vgl. Wirtz, B. W.: Neue Medien, Unternehmensstrategien und Wettbewerb im Medienmarkt. Eine wettbewerbstheoretische und -politische Analyse. 1994, S. 26. In: Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 21.
Anmerkung: Auf die Thematisierung der Trennung in Märkte für nicht-elektronische und elektronische Medien bzw. Printprodukte (wie Wirtz sie dargestellt hat) wurde an dieser Stelle verzichtet. Märkte für nicht-elektronische Medien sind: Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchmärkte. Märkte für elektronische Medien sind: Film-, TV-, Radio-, Musik-, Video- und Computerspiele- und Internet-/ Multimediamärkte.
[4] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 20.
[5] Vgl. Wirtz B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 20.
[6] Vgl. ebd.
[7] Vgl. ebd.
[8] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 20.
[9] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 15.
[10] Quelle: Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). Der deutsche Zeitschriftenmarkt. Online im Internet: http://www.vdz.de/pages/static/1814.aspx [Stand: 18.11.04].
[11] Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). Definition - Fachzeitschriften. Online im Internet: http://www.vdz.de/pages/static/1819.aspx [Stand: 18.11.04].
[12] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 136.
[13] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 137.
[14] Quelle: eigene Darstellung. In Anlehnung: Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 142.
[15] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 50.
[16] Die verkaufte Auflage ist die Anzahl, der an den Endverbraucher abgesetzten Exemplare einer Ausgabe (Verkauf und Abonnement). Vgl.: Schumann, M./ Hess, T.: Grundfragen der Medienwirtschaft. 2002. S. 43.
[17] Die Reichweite einer Zeitschrift ist die Anzahl der Leser, die eine Zeitschrift lesen (im Allgemeinen deutlich höher als die verkaufte Auflage). Vgl.: ebd.
[18] Unter Verbreitung wird die relative oder absolute Absatzmenge in verschiedenen geografischen Regionen verstanden. Vgl.: ebd.
[19] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 51.
[20] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 141.
[21] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 142.
[22] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 61.
[23] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 143.
[24] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 61.
[25] Vgl. Schumann, M./ Hess, T.: Grundfragen der Medienwirtschaft. 2002. S. 78.
[26] Vgl. ebd.
[27] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 143.
[28] Vgl. Heinzmann, P.: Internet – Die Kommunikationsplattform des 21. Jahrhunderts. 2001. In: Handbuch Electronic Commerce. 2002 S.46.
[29] Das sind 55,3% aller Deutschen ab 14 Jahren. Quelle: ARD/ ZDF Online Studie 2004. In: Media Perspektiven 08/2004. Online im Internet: http://www.daserste.de/service/ardonl04.pdf. S.351 [Stand: 13.12.04]
[30] Vgl. Wirtz, B. W.: Electronic Commerce. 2001. S. 34.
[31] Quelle: eigene Darstellung. In Anlehnung an: Wirtz, B. W.: Electronic Commerce. 2001. S. 35.
[32] Vgl. ebd.
[33] Vgl. Bundesverband Digitale Wirtschaft: Kommerzielle deutsche Webseiten 2004. Online im Internet: http://www.bvdw.org/shared/data/pdf/kommerzielle_Webseiten_04.pdf. S. 5. [Stand: 10.12.04].
[34] Vgl. Wirtz, B. W.: Electronic Commerce. 2001. S. 470.
[35] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 72.
[36] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 73.
[37] Vgl. ebd. S. 75.
[38] Vgl. Henkel, C.: Das Internet als Herausforderung für Verlage. 2000. S. 75.
Anmerkung: Seiten sind in diesem Fall miteinander über Links verbunden.
[39] Vgl. Wirtz, B. W.: Electronic Commerce. 2001. S. 470.
[40] Anmerkung: Dies kann jedoch mit der Arbeitsleistung des Computers konfrontieren.
[41] Vgl. Wirtz, B. W.: Medien- und Internetmanagement. 2003. S. 585f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832486525
- ISBN (Paperback)
- 9783838686523
- DOI
- 10.3239/9783832486525
- Dateigröße
- 388 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin – Wirtschaftswissenschaften II
- Erscheinungsdatum
- 2005 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- medien zeitschriften internet vertrieb neukundengewinnung
- Produktsicherheit
- Diplom.de