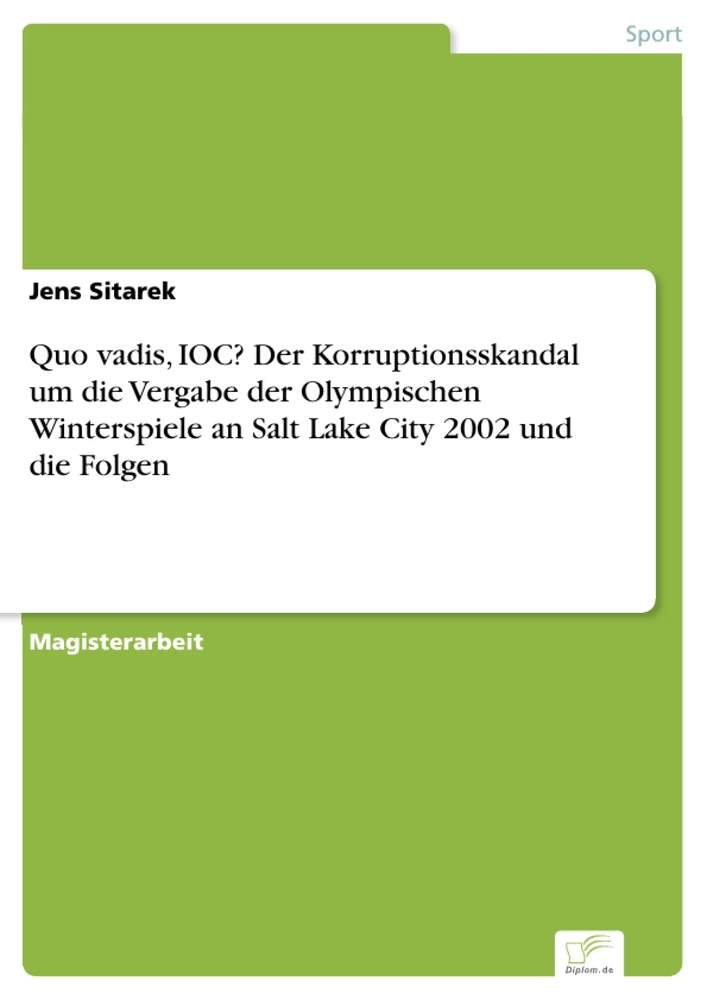Quo vadis, IOC? Der Korruptionsskandal um die Vergabe der Olympischen Winterspiele an Salt Lake City 2002 und die Folgen
©2004
Magisterarbeit
155 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Olympischen Spiele haben sich nach ihrer Wiederbegründung 1894 zum größten Sportereignis der Welt entwickelt. Zu verdanken haben wir dieses Sportspektakel dem Franzosen Pierre de Coubertin, der die Idee vom friedlichen Zusammentreffen aller Völker und Rassen hatte. Die Olympischen Spiele haben Symbolcharakter und stehen für positive Werte. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), das sich um das Zustandekommen der Spiele kümmert, steht seit dem Skandal von Salt Lake City auch für andere Ideale wie zum Beispiel Korruption und Bestechlichkeit ein. Diese Magisterarbeit beschäftigt sich mit dem IOC-Korruptionsskandal um die Vergabe der Olympischen Winterspiele an Salt Lake City 2002. Worum geht es dabei überhaupt? Mitglieder des IOC haben mit Verantwortungsträgern eines Bewerbungskomitees um eine Olympia-Ausrichtung gedealt. Hierbei ist das Jahr 1995 von entscheidender Bedeutung, da damals die Spiele vergeben wurden. Der Skandal um die Olympiastadt hat das IOC in seinen Grundfesten erschüttert und in die größte Glaubwürdigkeitskrise seiner über 100-jährigen Tradition gestürzt. Die Wahl wurde durch Bestechung vorangetrieben. Jahrelang herrschten sie wie die Götter über die olympische Bewegung. Und immer umgab die Mitglieder des IOC der Geruch von Vetternwirtschaft und Korruption. Jetzt liegen erstmals Beweise vor (ROSENAU). In dem Bemühen die Winterspiele 2002 nach Salt Lake City zu holen, wurden die Grenzen des Statthaften weit überschritten.
Seit dem Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe Ende 1998 sind mehr als fünfeinhalb Jahre vergangen. Grund genug den Skandal zum Anlass zu nehmen, um einmal genauer hinter die Kulissen der Sportorganisation zu schauen. Der Skandal hat das IOC in Erklärungsnot gebracht und das System an sich in Frage gestellt. Das IOC ist immer noch Gesprächsthema, weil es genügend Gesprächsstoff für Kritik liefert. Zusätzliche Nahrung erhält und erhielt der Skandal beispielsweise durch neuerliche Verfehlungen des IOC-Mitgliedes Kim Un Yong und einem Gerichtsprozess in Salt Lake City. Mehr als einmal Anlass zurückzublicken und dem Skandal und seinen Folgen eine kritische Bewertung folgen zu lassen.
Auf dem Markt der Olympia-Literatur fehlt es allerdings an einer angemessenen Diskussion der Fragen und Probleme und an einer adäquaten wissenschaftlichen Darstellung. Journalisten orientieren sich vielfach an unzureichend begründeten Maßstäben. Was sich demzufolge en masse findet, sind zwei Extreme: […]
Die Olympischen Spiele haben sich nach ihrer Wiederbegründung 1894 zum größten Sportereignis der Welt entwickelt. Zu verdanken haben wir dieses Sportspektakel dem Franzosen Pierre de Coubertin, der die Idee vom friedlichen Zusammentreffen aller Völker und Rassen hatte. Die Olympischen Spiele haben Symbolcharakter und stehen für positive Werte. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), das sich um das Zustandekommen der Spiele kümmert, steht seit dem Skandal von Salt Lake City auch für andere Ideale wie zum Beispiel Korruption und Bestechlichkeit ein. Diese Magisterarbeit beschäftigt sich mit dem IOC-Korruptionsskandal um die Vergabe der Olympischen Winterspiele an Salt Lake City 2002. Worum geht es dabei überhaupt? Mitglieder des IOC haben mit Verantwortungsträgern eines Bewerbungskomitees um eine Olympia-Ausrichtung gedealt. Hierbei ist das Jahr 1995 von entscheidender Bedeutung, da damals die Spiele vergeben wurden. Der Skandal um die Olympiastadt hat das IOC in seinen Grundfesten erschüttert und in die größte Glaubwürdigkeitskrise seiner über 100-jährigen Tradition gestürzt. Die Wahl wurde durch Bestechung vorangetrieben. Jahrelang herrschten sie wie die Götter über die olympische Bewegung. Und immer umgab die Mitglieder des IOC der Geruch von Vetternwirtschaft und Korruption. Jetzt liegen erstmals Beweise vor (ROSENAU). In dem Bemühen die Winterspiele 2002 nach Salt Lake City zu holen, wurden die Grenzen des Statthaften weit überschritten.
Seit dem Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe Ende 1998 sind mehr als fünfeinhalb Jahre vergangen. Grund genug den Skandal zum Anlass zu nehmen, um einmal genauer hinter die Kulissen der Sportorganisation zu schauen. Der Skandal hat das IOC in Erklärungsnot gebracht und das System an sich in Frage gestellt. Das IOC ist immer noch Gesprächsthema, weil es genügend Gesprächsstoff für Kritik liefert. Zusätzliche Nahrung erhält und erhielt der Skandal beispielsweise durch neuerliche Verfehlungen des IOC-Mitgliedes Kim Un Yong und einem Gerichtsprozess in Salt Lake City. Mehr als einmal Anlass zurückzublicken und dem Skandal und seinen Folgen eine kritische Bewertung folgen zu lassen.
Auf dem Markt der Olympia-Literatur fehlt es allerdings an einer angemessenen Diskussion der Fragen und Probleme und an einer adäquaten wissenschaftlichen Darstellung. Journalisten orientieren sich vielfach an unzureichend begründeten Maßstäben. Was sich demzufolge en masse findet, sind zwei Extreme: […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8429
Sitarek, Jens: Quo vadis, IOC?
Der Korruptionsskandal um die Vergabe der Olympischen Winterspiele
an Salt Lake City 2002 und die Folgen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Georg-August-Universität Göttingen, Magisterarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Was man schreibt, das bleibt.
Jens Sitarek, Jahrgang 1975, geboren in
Hannover. Studierte die Fächerkombination
Sportwissenschaften, Medien- und
Kommunikationswissenschaft sowie
Politikwissenschaft an der Georg-August-
Universität Göttingen und das Leben.
Zahlreiche Weltreisen haben kostbare
Aufzeichnungen entstehen lassen, die das
Papiervolumen dieser Magisterabeit bei weitem
überschreiten. Ein Besuch bei den Olympischen
Spielen in Sydney 2000 weckte endgültig das
Interesse für die Thematik der vorliegenden
Arbeit, die er den Prüfern Prof. Dr. Arnd
Krüger und PD Dr. Wolfgang Buss im Mai 2004
vorlegte.
Eigentlich wollte Jens Sitarek, wie so viele
Jungs neben ihm auch, Fußballprofi werden. So
einer wie Kalle Rummenigge auf den ersten
sechs Metern jedem gegnerischen Verteidiger
davon laufend. Aber irgendwann musste er
leider schweren Herzens einsehen, dass er
abseits des grünen Rasens seine Stärken besser
ausspielen konnte. Das berufliche Interesse
galt fortan dem Sportjournalismus. Praktika,
Hospitanzen und Freie Mitarbeiten bei Zeitung,
Radio und Fernsehen (u.a. Süddeutsche Zeitung,
HNA, Radio ffn, ZDF) folgten. Seit September
2004 arbeitet Jens Sitarek als
Redaktionsvolontär bei der Goslarschen
Zeitung.
FOTO:
Inhaltsverzeichnis
Danksagung ... I
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ... II
Abkürzungsverzeichnis ... III
1.
Einleitung
...
1
2.
Begriffserklärungen:
Skandal, Korruption
...
4
3.
Die Olympische Bewegung ...
6
4.
Das
Internationale
Olympische Komitee ...
9
4.1
Organisation
...
9
4.2
Die Olympische Charta
...
10
4.3
Finanzierung
...
11
4.4
Die
Session ...
12
4.5
Der
Kongress
...
13
4.6
Der
Präsident
...
13
4.7
Das
Exekutivkomitee
...
15
4.8
Die
Mitglieder
...
16
4.9
Die
Kommissionen ...
19
4.10
Die Administration ...
20
5.
Die Geschichte der Vergabe von Olympischen
Spielen ... 21
6.
Das Prozedere der Vergabe von Olympischen
Spielen ... 29
7.
Exkurs:
Leipzig
2012 ... 31
7.1
Der internationale Auswahlprozess
...
31
7.2
Pro und Kontra
... 32
8.
Die Vergabe der Olympischen Winterspiele an
Salt Lake City
... 36
9.
Die Olympischen Spiele von Salt Lake City
...
37
9.1
Die Stadt im Kurzprofil
...
37
9.2
Die
Spiele ...
38
9.2.1
Der
Paarlauf-Skandal
...
39
9.2.2
Der
Doping-Skandal
...
39
10.
Der Bestechungsskandal von Salt Lake City
...
41
10.1
Der Auslöser: ein Brief ...
41
10.2
Die Äußerungen Marc Hodlers
...
42
10.3
Die einzelnen Akteure
...
43
10.3.1 IOC
...
44
10.3.2 USOC
...
44
10.3.3 SLOC
...
45
10.3.4
Justizministerium, FBI und Zollbehörde
...
45
10.4
Das ,,geld"-Dokument
...
46
10.5
Die Berichte der IOC-Untersuchungskommission ...
47
10.6
Der USOC-Bericht ...
49
10.7
Der SLOC-Bericht ...
50
10.8
Namen und Zahlen ...
51
11.
Die Folgen des Bestechungsskandals ... 56
11.1
Das Ausschlussverfahren der Mitglieder
...
56
11.2
Das IOC-Reformpaket
...
59
11.2.1 Die
Ethikkommssion
...
59
11.2.2 Die
Reformkommission ...
61
11.3
Die wichtigsten Strukturänderungen ...
61
11.3.1 Mitgliedschaft
...
62
11.3.2 Olympische
Spiele
...
63
11.3.3
Kommunikation und Transparenz
...
64
11.3.4
Bewerbungsverfahren und Reiseverbot
...
66
11.3.5
Der Kampf gegen Doping und die WADA
...
67
11.4
Die Folgen für Salt Lake City
...
68
11.5
Anhörungen im US-Kongress
...
71
11.6
Der Skandal und die Rolle des SLOBC/SLOC ...
72
12.
Von Samaranch zu Rogge
... 74
12.1
Die Ära Samaranch
...
74
12.2
Die fünf Kandidaten für die Nachfolge ...
76
12.3
Der Wahlmodus
...
78
12.4
Die Wahl Rogges
...
79
12.5
Die Person Rogge: Jacques, wer?
...
80
13.
Die Vergaben nach dem Skandal ... 81
14.
Bestechung
hat
Methode: in der Tendenz
käuflich ... 82
15.
Die Rolle der IOC-Agentur Hill & Knowlton ... 87
16.
Der Fall Kim Un Yong ... 90
17.
Alles hat ein Ende: der Prozess ... 93
18.
Systemkritik: über Sinn und Unsinn
der Reformen
... 96
19.
Fazit: quo vadis, IOC? ... 100
20.
Quellen-
und
Literaturverzeichnis ... 103
Anhang:
IOC-Mitgliederliste
Fragen an IOC-Mitglied Dr. Roland Baar
Selbstständigkeitserklärung
Danke
Prof. Dr. Arnd Krüger und PD Dr. Wolfgang Buss: für die Übernahme der Arbeit, der
mündlichen Prüfung im April 2003, diversen Anregungen, Anleitungen zum
selbstständigen Handeln frei von Zwängen.
Dr. Wilfried Scharf und Dr. Arndt Graf: für Umgangsformen und eine
unkonventionelle Art der Lehre.
Karina: dafür, dass du mich während der Arbeit ausgehalten hast, obwohl ich
manchmal unausstehlich war. HDL.
Meinen Eltern: dafür, dass es mich und meine Brüder gibt.
Meinem Powerbook: für die Ausdauer bei der Mammutaufgabe Magisterarbeit.
Tim Holzapfel und Christopher Schlienz: für blitzschnelle, unermüdliche Korrektur.
Meiner WG, Michael Tettke, Tim Holzapfel, Ingmar Beyer, Alexander Reichert,
Anne Marienhagen, Ingo Dansberg, Martin Mundschenk, Sieghard Ellenberger, Jan
Toppel, Marco Lutz: für nette Unterhaltungen, aufmunternde Sprüche, Daten- und
Informationsaustausch, intensive Waldläufe, Mensabesuche, echte Freundschaft,
Mac-Support, die eine oder andere gelungene Feier, kurzum: für ein
Studentenleben wie es im Buche steht.
Dr. Roland Baar: für kompetente Antworten auf all die Fragen, die mich und das
Thema bewegten.
Jeff Danziger, Thomas Kistner, Jens Weinreich, Andrew Jennings, Jim Ferstle,
Craig Copetas, Herbert Mathias Fischer-Solms, Marcia Sage: für den Gebrauch der
Karikatur, Anregungen, Material, Newsletter, geistige Nahrung.
Werder Bremen: für herzerfrischenden Offensiv-Fußball und den Meistertitel 2004.
Dem Personal vom ArabellaSheraton in Fuschl, der Agentur MVS Banusch: dafür,
dass sich mit dem Schreiben der Arbeit Geld verdienen ließe.
I
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abb. 1.
Danziger, Jeff: The Great Salt Lake. Quelle: Los Angeles Times Syndicate
vom 21. Januar 1999
Abb. 2.
Die ausrichtenden Länder der Olympischen Spiele von 1896 bis 2010
Abb. 3.
Ländervergleich: Bewerbungen für die Olympischen Spiele von 1896 bis 2010
Tab. 1.
Die Kommissionen und ihre Mitglieder. Quelle: IOC, 2004l.
Tab. 2.
Die Olympischen Spiele von 1896 bis 2010. Modifiziert nach: LYBERG, 1996:
237, 291.
Tab. 3a.
Die Bewerbungen für die Olympischen Sommerspiele von 1896 bis 2008.
Modifiziert nach: SCHERER, 1995: 401.
Tab. 3b.
Die Bewerbungen für die Olympischen Winterspiele von 1924 bis 2010.
Modifiziert nach: SCHERER, 1995: 375.
II
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
=
Abbildung
ACNOA
=
Association des Comités Nationaux Olympiques d´Afrique
a. D.
=
außer Dienst
afp
=
Agence France Presse
AGFIS
=
Association Générale des Fédérations Internationales de Sports
AIOWF
=
Association of International Olympic Winter Sports
ANOC
=
Association of National Olympic Committees
AP
=
Associated Press
APA
=
American Psychological Association
ARISF
=
Association of the IOC Recognised International Sports Federations
ASOIF = Association
of Summer Olympic International Federations
ATHOC
=
Athens Organizing Committee
Aufl.
=
Auflage
BPI
=
Bribe Payers Index
bzw.
=
beziehungsweise
CAS
=
Court of Arbitration for Sport
CIFP
=
International Committee for Fair Play
CPI
=
Corruption Perceptions Index
DLV
=
Deutscher Leichtathletik-Verband
dpa
=
Deutsche Presse-Agentur
dvs
=
Deutsche Vereinigung der Sportwissenschaft
ebd.
=
ebenda
E(N)OC
=
European (National) Olympic Committees
etc.
=
et
cetera
EU
=
Europäische
Union
FAZ
=
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FBI
=
Federal Bureau Investigation
Fifa
=
Fédération Internationale de Football Association
FIS
=
Fédération Internationale de Ski
FR
=
Frankfurter
Rundschau
III
GAISF
=
General Association of International Sports Federations
GmbH
=
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hrsg. =
Herausgeber
IOC
=
Internationales Olympisches Komitee
IPC
=
International Paralympic Committee
ISL
=
International Sports and Leisure
lat.
=
lateinisch
NBC
=
National Broadcasting Company
NOK
=
Nationales Olympisches Komitee
Nr.
=
Nummer
OCA
=
Olympic Council of Asia
ODEPA
=
Organización Deportiva PanAmericana
ONOC
=
Oceania National Olympic Committees
PR
=
Public
Relations
sid
=
Sport-Informations-Dienst
SLBE
=
Salt Lake Board of Ethics
SLOBC
=
Salt Lake Olympic Bid Committee (Bewerbungskomitee)
SLOC
=
Salt Lake Olympic Organizing Committee (Organisationskomitee)
SZ
=
Süddeutsche
Zeitung
Tab.
=
Tabelle
TI
=
Transparency
International
u. a.
=
unter anderem
Uefa
=
Union of European Football Association
USA
=
United States of America
USOC
=
United States Olympic Committee
WADA = World-Anti-Doping
Agency
WOA
=
World Olympians Association
z. B.
=
zum Beispiel
ZDF
=
Zweites Deutsches Fernsehen
IV
1
1. Einleitung
Die Olympischen Spiele haben sich nach ihrer Wiederbegründung 1894 zum
größten Sportereignis der Welt entwickelt. Zu verdanken haben wir dieses
Sportspektakel dem Franzosen Pierre de Coubertin, der die Idee vom friedlichen
Zusammentreffen aller Völker und Rassen hatte. Die Olympischen Spiele haben
Symbolcharakter und stehen für positive Werte. Das Internationale Olympische
Komitee (IOC)
1
, das sich um das Zustandekommen der Spiele kümmert, steht seit
dem Skandal von Salt Lake City auch für andere Ideale wie zum Beispiel
Korruption und Bestechlichkeit ein.
Diese Magisterarbeit beschäftigt sich mit dem IOC-Korruptionsskandal um die
Vergabe der Olympischen Winterspiele an Salt Lake City 2002. Worum geht es
dabei überhaupt? Mitglieder des IOC haben mit Verantwortungsträgern eines
Bewerbungskomitees um eine Olympia-Ausrichtung gedealt. Hierbei ist das Jahr
1995 von entscheidender Bedeutung, da damals die Spiele vergeben wurden. Der
Skandal um die Olympiastadt hat das IOC in seinen Grundfesten erschüttert und in
die größte Glaubwürdigkeitskrise seiner über 100-jährigen Tradition gestürzt. Die
Wahl wurde durch Bestechung vorangetrieben. ,,Jahrelang herrschten sie wie die
Götter über die olympische Bewegung. Und immer umgab die Mitglieder des IOC
der Geruch von Vetternwirtschaft und Korruption. Jetzt liegen erstmals Beweise
vor" (ROSENAU). In dem Bemühen die Winterspiele 2002 nach Salt Lake City zu
holen, wurden die Grenzen des Statthaften weit überschritten.
Seit dem Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe Ende 1998 sind mehr als
fünfeinhalb Jahre vergangen. Grund genug den Skandal zum Anlass zu nehmen,
um einmal genauer hinter die Kulissen der Sportorganisation zu schauen. Der
Skandal hat das IOC in Erklärungsnot gebracht und das System an sich in Frage
gestellt. Das IOC ist immer noch Gesprächsthema, weil es genügend
Gesprächsstoff für Kritik liefert. Zusätzliche Nahrung erhält und erhielt der Skandal
beispielsweise durch neuerliche Verfehlungen des IOC-Mitgliedes Kim Un Yong
1
Das Internationale Olympische Komitee wird in dieser Arbeit entgegen der Regel mit IOC
abgekürzt, weil diese Form sich auch in sämtlichen zugrunde liegenden Quellen findet. Ausnahme
Neue Zürcher Zeitung: Sie verwendet das Kürzel IOK.
2
und einem Gerichtsprozess in Salt Lake City. Mehr als einmal Anlass
zurückzublicken und dem Skandal und seinen Folgen eine kritische Bewertung
folgen zu lassen.
Auf dem Markt der Olympia-Literatur fehlt es allerdings an einer angemessenen
Diskussion der Fragen und Probleme und an einer adäquaten wissenschaftlichen
Darstellung. Journalisten orientieren sich vielfach an unzureichend begründeten
Maßstäben. Was sich demzufolge en masse findet, sind zwei Extreme:
Abrechnungen mit dem IOC einerseits und eine Art Hofberichterstattung
andererseits. Die Magisterarbeit versucht einen Mittelweg zu gehen und liefert eine
wissenschaftliche Darstellung verbunden mit im Vergleich dazu
,,journalistischeren" Schlussfolgerungen. Dabei geht die Arbeit folgenden
Fragestellungen nach: Wohin ging die olympische Entwicklung nach dem Skandal?
Oder blieb vielleicht alles beim Alten? Haben Menschen oder eher das System IOC
versagt?
Auf der Suche nach den Antworten klärt die Arbeit zu Beginn grundsätzliche
Begriffe wie Skandal und Korruption. Anschließend wird in Kapitel 3 die Olympische
Bewegung betrachtet an dessen Spitze das IOC. Aus diesem Grund werden
Aufbau und Funktion der Organisation anhand ausgewählter Aspekte in Kapitel 4
aufgezeigt, um dann die Geschichte (Kapitel 5) und das Prozedere (Kapitel 6) um
die Vergabe der Olympischen Spiele der Neuzeit zu durchleuchten. Einen
Schwerpunkt bildet hierbei die Vergabe an (Kapitel 8) und die Spiele von Salt Lake
City (Kapitel 9). Vorher macht aus Gründen der Aktualität ein Exkurs zu Leipzig
2012 deutlich, wie die Vergabe heute aussieht und worauf es dabei ankommt. Mit
dem Exkurs wird die Chronologie der Ereignisse, auf die die Arbeit ansonsten Wert
legt, unterbrochen. An dieser Stelle wird ein Problem deutlich: Teilweise sind die
Strukturänderungen schon Allgemeingut, was sie zum Zeitpunkt des Skandals
natürlich noch nicht waren.
Ab Kapitel 10 widmet sich die Magisterarbeit der Anatomie des Skandals: den
Ursachen und Akteuren und dem, was sich selbige zu Schulden haben kommen
lassen. Zudem beschäftigt sich die Arbeit in diesem Teil mit den mannigfaltigen
Folgen des Bestechungsskandals, in dem sie nicht nur das Reformverhalten des
3
IOC dokumentiert, sondern auch auf Salt Lake City und die Rolle des Bewerbungs-
und Organisationskomitees eingeht. Die Wahl des neuen IOC-Präsidenten (Kapitel
12) ist ebenso Teil der Aufarbeitung wie die Vergaben nach dem Skandal (Kapitel
13). Es würde den Umfang der Arbeit bei weitem überschreiten, ähnliche
Untersuchungen bei anderen Bewerbungsstädten durchzuführen. Dennoch: In
Kapitel 14 zeigt sie Mittel und Wege auf, IOC-Mitglieder in ihrem Stimmverhalten zu
beeinflussen, und greift dabei auch auf vergangene Ereignisse zurück. Dabei soll
deutlich werden, ob Fehlverhalten generell Methode hat oder es lediglich um
Einzelfälle geht.
Dass das IOC die PR-Agentur Hill & Knowlton beauftragte, ist in Kapitel 15
Gegenstand der Untersuchung. Auch die Aktualität kommt in der Arbeit nicht zu
kurz wie schon der Bezug auf Leipzig und die Bewerbung für die Spiele 2012
(Kapitel 7) dokumentiert. Kapitel 16 stellt dann den aktuellen Fall Kim Un Yong mit
all seinen Dimensionen vor. Der Gerichtsprozess von Salt Lake City, bei dem sich
zwei Verantwortliche des Bewerbungs-/Organisationskomitees auf der
Anklagebank wiederfanden, bildet den Abschluss der Chronologie der Ereignisse.
Mit dem Urteil findet der Bestechungsskandal um die Vergabe der Olympischen
Winterspiele an Salt Lake City quasi einen Schlusspunkt, da das IOC auf der
anderen Seite schon Reformen eingeleitet hatte. Kapitel 18 soll aufzeigen, was von
der Kritik am IOC zu halten ist. Die Wirkung der Reformen als Gegenstand der
Diskussion und eigene Lösungsvorschläge kommen hinzu. Ergänzt und
komplettiert wird der Schlussabschnitt durch das Fazit quo vadis, IOC?, eine
kompakte Zusammenfassung, die aufzeigt, woran es beim IOC in der
Vergangenheit haperte bzw. dies immer noch tut.
Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Arbeit nicht. Die Themenbereiche
sind so zusammengefasst, dass eine Einordnung in den Gesamtzusammenhang
erfolgen kann. Der Untersuchungszeitraum der Arbeit bezieht sich primär auf die
Entwicklung im IOC von Juni 1995 bis Mai 2004.
4
2. Begriffserklärungen: Skandal, Korruption
Die griechische Wurzel des Wortes Skandal versteht unter skándalon das Stellholz
einer Falle. Somit wäre der Skandal das Ereignis, das die Falle zuschlagen lässt,
nicht aber der Missstand, der dadurch auftritt. Der heutige Sprachgebrauch sieht in
einem Skandal nicht nur eine Momentaufnahme, sondern etwas lang Andauerndes,
unterscheidet demzufolge nicht zwischen Stellholz und Falle, Ereignis und
Missstand (vgl.: SZ, 2003). Synonym für Skandal wird das Wort Affäre verwendet.
Die Geschichte kennt beispielsweise Begriffe wie BSE-Skandal, Watergate-Affäre,
Bundesliga-Skandal oder die CDU-Parteispendenaffäre. Der Begriff Dopingskandal
zeigt, dass ein Skandal auch allgemeiner gefasst werden kann und keineswegs ein
abgeschlossenes Ereignis meint.
Das NET-LEXIKON (2004b) beschreibt Skandal als ,,das beabsichtigte oder
irrtümliche Fehlverhalten angesehener Personen oder Institutionen, das mittels der
Medien öffentlich gemacht wird und hohes Aufsehen erregt". Zu dem Punkt der
Verbreitung äußert sich das Aktuelle Lexikon (SZ, 2003) auf seine ihm
eigentümliche Weise:
,,Sicher ist der Skandal so alt wie die Menschheit, geändert hat sich nur das
Tempo, in dem die Kunde davon um die Welt läuft: Von der Päpstin Johanna
erfuhr man wesentlich später als von den Hitler-Tagebüchern, doch ließen
beide Skandale die betroffenen Institutionen, das marode Papsttum und eine
besinnungslose Sensationspresse, gewaltig in die Falle rasseln."
Das Wort Korruption hat seinen Ursprung im Lateinischen (lat. corrumpere =
verderben, entkräften, entstellen, bestechen) und bezeichnet Bestechung und
Bestechlichkeit. Korruption kann laut NET-LEXIKON (2004a) in aktiver
(Vorteilsgewährung, Schmiergeldzahlung, Ämterkauf, Stimmenkauf) und passiver
Form (Vorteilsnahme) geschehen. ,,Zur Vorteilsnahme gehören [...] politischer
Betrug, politische Erpressung, Wirtschaftskriminalität, Nepotismus
(Vetternwirtschaft), Patronage, Klientelismus, Lobbyismus".
Die Organisation Transparency International (TI), die sich den Kampf gegen
Korruption auf die Fahnen geschrieben hat, definiert den Begriff als ,,heimlichen
5
Missbrauch von öffentlicher oder privatwirtschaftlich eingeräumter Stellung oder
Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil" (vgl.: TI, 2004c). Die unterschiedlichen
Varianten der Bestechung nennt die Organisation ,,Gesichter", die wie folgt
aussehen können: ,,Schmiergeldzahlungen, Gelegenheitskorruption, Bestechung
und Bestechlichkeit in der öffentlichen Verwaltung, Genehmigungskorruption,
kriminelle Netzwerke, journalistische Korruption und Käuflichkeit politischer
Entscheidungen" (vgl.: TI, 2004a).
Um die Ausmaße von Korruption vergleichbar zu machen, veröffentlicht TI in
regelmäßiger Folge Untersuchungen. Dabei wird unterschieden zwischen zwei
Indices, dem Bribe Payers Index (BPI) und dem Corruption Perceptions Index
(CPI): Der BPI listet die Bereitschaft der führenden Exportnationen auf,
Schmiergelder in Schwellenländern zu zahlen. Ein hohes Ausmaß von Bestechung
zeigt sich durch Unternehmen aus Russland, China, Taiwan und Südkorea, gefolgt
von Italien, Hongkong, Malaysia, Japan, USA und Frankreich. Der CPI spiegelt die
Wahrnehmung von Geschäftsleuten und Länderanalysten wider. Er erfasst im Jahr
2003 133 Länder. 95 Länder erreichen weniger als 5 von maximal 10 Punkten.
Indonesien, Aserbaidschan, Kenia, Angola, Paraguay, Georgien, Haiti, Kamerun,
Nigeria, Myanmar, Tadschikistan und Bangladesch kommen lediglich auf einen
Wert von weniger als 2. Demzufolge wird Korruption in diesen Ländern als weit
verbreitet angesehen. Finnland, Dänemark, Neuseeland, Island, Singapur und
Schweden weisen einen Wert von über 9 auf und gehören zu den Ländern mit
einem geringen Ausmaß an wahrgenommener Korruption (vgl.: TI, 2004b). Eine TI-
Studie (vgl.: DIE WELT, 1999c) formuliert den CPI allgemeiner und besagt, dass
die Bereitschaft zur Bestechung in führenden Exportnationen erschreckend hoch
sei. Auch in Transformationsländern ließe sich Korruption nur langsam ausrotten,
prophezeite TI-Chef Peter Eigen (vgl.: ebd.). Geld angenommen werde besonders
gerne in Kamerun, das bei insgesamt 99 untersuchten Ländern auf dem letzten
Platz liegt.
6
3. Die Olympische Bewegung
Unter dem Dach des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben sich die
unterschiedlichsten Akteure zur Olympischen Bewegung versammelt. Diese ist
,,weltweiter Träger des Sports" (vgl.: MÜLLER, 1999), zu ihr gehören all die
Institutionen, die einen Beitrag zum Zustandekommen der Olympischen Spiele
leisten. Einzige Bedingung der Zugehörigkeit: die Einhaltung der Olympischen
Charta (siehe Kapitel 4.2) und die Anerkennung der jeweiligen Organisation durch
eben das IOC. Zur Bewegung zählen aber auch Vereine, Athleten, Trainer,
Schiedsrichter und Techniker (vgl.: IOC, 1997: 13). TRÖGER (2004) sieht in der
Bewegung insgesamt eine ,,Darstellung der Werte des Sports".
Wo Werte existieren, müssen selbige auch kommuniziert werden. So dient die
Olympische Bewegung eben auch der Verbreitung olympischen Gedankenguts. Die
Erziehung der Jugend durch Sport ist dabei ein wichtiger Baustein. MÜLLER (1999)
beschreibt die Hauptaufgabe dieser Erziehung mit ,,emanzipatorischen Werten":
Gleichheit der Geschlechter, der Rassen, die Mitsprache der Athleten, der Respekt
vor der Natur. Der Emanzipationsprozess beinhalte den ,,Wettstreit der Ideen um
den besten Weg".
Sport ohne Diskriminierung, eingerahmt von Werten wie Freundschaft, Solidarität
und Fair Play finden zudem als Werte-Bündel Eingang in das Vokabular der
Bewegung. Die fünf ineinander verschlungenen Ringe sind ihr Symbol. Sie stehen
für die fünf Kontinente und somit für Universalität. Die Tätigkeit der Olympischen
Bewegung erreicht schließlich ihren Höhepunkt in der Zusammenkunft der Athleten
bei dem größten Sportereignis der Welt, den Olympischen Spielen (vgl.: IOC, 1997:
13). Die Bewegung hat sich zudem zum Ziel gesetzt, einen Beitrag für eine
friedliche Welt zu leisten (vgl.: IOC, 1997: 13). GÜLDENPFENNIG (2000c: 4) vertritt
die Auffassung, dass die Bewegung sich nicht pauschal zu einem Friedensstifter
erklären lässt. Die Geschichte offenbare, dass sie ,,angesichts eines beliebigen
Konflikts in der Welt" oftmals in der ,,selbsterklärten Friedensmission" scheitere.
GÜLDENPFENNIG schlussfolgert daraus: ,,Olympische Spiele leisten nicht
automatisch einen Beitrag zum Frieden in der Welt." Sie böten aber mit den Mitteln
7
des friedlichen und legalen Wettstreits sowie der Begegnung und des
Kennenlernens die Möglichkeiten dazu (vgl.: ebd.: 5).
Repräsentiert wird die Olympische Bewegung durch vier in sich autonome
Hauptakteure: das IOC, die Internationalen Sportorganisationen (IFs), die
Nationalen Olympischen Komitees (NOKs) und die Organisationskomitees für die
Olympischen Spiele (OCOGs). Das IOC ist dabei der Dachverband für den
Olympischen Sport in jeglicher Form, so auch für die Asien- und
Panamerikanischen Spiele. Es kann die Anzahl der Sportarten und die Anzahl der
Wettbewerbe in den einzelnen Sportarten bestimmen. Ferner legt es fest, wie viele
Athleten und Länder an den Spielen teilnehmen dürfen (vgl.: ESPY: 176). Die
Internationalen Sportorganisationen bestimmen und überwachen die Regeln für
den individuellen Sport auch während der Olympischen Spiele. Sie haben
Vertretungen in den einzelnen Nationen und stehen in regem Austausch mit dem
IOC. Anerkannte Organisationen, deren Sport im olympischen Programm
auftaucht, haben einen internationalen olympischen Status und dürfen an den
jährlichen Treffen der IOC-Exekutive (siehe Kapitel 4.7) teilnehmen. Um ihren
Forderungen besser Nachdruck zu verleihen und um mit einer Stimme zu
sprechen, haben sich die Organisationen in der Association of Summer Olympic
International Federations (ASOIF), Association of International Olympic Winter
Sports (AIOWF), Association of the IOC Recognised International Sports
Federations (ARISF) und General Association of International Sports Federations
(GAISF
2
) zusammengeschlossen (vgl.: IOC, 2004c).
Die NOKs hingegen repräsentieren den Olympischen Sport und dienen der
Verbreitung des olympischen Ideenguts im jeweiligen Land. Ihnen gehören unter
anderem Funktionäre von nationalen Sportverbänden, Regierungsvertreter und
Geschäftsleute an (vgl.: KANIN: 5). Sie sind für die sportliche Entwicklung der
nationalen Athleten verantwortlich und stellen Trainingszentren und Förderung
bereit. Nur sie können die Athleten bestimmen, die für ihr Land an den
Olympischen Spielen teilnehmen. Auch der nationale Bewerbungsvorgang einer
2
Da die GAISF ihren Sitz in Monaco hat, findet sich auch häufig die Abkürzung AGFIS
(Association Générale des Fédérations Internationales de Sports).
8
Olympiastadt läuft über das Komitee (vgl.: IOC, 2004b). Zurzeit kennt das IOC 201
Nationale Olympische Komitees, von A wie Albania bis Z wie Zimbabwe.
Sie sind
ihrerseits in der Association of National Olympic Committees, kurz ANOC,
organisiert. Die ANOC macht dem IOC Vorschläge wie mit den Einnahmen
verfahren werden kann, und ermöglicht mindestens alle zwei Jahre ein informelles
Zusammentreffen aller Nationalen Olympischen Komitees. So können sich letztere
auf die Meetings mit der IOC-Exekutive und die Kongresse vorbereiten. Über die
ANOC verteilt das IOC den Gewinn aus den Olympischen Spielen in Millionenhöhe.
Sie teilt sich in fünf kontinentale Organisationen auf: Association des Comités
Nationaux Olympiques d´Afrique (ACNOA), Olympic Council of Asia (OCA),
European National Olympic Committees (ENOC), Organización Deportiva
PanAmericana (ODEPA) und Oceania National Olympic Committees (ONOC) (vgl.:
ebd.).
Den vierten Akteur bilden schließlich die Komitees, die sich auf nationaler Ebene im
Ausrichterland konstituieren. Das IOC betraut hierzu das NOK und die Stadt, in der
die Spiele stattfinden, mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele. Zu diesem
Zweck gründet das NOK dann ein Organisationskomitee, dem die IOC-Mitgieder
des jeweiligen Landes angehören, der Präsident und Generalsekretär des NOK, ein
von der entsprechenden Stadt speziell benanntes Mitglied sowie Vertreter der
unterschiedlichen Institutionen der Stadt. Heutzutage sind diese Komitees riesige
Verwaltungsapparate mit mehreren hundert Beschäftigten. Das
Organisationskomitee ist verantwortlich für die Entstehung der sportlichen
Infrastruktur. Dazu zählen unter anderem die Sportanlagen, die Verkehrwege, die
Unterbringung der Athleten und die Schaffung eines Medienzentrums. Außerdem
muss das OCOG Sorge dafür tragen, dass der Ort nicht für politische
Demonstrationen missbraucht wird (vgl.: IOC, 2004d). Dabei arbeitet es zu den
Regeln und Direktiven, die vom IOC kommen, muss aber auch die Spielregeln, die
ihm von den Sportverbänden vorgegeben werden, beachten (vgl.: KANIN: 6).
Das IOC kennt momentan vier Organisationskomitees: für Athen 2004 (ATHOC),
Turin 2006 (TOROC), Peking 2008 und Vancouver 2010 (vgl.: IOC, 2004d).
Letztere befinden sich noch in der Entstehung und haben wohl deswegen noch
9
keine Abkürzung erhalten. Daneben gibt es zahlreiche Partner, die gemeinhin der
Olympischen Bewegung zugerechnet werden. Dies sind zum Beispiel der
Sportgerichtshof (CAS), das Internationale Komitee für Fair Play (CIFP), das
Internationale Paralympische Komitee (IPC), die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)
und der Weltverband der Olympioniken (WOA) (vgl.: IOC, 2004a).
10
4. Das Internationale Olympische Komitee
Das Internationale Olympische Komitee wurde am 23. Juni 1894 von Baron Pierre
de Coubertin in Paris gegründet. Der offizielle Name des IOC war Comité
International des Jeux Olympiques. Vermutlich tauchte der heute im Französischen
gebräuchliche Name Comité International Olympique erst am 1. August 1897 in
einem Artikel der französischen Zeitung Le Petit Havre auf (vgl.: LYBERG: 17,
315). Der Pädagoge COUBERTIN (1967b: 21) gab seiner Organisation folgende
Aufgabenbeschreibung mit auf den Weg: ,,Wir sind ganz einfach die Treuhänder
der olympischen Idee". Mit anderen Worten: Das IOC ist verantwortlicher Hüter des
Olympismus
3
. Bei GÜLDENPFENNIG (2000c: 8) findet sich für das IOC synonym
der Begriff einer ,,transnationalen Nichtregierungsorganisation". Es ist aber
keineswegs ,, eine Art Weltregierung und Befehlszentrale, deren Anweisungen
allgemeingültiges Gesetz sind" (vgl.: TRÖGER, 1998: 15). Die Weltfachverbände
seien immer noch die sportliche Exekutive, denn sie bestimmten nach welchen
Regeln der Sport betrieben werde.
4.1 Organisation
Die Schweizer Stadt Lausanne ist seit 1913 Hauptquartier des Internationalen
Olympischen Komitees (vgl.: KANIN: 5). Als Dachverband der Olympischen
Bewegung besitzt das IOC laut VERDIER (1996: 464f) eine demokratische
Struktur. Es ist als Verein wie die Fifa (Fédération Internationale de Football
Association) und die Uefa (Union of European Football Association) nach
schweizerischem Recht organisiert. Das IOC profitiert dabei von der freiheitlichen
Ordnung des Vereinsrechts in der Schweiz: Die gesetzlichen Bestimmungen sind
einfach und wenig detailliert, da der Verein ursprünglich für ,,gesellige
Zusammenschlüsse ohne Teilnahme am Wirtschaftsleben" konzipiert war,
formuliert BERETTA (2002). Bei diesem Vorzug lässt sich die Organisation auf die
spezifischen Bedürfnisse anpassen. Diese Rechtsform ist somit für
Dachorganisationen weltweit tätiger Unternehmen von Interesse: Über den
3
Der Ausdruck stammt von Pierre de Coubertin, meint ein Ideal und kann synonym für die
Olympische Bewegung verstanden werden.
11
Schweizer Verein lässt sich die Tätigkeit koordinieren und ermöglicht ein globales
Auftreten als ein Unternehmen ,,ohne mit lokalen Gesetzen in Konflikt zu
geraten". Wie es zusammenpasst, dass das IOC als Verein hohe Gewinne
erwirtschaftet, dazu wiederum BERETTA (ebd.): ,,Während Vereine gemäss Gesetz
keinen wirtschaftlichen Zweck verfolgen dürfen, ist es ihnen ausdrücklich erlaubt,
ein kaufmännisches Gewerbe zu betreiben, d.h. namhafte Umsätze erzielen."
Diese Unterscheidung sei praktisch nicht sinnvoll. Denn: ,,Der Zweck eines Vereins
bestimmt sich nach den Statuten. Es ist ein Leichtes, den Zweckartikel eines
Vereins unverdächtig zu formulieren, so dass nichts auf einen unzulässigen Zweck
hinweist." Das IOC stellt die regelmäßige Ausrichtung der Olympischen Spiele
sicher. Für GÜLDENPFENNIG (2000c: 9) ist dies die wesentlichste Aufgabe des
IOC: Es verfolge ,,nur ein praktisches Projekt, dessen zuverlässiges
Zustandekommen im Vier-Jahres-Rhythmus garantiert werden soll". Neben der
Veranstaltung der Spiele sieht Ex-Präsident Juan Antonio Samaranch noch eine
weitere Funktion darin, ,,die olympische Bewegung zu koordinieren" (vgl. HAHN &
STRATMANN, 2001).
4.2 Die Olympische Charta
Die Charta des IOC kann als eine Art Verfassung, als ,,Regelwerk der Olympischen
Bewegung" (HÖFER, 1996a) angesehen werden. In ihrer neuesten Fassung vom
4. Juli 2003 kommt die Charta auf 107 Seiten Prinzipien, Regeln und Statuten. So
regelt sie die Organisation und den Ablauf der Olympischen Bewegung und gibt
den Olympischen Spielen einen Rahmen vor. Von dem Ablauf der Wahl des IOC-
Präsidenten über die Notwendigkeit und Möglichkeit der sportlichen Qualifizierung
eines Sportlers bis hin zur Vermarktung der Olympischen Spiele ist alles minutiös
geregelt und in unzählige Paragrafen verpackt. Anfangs finden sich auf zwei Seiten
die fundamentalen Prinzipien. Hernach folgen fünf Kapitel, die sich der
Olympischen Bewegung widmen (Kapitel 1), dem IOC (Kapitel 2), den
Internationalen Sportverbänden (Kapitel 3), den NOKs (Kapitel 4) und den
Olympischen Spielen (Kapitel 5) (vgl.: IOC, 2003; 2004g). Da es sich beim IOC um
einen Verein handelt, kommt Kapitel 2 fast schon einer Vereinssatzung gleich. Dort
12
werden auf 24 Seiten unter anderem die Aufgaben und Organisation des IOC
beschrieben.
4.3 Finanzierung
Das IOC ist im Besitz sämtlicher Rechte, die die Organisation, das Marketing, die
Übertragung und die Vermarktung der Symbole des einzigartigen und universalen
Ereignisses betreffen (vgl.: IOC, 2004f). Als eine Non-Profit-Organisation erhält es
keine staatliche Unterstützung und finanziert sich größtenteils durch private Gelder,
hauptsächlich aus Geldmitteln, die aus Verhandlungen um exklusive
Übertragungsrechte erwirtschaftet werden (VERDIER: 464f.). Zudem profitiert es
finanziell von den derzeit elf olympischen Sponsoren, die Verträge über mindestens
vier Jahre abschließen. Zu den so genannten TOP-Sponsoren des IOC (2004e)
gehören: Panasonic (Kategorie: Audio/TV/Video Equipment), Samsung (Wireless
Communication Equipment), Swatch (Timing, Scoring and Venue Results
Services), VISA (Consumer Payment Systems), Xerox (Document Publishing,
Processing and Supplies), Coca-Cola (Non-Alcoholic Beverages), Kodak
(Film/Photographic and Imaging), Atos Origin (Information Technology), Sports
Illustrated (Periodicals/Newspapers/Magazines), McDonald´s (Retail Food
Services) und John Hancock (Life Insurance/Annuities).
Pierre de Coubertin stellte in seiner Abschiedsrede als Präsident anno 1925 seine
Organisation noch vor die Alternative ,,Markt oder Tempel!" zu sein (vgl.: EGGERS)
Wie man an der heutigen Finanzierung erkennt und eigentlich schon seit der
erstmaligen offiziellen Teilnahme von Profis an den Spielen 1984 in Los Angeles
hätte vermuten können: Das IOC hat zweifelsfrei den Weg des Marktes beschritten.
Mit der Vermarktung der Ringe werden Milliarden-Umsätze gemacht. Da passt es
auch ins Bild, dass das IOC beschloss, seinen Anteil der Fernseheinnahmen mit
Beginn der Spiele 2000 zu erhöhen von ursprünglich 40 auf 51 Prozent (vgl.:
TRÖGER, 1996: 21).
Anfang März 2004 schrieb das Komitee erstmals die Übertragungsrechte öffentlich
aus und befolgte damit eine Wettbewerbsvorgabe der EU. Ende April wurde die
Entscheidung über die Vergabe der Fernsehrechte für die Spiele 2010 und 2012
13
noch einmal vertagt (vgl.: HANFELD). Es darf nun mit einer neuen
Rekordeinnahme gerechnet werden. Zum Vergleich: Die Einnahmen aus der
Vermarktung der Olympischen Spiele 2000 in Sydney betrugen insgesamt 2,6
Milliarden Dollar, davon allein 1,33 Milliarden Dollar für die Fernsehrechte. 36
Prozent wurden von den Sponsoren aufgebracht, elf Prozent stammten aus dem
Verkauf von Eintrittskarten und weitere zwei Prozent spülten Lizenzeinnahmen in
die Kasse (vgl.: FAZ, 2000). Zusammen mit den Fernseheinnahmen stellen die
Gelder der Sponsoren somit den Löwenanteil der Einnahmen dar. Diese beiden
Quellen machen zusammen mehr als 80 Prozent aus.
,,Das IOC konnte dabei den Anteil der Fernseheinnahmen an den gesamten
Einkünften in den vergangenen Jahren von 90 Prozent auf die heutigen 50 Prozent
senken und den Anteil der Sponsoren deutlich erhöhen" (FAZ, 2000). Von allem
Einnahmen verwendete das IOC 1996 lediglich sieben Prozent für seine Zwecke,
der große Rest kam dem Weltsport in allen Facetten zu (vgl.: TRÖGER, 1996: 20):
größtenteils den jeweiligen Organisationskomitees, den beteiligten Sportverbänden
und den NOKs. Trotz der Höhe der Einnahmen insgesamt und ob der
unterschiedlichen Herkunft der Gelder darf nicht vergessen werden: Das IOC ist
ungewollt abhängig und zwar von den Olympischen Spielen als dessen einzige
Einnahmequelle.
4.4 Die Session
Mindestens ein Mal im Jahr findet eine Generalversammlung, die so genannte
Session, aller IOC-Mitglieder statt. Die Session ist ein olympisches Parlament, das
sich um die Interpretation, Auslegung und Modifikation der Charta bemüht. Alle
Änderungen derselben bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Mitglieder. Die Tagesordnungspunkte auf der Konferenz hingegen werden vom
Exekutivkomitee und vom Präsidenten festgelegt (vgl.: VERDIER: 465f). Eine
außergewöhnliche Session ist auf Initiative des Präsidenten hin möglich oder wenn
dies mindestens ein Drittel der IOC-Mitglieder wünscht. Die Entscheidungen, die
die Session trifft, sind endgültig. Auf Vorschlag des Exekutivkomitees wählt sie die
Mitglieder (vgl.: IOC, 1997: 29).
14
4.5 Der Kongress
Mit dem Kongress existiert noch eine Art Diskussionsforum zwischen den
Vertretern der Nationalen Olympischen Komitees, Sportverbänden, Athleten,
Schiedsrichtern, Medienvertretern (seit 1994) und sämtlichen IOC-Mitgliedern. Die
Vorschläge, die bei diesem Forum ausgearbeitet, die Ideen, die erörtert werden,
und die Probleme, die zur Aussprache kommen, lassen eine Standortbestimmung
der Olympischen Bewegung und eine Anpassung an die Zeit zu. Die alleinige
Entscheidungsgewalt obliegt dem IOC schließlich auf seiner Session. Eine ad hoc
einberufene Kommission behandelt dazu die Ergebnisse, die dann eventuell
Einfluss auf den Inhalt der Olympischen Charta nehmen können. So soll es eine
stete ideelle Erneuerung geben (vgl.: VERDIER: 466f). Vorsitzender des
Kongresses ist der IOC-Präsident. Zu dem Teilnehmern gesellen sich noch
Vertreter der vom IOC anerkannten Organisationen. Der erste Kongress fand 1894
in Paris statt, wo die modernen Olympischen Spiele begründet wurden (vgl.: IOC
1997: 83).
4.6 Der Präsident
Präsident des IOC kann jeder werden, der a) Mitglied des IOC ist (Kapitel 4.8) und
b) zugleich dessen Exekutivkomitee (Kapitel 4.7) angehört. Nach einer geheimen
Wahl (auf den Wahlmodus wird unter Kapitel 12.3 noch en detail eingegangen) wird
man es zunächst für eine Amtszeit von acht Jahren. Danach gibt es die Möglichkeit
einer Wiederwahl für weitere vier Jahre. Der Präsident zeigt sich für sämtliche
Aktivitäten des Komitees verantwortlich. Ex officio ist er Mitglied in allen
Kommissionen und Arbeitsgruppen. Wenn er der Ansicht ist, dass diese ihre
Aufgabe und Arbeit erfüllt haben, kann er selbige auflösen. Zudem hat er das
Recht, ad hoc Kommissionen einzuberufen (vgl.: IOC, 1997: 23). Rein formal ist der
Präsident in der Exekutive ein primus inter pares mit zwei Privilegien: einer
längeren ersten Amtszeit und zweitens besitzt er, bedingt durch sein Initiativrecht
Treffen der Exekutive einzuberufen, eine gewisse Richtlinienkompetenz. So kann
15
er die Politik steuern, was das Agenda-Setting
4
betrifft. Fälschlicherweise wird in
den Medien immer wieder kolportiert, dass der Präsident per se seines
Stimmrechts beschnitten ist. Doch dies war lediglich die gute Tradition des
Präsidenten Samaranch: sich bei Wahlen zu enthalten. Er durfte mit abstimmen, tat
es aber nicht. Erst bei einer Pattsituation wollte er seine Casting Vote einsetzen,
um eine Entscheidung herbeizuführen (vgl.: TRÖGER, 2004). Der neue Präsident
Jacques Rogge führt diese Tradition fort (vgl.: BAAR, 2004b).
Seit dem 16. Juli 2001 ist der Belgier Präsident des Internationalen Olympischen
Komitees. Er wurde auf der 112. Session in Moskau gewählt und ist nunmehr der
achte Präsident in der IOC-Geschichte. Von 1989 bis 1992 war Rogge Präsident
des NOKs von Belgien, 1991 wurde er in das IOC gewählt und sieben Jahre später
in dessen Vorstand, das Exekutivkomitee (vgl.: IOC, 2004h). Jacques Rogge hat
das Erbe von Juan Antonio Samaranch angetreten. Der Spanier hatte zuvor 21
Jahre lang dem IOC vorgestanden. An diesen Rekord von Samaranch wird ein
zukünftiger Präsident nicht mehr heranreichen können, denn nach zwölf Jahren
und zwei Amtszeiten (acht plus vier) ist eine erneute Wiederwahl des Präsidenten
ausgeschlossen. Die Geschichte des IOC kennt außer Rogge und Samaranch
sechs weitere Präsidenten. Der Grieche Demetrius Vikélas (1894-1896) gehörte
schon zu den IOC-Gründungsmitgliedern. Der Franzose Pierre de Coubertin (1896
1925) war vor seiner Präsidentschaft Generalsekretär des IOC. Henri de Baillet-
Latour aus Belgien stand dem IOC von 1925 bis 1942 vor. Vor seiner Amtszeit
sammelte er Erfahrungen als Organisationschef der Olympischen Spiele 1920 in
Antwerpen. Johannes Sigfrid Ekström (Schweden) war Gründungspräsident des
Internationalen Leichathletikverbandes im Jahre 1912. Von 1937 bis 1942 war er
Vizepräsident, ab 1942 amtierender und seit 1946 gewählter Präsident des IOC.
Avery Brundage löste den Schweden 1952 ab. Der Amerikaner war
Olympiateilnehmer (Leichtathletik 1912 in Stockholm) und blieb bis 1972 IOC-
Präsident. Brundage galt als Verfechter des Amateurgedankens. Lord Michael
Killanin aus Irland stand dem IOC von 1972 bis 1980 vor. Nach seinem Rücktritt
4
Meint das, was auf die Tagesordnung kommt.
16
wurde er Ehrenpräsident des Komitees auf Lebenszeit (vgl.: IOC, 2004j; KRUSE &
MENDE: 10).
4.7 Das Exekutivkomitee
Die Mitglieder der Generalversammlung wählen das 15-köpfige Exekutivkomitee,
das erst seit 1921 die Geschicke des IOC lenkt. Es besteht aus dem Präsidenten,
vier Vize-Präsidenten und zehn weiteren Mitglieder (vgl.: IOC, 2004i). Das
Exekutivkomitee stellt die ausübende Gewalt die Regierung des IOC respektive
der gesamten Olympischen Bewegung dar (vgl.: VERDIER: 466). Zu deren
wichtigsten Aufgaben zählen unter anderem die Ausarbeitung von Reports, die
Überwachung der Einhaltung der Olympischen Charta, das Agenda-Setting der
Sessionen und das Vorschlagsrecht neuer Mitglieder. Des Weiteren versucht die
Exekutive, die interne Organisation des IOC zu verbessern, benennt den
Generaldirektor und Generalsekretär, führt offizielle Statistiken und dirigiert das
Auswahlverfahren für Olympia-Bewerberstädte. Es zeigt sich somit verantwortlich
für die Administrative, das Management und für das tägliche Handeln des IOC als
Gesamtkomplex, vor allem für das finanzielle Gebaren (vgl.: IOC, 2004i).
Das Exekutivkomitee konstituiert sich nach einer geheimen Wahl mit einfacher
Mehrheit durch die Generalversammlung. Der Präsident sitzt dem Komitee vor und
wird von den Vize-Präsidenten assistiert und auch vertreten. Im Fall des vorzeitigen
Ausscheidens des Präsidenten übernimmt der älteste Vizepräsident das Amt bis
zur nächsten Vollversammlung. Das Exekutivkomitee trifft sich auf Initiative des
Präsidenten oder auf Wunsch der Mehrheit der restlichen Mitglieder. Der Präsident
gehört der Exekutive für acht Jahre an, im Gegensatz zu den anderen 14
Mitgliedern, die lediglich für vier Jahre diese Position innehaben dürfen. Es sei
denn, sie steigen in der Hierarchie durch Wahl zum Vize-Präsidenten oder
Präsidenten auf, dann sind weitere vier Jahre erlaubt. So oder so ist nach einer
Auszeit eine weitere Kandidatur für das Exekutivkomitee erlaubt (vgl.: IOC, 2004i).
Durch die relativ starke Mitglieder-Fluktuation gelangen neue Personen mit neuen
Ideen in die Exekutive.
17
Ein Reformbeschluss von 1999 besagte, dass die aus der Exekutive
ausscheidenden Mitglieder vier Jahre hätten warten müssen. Dieser Zeitraum
wurde zunächst auf ein Jahr beschränkt, schlussendlich dann auf zwei Jahre
festgelegt. Diese Änderung, so das deutsche IOC-Mitglied Thomas Bach, sei ein
guter Beschluss, ,,weil er die Balance zwischen Erneuerung und Kontinuität
gewährleistet" (vgl. FISCHER-SOLMS, 2002b). Die Amtszeiten der Mitglieder
reichen vom Ende der Session, auf der sie gewählt werden, bis hin zur letzten
Session in dem Jahr, in dem ihr Mandat ausläuft. Das heutige Exekutivkomitee
kennt Jacques Rogge (Belgien, seit 1998), die Vize-Präsidenten Thomas Bach
(Deutschland, seit 1996), Vitaly Smirnov (Russland, von 1974-1982, 1986-1990,
1991-1995 und seit 2001), James L. Easton (USA, seit 2002) und Kim Un Yong
(Südkorea, von 1988-1996, 1997-2001 und seit 2003 der Exekutive zugehörig). Zu
den weiteren Mitgliedern zählen: Franco Carraro (Italien, seit 2000), der Schweizer
Denis Oswald (seit 2000) als Repräsentant der Sommersportverbände, der
Mexikaner Mario Vázquez Raña (seit 2000) als Repräsentant der Nationalen
Olympischen Komitees, der Italiener Ottavio Cinquanta (seit 2000) als
Repräsentant der Wintersportverbände, der Athletenvertreter Sergej Bubka
(Ukraine, seit 2000), Lambis V. Nikolaou (Griechenland, seit 2001) und Toni Khoury
(Libanon, seit 2001). Zuletzt wurden 2003 Gerhard Heiberg (Norwegen) und Alpha
Ibrahim Diallo (Guinea) in das Komitee gewählt. Mit Gunilla Lindberg aus
Schweden ist seit 2000 auch eine Frau unter den 14 Männern vertreten. Mit Rogge,
Bach, Bubka und Oswald sitzen vier ehemalige Athleten im Komitee (vgl.: IOC,
2004i.).
4.8 Die Mitglieder
Mitglied im IOC kann nur werden, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Dazu gehören
beispielsweise eine Karriere im Sport entweder als Athlet oder Funktionär gemacht
und eine einflussreiche Tätigkeit innerhalb des eigenen Landes ausgeübt zu haben.
In der Realität erfüllen IOC-Mitglieder beide Kriterien. Sie müssen einem Land
angehören, das zugleich auch ein NOK stellt. Des Weiteren müssen die Mitglieder
in der Lage sein, Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch oder
18
Arabisch zu sprechen (vgl.:
LYBERG: 407ff). Laut BAAR (2004b) spielen
Quotenaspekte wie Kontinentalzugehörigkeit oder Geschlecht generell keine Rolle.
,,Wenn aber eine Frau aus Asien käme, dann wäre sicherlich die Akzeptanz
größer."
Bis zum Skandal von Salt Lake City gelangte man mittels Kooption
5
ins IOC,
seitdem schlägt eine Nominierungskommission potenzielle neue Mitglieder nach
sorgfältiger Überprüfung vor. Sie werden dann während einer Session gewählt und
schwören vor ihrer Mitgliedschaft einen Eid (vgl.: IOC, 1997: 21). Der Eid findet sich
in Regel 20, Absatz 1 der Olympischen Charta (IOC, 2003) und lautet sinngemäß:
,,Bedacht mit der Ehre, Mitglied des IOC zu werden und dieses in meinem Land
zu repräsentieren, und im Bewusstsein meiner Verantwortung für diese
Aufgabe werde ich der Olympischen Bewegung nach meinen besten Kräften
dienen, alle Vorschriften der Olympischen Charta und die Entscheidungen des
IOC, die ich ohne Bedingungen meinerseits akzeptiere, respektieren und ihnen
Respekt verschaffen, gemäß dem Code of Ethics
6
handelnd, mich freihalten
von jedem politischen und kommerziellen Einfluss und von jeder rassistischen
oder religiösen Voreingenommenheit und unter allen Umständen die Interessen
des IOC und der Olympischen Bewegung verteidigen."
Diejenigen, die vor 1966 ins IOC aufgenommen wurden, bleiben Mitglied auf
Lebenszeit. Jene, die der Organisation nach 1966 beitraten, scheiden am Ende des
Jahres aus, in dem sie 80 Jahre alt werden (vgl.: VERDIER: 465).
Seine
Mitgliedschaft beenden lässt sich jederzeit mit einer schriftlichen Austrittserklärung.
Falls ein Mitglied seine Nationalität und seinen Wohnsitz ändert oder sich
dementsprechend in einem anderen Land aufhält, verliert es ohne entsprechende
Erklärung seine Mitgliedschaft. Das Gleiche gilt, wenn es zwei Jahre lang an keiner
Vollversammlung teilnimmt (vgl.: IOC; 2003). Eine weitere Möglichkeit der
Beendigung der Mitgliedschaft stellt der Ausschluss dar, auf den unter Kapitel 12.1
noch genauer angegangen wird.
5
Die (nachträgliche) Hinzuwahl neuer Mitglieder.
6
Ein Verhaltenskatalog basierend auf ethisch-moralischen Prinzipien.
19
EGGERS (2001) formuliert zur Struktur der Mitglieder: ,,Das Einzige, was es (das
IOC) wirklich unterschied von einem Kleingartenverein, war der exklusive
Charakter." Dabei sind die Mitglieder keine offiziellen Repräsentanten ihrer Länder
im IOC, sondern IOC-Delegierte in ihrem Land. Somit können sie als eine Art
Botschafter der Olympischen Idee betrachtet werden (vgl.: KANIN: 5; IOC, 1997:
21). Nicht jedes an Olympischen Spielen teilnehmende Land, stellt auch ein IOC-
Mitglied (vgl.: VERDIER: 465). Folglich sind Mitglieder der Nationalen Olympischen
Komitees oder ihrer kontinentalen Organisationen nicht zugleich auch Mitglied im
IOC.
Die Mitglieder sind nach Eintrittsdatum sortiert
7
. Ihre Unterscheidung erfolgt in aktiv
und passiv. Heute kennt das IOC 125 aktive Mitglieder
8
, zusätzlich dazu gibt es 24
passive (20 Ehrenmitglieder, vier Ehrenamtliche). Zudem gehört Juan Antonio
Samaranch als Ehrenpräsident auf Lebenszeit zum IOC, welches summa
summarum aus 150 Mitgliedern besteht. Lediglich den Aktiven, wie der Name
schon impliziert, kommt eine Entscheidungsgewalt in Form eines Stimmrechtes zu.
Frauen sind insgesamt unterrepräsentiert: Von den 125 Aktiven sitzen zehn Frauen
im IOC das macht eine Quote von nicht einmal zehn Prozent. Unter den Passiven
finden sind lediglich zwei Frauen (vgl.: IOC, 2004k), obwohl das Ziel des IOC die
Gleichberechtigung der Frau ist (vgl.: TRÖGER, 1996: 31). Den größten
kontinentalen Anteil im aktiven Teil des IOC stellen die Europäer mit 57 Mitgliedern,
also etwas weniger als die Hälfte. Auf den weiteren Plätzen folgen Asien (26),
Afrika (16), Zentral- und Südamerika (14) sowie Nordamerika und Australien
(jeweils sechs) (vgl.: IOC, 2004k). 1981 wurden erstmals Frauen aufgenommen
(vgl.: FAZ, 1999d). Von den heutigen Mitgliedern vertraten 40 ihre Länder bei den
Olympischen Spielen, 27 derer gewannen auch Medaillen (vgl.: IOC, 2004k).
Die Struktur der ,,Selbstrekrutierung seiner Mitglieder" hat sich bis heute erhalten
und bewährt (vgl.: GÜLDENPFENNIG, 2000c: 9). Für ein Novum in der mehr als
100-jährigen Geschichte des IOC sorgte allerdings die 112. Session in Moskau.
7
Diese Art der Einteilung nennt man auch Protokoll. Stellvertreter des Präsidenten ist demzufolge
der Russe Vitaly Smirnow, weil er zugleich Vizepräsident im Protokoll an vierter Stelle und
damit am weitesten oben rangiert (siehe Mitgliederliste im Anhang).
8
Dazu zählen auch noch Kim Un-Yong (Südkorea) und Bob Mohamad Hasan (Indonesien). Beide
sind bis auf weiteres suspendiert (siehe dazu Kapitel 16), deren IOC-Zukunft ungewiss.
20
Der Schweizer Adolf Ogi wurde nicht in die Organisation gewählt bei 59 Nein-
und 46 Ja-Stimmen. Marc Hodler, IOC-Mitglied und Landsmann von Ogi, suchte
sich in einer Erklärung: ,,Es besteht offenbar die Meinung in diesem Gremium, dass
die Schweiz zu stark vertreten ist" (vgl.: WIEGAND, 2001g).
4.9 Die Kommissionen
Um die spezifischen Aufgaben, mit denen das IOC konfrontiert wird, zu
bewerkstelligen, werden Kommissionen mit den unterschiedlichsten
Themenbereichen, eingesetzt.
Diese Arbeitseinheiten dienen dabei als Ratschlag
gebende Organe und setzen sich nicht nur aus IOC-Mitgliedern zusammen. Einige
sind gemischt, da auch Personen der Sportverbände, der Nationalen Olympischen
Komitees und des öffentlichen Lebens daran teilnehmen. Im Falle der
Medizinischen Kommission werden zum Beispiel Ärzte als Spezialisten hinzugeholt
(ESPY: 176). Zu diesen Personen gesellt sich mindestens dann noch ein Vertreter
aus dem Kreis der Athleten (vgl.: IOC, 2004l).
Die Kommissionen und deren Mitglieder werden vom Präsidenten bestimmt, einzig
und allein in die Athletenkommission wird man gewählt. Die Hauptaufgabe der
Mitglieder besteht darin, Reports und Vorschläge auszuarbeiten allerdings ohne
jegliche Entscheidungskraft. Die Reports wandern schließlich an die Exekutive,
welche die aus diesen Vorlagen gewonnenen Erkenntnisse für die nächste Session
verwertet (VERDIER: 466f).
Das IOC zu Beginn des Jahres 2004 kennt 24 Kommissionen. Mit Thomas Bach
(zwei) und Walther Tröger steht drei Kommissionen ein deutsches IOC-Mitglied vor.
Insgesamt sind zehn Deutsche vertreten. Es folgt ein Kurzüberblick über die
Kommissionen mit ihren Vorsitzenden und den deutschen Mitgliedern:
21
Tab. 1. Die Kommissionen und ihre Mitglieder
Komission Vorsitzender
Deutsche
Mitglieder
Kultur und Olympische
Erziehung Zhenliang
He
(China)
Norbert Müller, Klaus Schormann
und Karl Lennartz
Athletenkommission
Sergej Bubka (Ukraine)
Roland Baar
Ethikkommission Kéba
Mbaye
(Senegal)
Nominierungskommission Francisco
J. Elizalde (Philippinen)
Finanzkommission
Richard L. Carrión (Puerto Rico)
Juristische Kommission
Thomas Bach (Deutschland)
Marketingkommission
Gerhard Heiberg (Norwegen)
Thomas Bach
Medizinische Kommission
Arne Ljungvist (Schweden)
Klaus Steinbach
Pressekommission
Richard Kevan Gosper (Australien)
Hans-Hermann Mädler
Radio- und
Fernsehkommission
Un Yong Kim (Südkorea)
Stefan Kürten
Programmkommission
Franco Carraro (Italien)
Roland Baar
Olympische Solidarität
Mario Vázquez Raña (Mexiko)
Sport und Recht
Thomas Bach (Deutschland)
Mathias Berg
Sport und Umwelt
Pál Schmitt (Ungarn)
Sport für alle
Walther Tröger (Deutschland)
Peter Kapustin
Koordinierungskommission
für die Olympischen Spiele
2004
Denis Oswald (Schweiz)
Koordinierungskommission
für die Olympischen
Winterspiele 2006
Jean-Claude Killy (Frankreich)
Koordinierungskommission
für die Olympischen Spiele
2008
Hein Verbruggen (Niederlande)
Koordinierungskommission
für die Olympischen Spiele
2010
René Fasel (Schweiz)
Olympische Sammlungen
Juan Antonio Samaranch (Spanien)
Internationale Beziehungen
Guy Drut (Frankreich)
Fernseh- und
Internetrechte
Jacques Rogge (Belgien)
Thomas Bach
Studienkommission für die
Olympischen Spiele
Richard Pound (Kanada)
Frauen und Sport
Anita L. Defrantz (USA)
Ilse Bechthold
4.10 Die Administration
Dem Generalsekretariat des IOC obliegt seit 1915 die Administration in Lausanne,
seit 1967 ist sie im dortigen Château de Vidy angesiedelt (vgl.: IOC, 2000c). An der
Spitze der Verwaltung steht mit Urs Lacotte ein Generaldirektor. Lacotte wiederum
unterstehen ein Generalsekretär und weitere Direktoren, die für
Kompetenzbereiche wie Medizin, Marketing, Kommunikation, Internationale
Zusammenarbeit, Beziehungen zu den einzelnen Parteien der Olympischen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832484293
- ISBN (Paperback)
- 9783838684291
- Dateigröße
- 815 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Georg-August-Universität Göttingen – Sozialwissenschaften, Sportwissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- olympische spiele nationales olympisches komitee leipzig korruption hill knowlton
- Produktsicherheit
- Diplom.de