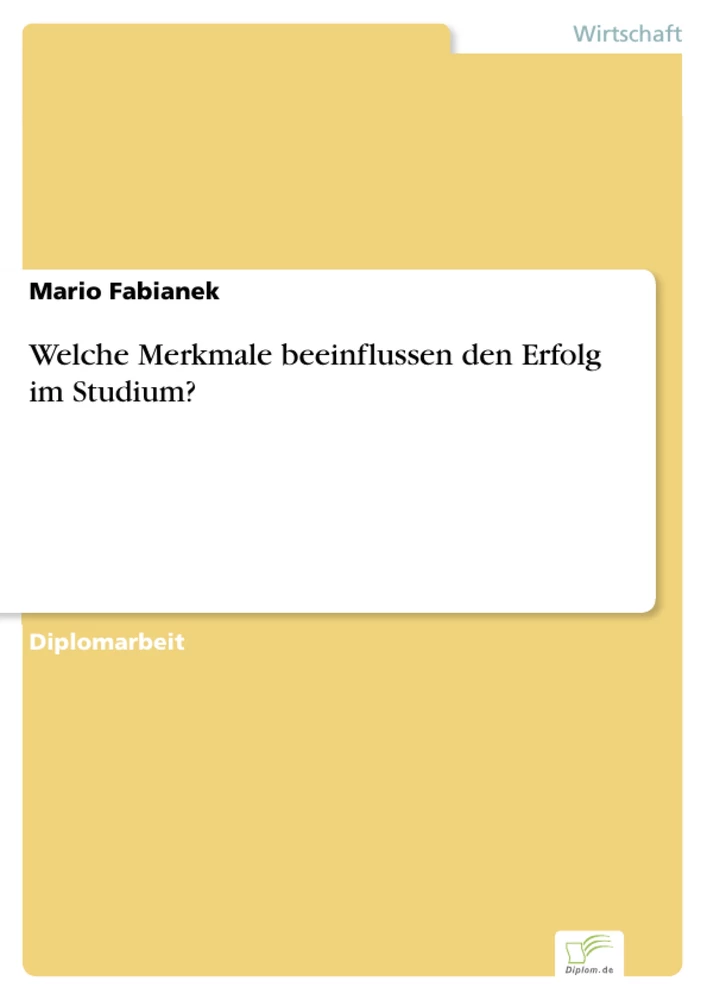Welche Merkmale beeinflussen den Erfolg im Studium?
©2004
Diplomarbeit
153 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit versucht anhand bereits verifizierter, aber auch anhand noch nicht ausreichend validierter Variablen den Studienerfolg von Beamten vorherzusagen. Die Untersuchung beschäftigt sich insbesondere mit Determinanten des Studienerfolgs bei Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Sie hat das Ziel, maßgebliche Einflussvariablen für den Erfolg in diesem Studium nachzuweisen. Studienerfolg soll dabei an folgenden Kriterien festgemacht werden: Zwischenprüfungsnoten, Praktikumsbeurteilungen und Studienzufriedenheit. Als Prädiktoren werden grundlegende Merkmale der Persönlichkeit (Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Fähigkeiten, Interessens- und Motivdispositionen) sowie biographische Merkmale herangezogen.
Teil I stellt den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Zuerst wird ein Überblick über die Kriterien des Studienerfolgs gegeben (I-1). Danach werden valide Prädiktoren des Studienerfolgs diskutiert (I-2). Hierbei werden die drei Hauptmerkmale der Persönlichkeit (Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Fähigkeiten, Interessens- und Motivdispositionen) behandelt. Im Anschluss werden erfolgsrelevante biographische Merkmale vorgestellt. Im Kapitel I-3 werden die Hypothesen zum methodischen Teil zusammengefasst.
Teil II dieser Arbeit befasst sich mit der Methode der Untersuchung. Hier werden die Rahmenbedingungen (II-1), das Studiendesign (II-2) und das Vorgehen (II-3) vorgestellt. Anschließend erfolgt die Darstellung der Erhebungsinstrumente (II-4). In Kapitel II-5 und II-6 wird die Stichprobe sowie die Teilnehmer beschrieben, die die Teilnahme verweigert haben. Dieser Teil endet mit der Operationalisierung und Spezifizierung der unter I-3 aufgestellten Hypothesen unter Bezugnahme des Studiendesigns und der Erhebungsinstrumente.
In Teil III der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Diese befassen sich mit der Vorhersage des Studienerfolgs im Globalmodell (III-1.1), im notenreduzierten Modell (III-1.2) und im eignungsdiagnostischen Modell (III-1.3). Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst (III-1.4). Im letzten Abschnitt werden noch die Studienerfolgsunterschiede aufgrund verschiedener Berufswahlmotive berichtet (III-2).
Im Teil IV werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei geht es um die Vorhersage des Studienerfolgs im Globalmodell (IV-1.1), im notenreduzierten Modell (IV-1.2) sowie im eignungsdiagnostischen Modell (IV-1.3) […]
Die vorliegende Arbeit versucht anhand bereits verifizierter, aber auch anhand noch nicht ausreichend validierter Variablen den Studienerfolg von Beamten vorherzusagen. Die Untersuchung beschäftigt sich insbesondere mit Determinanten des Studienerfolgs bei Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Sie hat das Ziel, maßgebliche Einflussvariablen für den Erfolg in diesem Studium nachzuweisen. Studienerfolg soll dabei an folgenden Kriterien festgemacht werden: Zwischenprüfungsnoten, Praktikumsbeurteilungen und Studienzufriedenheit. Als Prädiktoren werden grundlegende Merkmale der Persönlichkeit (Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Fähigkeiten, Interessens- und Motivdispositionen) sowie biographische Merkmale herangezogen.
Teil I stellt den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Zuerst wird ein Überblick über die Kriterien des Studienerfolgs gegeben (I-1). Danach werden valide Prädiktoren des Studienerfolgs diskutiert (I-2). Hierbei werden die drei Hauptmerkmale der Persönlichkeit (Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Fähigkeiten, Interessens- und Motivdispositionen) behandelt. Im Anschluss werden erfolgsrelevante biographische Merkmale vorgestellt. Im Kapitel I-3 werden die Hypothesen zum methodischen Teil zusammengefasst.
Teil II dieser Arbeit befasst sich mit der Methode der Untersuchung. Hier werden die Rahmenbedingungen (II-1), das Studiendesign (II-2) und das Vorgehen (II-3) vorgestellt. Anschließend erfolgt die Darstellung der Erhebungsinstrumente (II-4). In Kapitel II-5 und II-6 wird die Stichprobe sowie die Teilnehmer beschrieben, die die Teilnahme verweigert haben. Dieser Teil endet mit der Operationalisierung und Spezifizierung der unter I-3 aufgestellten Hypothesen unter Bezugnahme des Studiendesigns und der Erhebungsinstrumente.
In Teil III der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Diese befassen sich mit der Vorhersage des Studienerfolgs im Globalmodell (III-1.1), im notenreduzierten Modell (III-1.2) und im eignungsdiagnostischen Modell (III-1.3). Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst (III-1.4). Im letzten Abschnitt werden noch die Studienerfolgsunterschiede aufgrund verschiedener Berufswahlmotive berichtet (III-2).
Im Teil IV werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei geht es um die Vorhersage des Studienerfolgs im Globalmodell (IV-1.1), im notenreduzierten Modell (IV-1.2) sowie im eignungsdiagnostischen Modell (IV-1.3) […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8073
Fabianek, Mario:
Welche Merkmale beeinflussen den Erfolg im Studium?
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich für die mannigfache Unterstützung, die
ich erfahren durfte, zu bedanken.
Mein besonderer Dank geht an Herrn Prof. Dr. Andreas Gourmelon, der mir das sehr
spannende Thema vermittelte und mich stets mit Rat und Tat bei der Planung, Erhebung und
Auswertung des Projektes unterstützte. Danke für das Vertrauen, das gute Arbeitsklima, die
konstruktiven und schnellen Rückmeldungen und für die ständige Verfügbarkeit.
Großer Dank gilt auch Frau Dr. Doris Bender, die mich bei der gesamten Erstellung der
Diplomarbeit begleitete, sie nicht nur mit zündenden Einfällen bereicherte, sondern auch
immer mit konstruktiver Kritik zur Stelle war.
Für die Ermöglichung des Projektes möchte ich mich bei der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen bedanken.
Danken möchte ich auch Michael Wilfer und Anja Müller, die sich sehr viel Zeit für das
Gegenlesen meiner Arbeit genommen haben.
INHALT
Seite
EINLEITUNG
... 5
I THEORIE
... 8
1.
Kriterien des Studienerfolgs...8
1.1 Studiennoten...8
1.2 Praktikumsbeurteilungen...9
1.3 Studienzufriedenheit...10
2.
Prädiktoren des Studienerfolgs...12
2.1 Persönlichkeitsmerkmale...14
2.1.1 Extraversion...15
2.1.2 Gewissenhaftigkeit...18
2.1.3 Neurotizismus...23
2.1.4 Offenheit für neue Erfahrung... 26
2.1.5 Verträglichkeit...29
2.1.6 Soziale Kompetenz...31
2.2 Kognitive Fähigkeiten...33
2.3 Motiv- und Interessensdispositionen...41
2.4 Biographische Merkmale... 46
3.
Hypothesen...51
II
METHODE
... 55
1.
Rahmenbedingungen der Studie...55
2.
Darstellung des Studiendesigns...56
3. Vorgehen...
57
4.
Erhebungsinstrumente...58
4.1 Advanced Progressive Matrices (APM)...59
4.2 Intelligenz-Struktur-Analyse (ISA)...60
4.3 Arbeitshaltung (AHA)...62
4.4 Potenzialanalyse für das Management (PAM)...64
4.5 Skalen zur Service- und Kundenorientierung (SKASUK)...66
4.6 Leistungsmotivationsinventar Kurzversion (LMI-K)... 68
4.7 Fragen zur Berufswahlmotivation...69
4.8 Biographische Fragen (Zeitpunkt 1)...71
4.9 Biographische Fragen (Zeitpunkt 2)...72
4.10 Zwischenprüfung...73
4.11 Praktikumsbeurteilung...74
4.12 Fragen zur Studienzufriedenheit...75
5.
Stichprobenbeschreibung...76
6.
Beschreibung der Ausfälle und Abbrecher...77
7.
Hypothesen (operationalisiert)... 78
III ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
... 84
1.
Vorhersage des Studienerfolgs...84
1.1 Globalmodell... 85
1.2 Notenreduziertes Modell... 94
1.3 Eignungsdiagnostisches Modell...98
1.4 Zusammenfassung...101
2.
Studienerfolgsunterschiede aufgrund verschiedener Berufswahlmotive...102
IV DISKUSSION
...106
1.
Vorhersage des Studienerfolgs...107
1.1 Globalmodell...107
1.2 Notenreduziertes Modell...113
1.3 Eignungsdiagnostisches Modell...115
2.
Studienerfolgsunterschiede aufgrund verschiedener Berufswahlmotive...116
V
AUSBLICK
...118
VI ZUSAMMENFASSUNG
...120
LITERATURVERZEICHNIS
...123
ANHANG
...130
Einleitung
5
EINLEITUNG
Heutzutage werden Hochschulen mit einer großen Zahl von Bewerbern bei einer
gleichzeitig geringen Zahl von Studiumsplätzen konfrontiert. Es ist verständlich, dass
sie darauf mit bestimmten Auswahlprozeduren reagieren. Traditionell basieren diese
Auswahlkriterien auf vorausgehenden schulischen Leistungen wie Abiturnoten. Noch
immer geschieht die Vergabe der meisten Studienplätze aufgrund eines Numerus
Clausus. Nur ab einem bestimmten Notendurchschnitt wird man für einen Studiengang
zugelassen. Allerdings beschränken sich die Auswahlverfahren meistens allein auf die
Note. Andere Fähigkeiten, die für ein spezielles Studienfach von gleicher oder
größerem Interesse sind, werden nicht abgefragt. Dabei konnte vielfach festgestellt
werden, dass kognitive Variablen gute Prädiktoren für den akademischen und
beruflichen Erfolg bilden. Neben kognitiven Variablen gelten auch
Persönlichkeitsmerkmale als valide Variablen für die Personalauswahl (Schmidt &
Hunter, 1998a; Sternberg & Kaufmann, 1998). Trotz der eindeutigen Belege gibt es
bisher kaum universitäre Auswahlprozesse, die dem aktuellen Forschungsstand
Rechnung tragen. Die Auswahl der hier beschriebenen Untersuchungsgruppe
Studierende der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) erfolgt durch die
Kommunen. Jeder Kommune obliegt es dabei in eigener Verantwortung, den
Ausleseprozess durchzuführen. In der Prüfungsordnung der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (§ 3 (2) VAPgD, 2001, S. 1) wird
ausdrücklich auf die wissenschaftliche Anforderung der kommunalen
Auswahlverfahren hingewiesen: ,,Die Auswahlmethode bestimmt bei Bewerberinnen
oder Bewerbern für den Landesdienst die oberste Dienstbehörde, im übrigen die
Einstellungskörperschaft unter Berücksichtigung der in Wissenschaft und Praxis sich
fortentwickelnden Erkenntnisse über Personalausleseverfahren. Die Auswahlmethode
muss für Bewerberinnen oder Bewerber desselben Zulassungstermins gleich bleiben."
Jedoch darf bezweifelt werden, ob die uneinheitliche Auswahlprozedur der Kommunen
den aktuellen wissenschaftlichen Standards der Personalauslese standhält.
Die Arbeit soll daher dazu dienen, das bisherige Auswahlverfahren der Kommunen für
das Studium der Verwaltungswissenschaft zu optimieren und dadurch die Passung der
Studenten für das Fach der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Hierbei spielt der
Person-Environment-Fit-Ansatz (Caplan, 1987; French, Caplan & Harrison, 1982) eine
Einleitung
6
wichtige Rolle. Dabei geht man davon aus, dass die Passung von Personenmerkmalen
und Umweltanforderungen für die Entstehung von Arbeitsstress entscheidend ist.
Arbeitsstress tritt vor allem dann im Studium auf, wenn die Fähigkeiten der Person mit
den an sie gestellten Anforderungen der Hochschule nicht korrespondieren. Dadurch
entsteht Über- oder Unterforderung und es kommt zu einem erhöhten Studienabbruch
bzw. Verschlechterung der Studiennote (Amelang, 1997). Die Notwendigkeit der
Passung zwischen Personenmerkmalen und den Hochschulanforderungen für die
Studienzufriedenheit wurde schon mehrfach bestätigt (Heise, Westermann, Spies &
Schiffler, 1997b; Spies, Westermann, Heise & Hagen, 1998). Die Arbeit dient demnach
dazu, Anregungen für die Entwicklung eines validen Auswahlverfahrens unter
Einbezug wirksamer Prädiktoren zu geben und dadurch den Studienerfolg an der
Fachhochschule zu verbessern. Die Informationen aus einem Auswahlprozess können
dann zur Optimierung der Entscheidungsprozesse sowohl für den Bewerber als auch für
die Fachhochschule bzw. Kommunen verwendet werden. Dadurch können negative
Folgen sowohl für Studenten wie auch für die Hochschule und den Arbeitgeber
reduziert werden. Angesichts der Tatsache, dass zur Zeit nur 67 bis 73% der
Studienanfänger in Deutschland an einer Fachhochschule ihr Studium erfolgreich
beenden, können die negativen Folgen nicht ernst genug genommen werden (Hörner,
1999).
Die vorliegende Arbeit baut auf diesen Erkenntnissen auf und versucht anhand bereits
verifizierter, aber auch anhand noch nicht ausreichend validierter Variablen den
Studienerfolg vorherzusagen. Die Untersuchung beschäftigt sich insbesondere mit
Determinanten des Studienerfolgs bei Studenten der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung. Sie hat das Ziel, maßgebliche Einflussvariablen für den Erfolg in diesem
Studium nachzuweisen. Studienerfolg soll dabei an folgenden Kriterien festgemacht
werden: Zwischenprüfungsnoten, Praktikumsbeurteilungen und Studienzufriedenheit.
Als Prädiktoren werden grundlegende Merkmale der Persönlichkeit
(Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Fähigkeiten, Interessens- und
Motivdispositionen) sowie biographische Merkmale herangezogen.
Teil I stellt den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Zuerst wird ein Überblick
über die Kriterien des Studienerfolgs gegeben (I-1). Danach werden valide Prädiktoren
des Studienerfolgs diskutiert (I-2). Hierbei werden die drei Hauptmerkmale der
Einleitung
7
Persönlichkeit (Persönlichkeitseigenschaften, kognitive Fähigkeiten, Interessens- und
Motivdispositionen) behandelt. Im Anschluss werden erfolgsrelevante biographische
Merkmale vorgestellt. Im Kapitel I-3 werden die Hypothesen zum methodischen Teil
zusammengefasst.
Teil II dieser Arbeit befasst sich mit der Methode der Untersuchung. Hier werden die
Rahmenbedingungen (II-1), das Studiendesign (II-2) und das Vorgehen (II-3)
vorgestellt. Anschließend erfolgt die Darstellung der Erhebungsinstrumente (II-4). In
Kapitel II-5 und II-6 wird die Stichprobe sowie die Teilnehmer beschrieben, die die
Teilnahme verweigert haben. Dieser Teil endet mit der Operationalisierung und
Spezifizierung der unter I-3 aufgestellten Hypothesen unter Bezugnahme des
Studiendesigns und der Erhebungsinstrumente.
In Teil III der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt.
Diese befassen sich mit der Vorhersage des Studienerfolgs im Globalmodell (III-1.1),
im notenreduzierten Modell (III-1.2) und im eignungsdiagnostischen Modell (III-1.3).
Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst (III-1.4). Im letzten
Abschnitt werden noch die Studienerfolgsunterschiede aufgrund verschiedener
Berufswahlmotive berichtet (III-2).
Im Teil IV werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei geht es um die Vorhersage des
Studienerfolgs im Globalmodell (IV-1.1), im notenreduzierten Modell (IV-1.2) sowie
im eignungsdiagnostischen Modell (IV-1.3) und um die Studienerfolgsunterschiede
aufgrund verschiedener Berufswahlmotive (IV-2).
Teil V gibt einen abschließenden Ausblick. Teil VI fasst die vorliegende Arbeit noch
einmal zusammen. Des Weiteren folgen Literaturverzeichnis und Anhang.
Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Lesbarkeit auf die maskuline
Formulierung zurückgegriffen wird; hier sind selbstverständlich immer beide
Geschlechter gemeint.
Einleitung
8
I
THEORIE
1.
Kriterien des Studienerfolgs
1.1 Studiennoten
Studiennoten werden am häufigsten zur Bestimmung des Studienerfolgs herangezogen.
(Schuler, 1998). Sie sind quantitativ abgestuft, verfügen über fachspezifische
Prädiktionskraft für die Arbeitsmarktchancen und haben daher für den potentiellen
Arbeitgeber eine diagnostische Funktion (Gold & Souvignier, 1997). Sie gelten daher
als ein inhaltlich valides Maß des Studienerfolgs. Um aber beurteilen zu können, ob
Noten einen diagnostischen Wert haben, müssen wir die Zielvariable an den
Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität messen.
Noten im Studium sollen vor allem die Wissens- und Fähigkeitsbereiche messen, die im
Lehrplan vorgeschrieben sind. Durch die Dauer einer Prüfung und die Zahl der Themen
kann jedoch die Validität stark eingeschränkt werden. Werden z.B. drei Themen in 20
Minuten abgefragt, kann man nicht von einem gültigen Ergebnis sprechen, da
bestenfalls 10% des Wissens eines Studenten zur Beantwortung der Fragen relevant
war. Es liegt keine repräsentative Stichprobe von Prüfungsthemen und damit auch kein
valides Messinstrument vor.
Die Stabilität (Reliabilität) von Noten ist im Allgemeinen sehr hoch. Wong und
Csikszentmihalyi (1991) berichteten bei 195 Studenten eine Korrelation von r = .91
zwischen den Durchschnittsnoten aus dem ersten und zweiten Studienjahr. Die
Reliabilität von Noten ist dann hoch, wenn man als Kriterium den Durchschnitt aus
mehreren Prüfungen nimmt. Brandstätter und Farthoffer (2002) berechnete eine
durchschnittliche Korrelation bei 1024 Personen über zwei verschiedene Prüfungen im
Studium von r = .28. Die Reliabilität erhöhte sich jedoch bei einem Notendurchschnitt
über 35 Prüfungen drastisch auf r = .93. Man muss jedoch zu bedenken geben, dass es
nur wenige Studien gibt, deren Kriterium Notendurchschnitt aus einer so hohen Anzahl
von Einzelprüfungen besteht.
Theorie: Kriterien des Studienerfolgs
9
Es hat sich bei der Objektivität gezeigt, dass die gleiche Leistung von unterschiedlichen
Lehrkräften unterschiedlich benotet wird. Sogar dieselbe Lehrkraft kommt oftmals nicht
zum selben Urteil, wenn sie dieselbe Arbeit einige Wochen später beurteilt. Jedoch gibt
es bei der Interrater-Reliabilität eine hohe Übereinstimmung im Ranking der Arbeiten (r
= .80). D.h. bessere Arbeiten werden generell besser bewertet, schlechtere Arbeiten
schlechter. Die grundlegende Schwäche von Noten ist ihre mangelnde Vergleichbarkeit,
da Lehrkräfte immer einen klasseninternen Maßstab verwenden. Dementsprechend ist
die Korrelation zwischen Noten verschiedener Leistungstests innerhalb von Klassen
hoch (r = .70), über Klassen hinweg aber niedrig (r = .30). Daher ist es auch nicht
sinnvoll, Ergebnisse unterschiedlicher Universitäten miteinander zu vergleichen
(Kornadt, 1978). Hornbostel und Daniel (1996) hatten die Durchschnittsnoten an
verschiedenen Fachbereichen der Soziologie genauer untersucht und festgestellt, dass
an einigen Hochschulen (z.B. der FU Berlin) ein extrem guter Notenschnitt erwartet
wird, obwohl es sonst keine Hinweise für eine besondere Motivation gibt. Auch zu der
Vermutung, dass die Studierenden an der FU Berlin sich durch besondere Fähigkeiten
auszeichnen (z.B. durch höhere Durchschnittsnote im Abitur oder in den
Aufnahmeprüfungen), gab es keinen Anlass. Deshalb wurde der hohe Notenschnitt auf
eine unterschiedliche Praxis der Notenvergabe durch die Lehrenden zurückgeführt.
Ähnliche enorme Unterschiede in der Praxis der Notenvergabe sind auch immer wieder
in anderen Fächern zu beobachten.
Insgesamt gilt die Studiennote als valide, reliabel und objektiv, wenn man mehrere
Messungen zu einer Durchschnittsnote zusammenfasst und die Noten nur innerhalb
einer universitären, fachlichen Einrichtung vergleicht.
1.2 Praktikumsbeurteilungen
Praktikumsbeurteilungen, die vor allem berufsqualifizierende Kompetenzen wie
Teamfähigkeit, Führungsqualifikation messen sollen, wurden als Indikator für den
Studienerfolg in bisherigen Untersuchungen kaum verwendet. Dies ist sehr zu
bemängeln, da es als das zentrale Kriterium für den Studienerfolg gelten sollte. Das
Studium sollte nicht für das Studium qualifizieren, sondern für den später zu
erwartenden Beruf ausbilden. Da Praktikumsbeurteilungen die Geeignetheit für einen
Theorie: Kriterien des Studienerfolgs
10
Beruf beurteilen sollen, ist das Kriterium der Berufseignung zentral. Entsprechend der
Gleichsetzung ,,geeignet ist gleich erfolgreich", lässt sich Eignung durch folgende
Kriterien definieren:
1. Output bzw. Produktivität des Mitarbeiters
2. Beurteilung durch den Vorgesetzten, z.B. in Form von Arbeitszeugnissen
3. die Anzahl der Beförderungen in einem bestimmten Zeitraum
4. die durchschnittliche Dauer bis zur nächsten Beförderung
5. Höhe des Gehalts
6. Arbeitsproben
Innerhalb dieser Kriterienmaße können noch subjektive und objektive Kriterien
unterschieden werden. Das objektive Kriterium Produktivitätsdaten wies in einer
Untersuchung von Hunter, Schmidt und Judiesch (1990) eine mittlere Retest-Reliabilität
von r = .92 auf und das subjektive Kriterium Leistungsbeurteilungen eine von r = .52
auf (Rothstein, 1990). Im Allgemeinen gelten subjektive Kriterien wie
Vorgesetztenurteile als weniger reliabel. Daher können auch Vorgesetztenurteile
schlechter vorhergesagt werden wie Produktivitätskennzahlen oder Arbeitsproben eines
Mitarbeiters (Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch, 1984).
1.3 Studienzufriedenheit
Die Studienzufriedenheit wird selten als ein Erfolgskriterium herangezogen. In der
Regel gilt diese Befindlichkeit als ein Korrelat individueller Anpassungs- und
Regulationskompetenzen und wird daher als Passung zwischen Ist- und Soll-Werten
verstanden (Gold et al., 1997; Heise, Westermann, Spies & Schiffler, 1997a; Heise et
al.,1997b; Westermann et al., 1996). Nach der Person-Job-Fit-Theorie (Weinert, 1998)
geht man davon aus, dass die Zufriedenheit zunimmt, wenn die Diskrepanz zwischen
Ist- und Soll-Werten abnimmt. Entscheidend ist dabei nicht die objektive, sondern die
subjektiv wahrgenommene Passung von Ist- und Soll-Wert. Die Umwelt stellt
bestimmte Anforderungen (Soll-Werte), denen die Person in Abhängigkeit von ihren
Fähigkeiten (Ist-Werte) mehr oder weniger entsprechen kann. Weiter hat die Person
bestimmte Bedürfnisse (Soll-Werte), die durch die Chancen der Umwelt (Ist-Werte)
mehr oder weniger gut befriedigt werden. Die Passung zwischen Ist- und Soll-Wert
wird somit in zwei Dimensionen beschrieben (siehe Abbildung I-1):
Theorie: Kriterien des Studienerfolgs
11
1. Forderung der Umwelt vs. Fähigkeiten der Person
2. Bedürfnisse der Person vs. Chancen der Umwelt
Abbildung I-1: Person-Job-Fit-Modell (nach Weinert, 1998, S. 121)
Person-Job-Fit-Modell
Passung von Person und Arbeitsumwelt
Erwartungen, Bedürfnisse und Werte
der Person
Umstände, Gelegenheiten, Chancen aus
der Umwelt (zur Erfüllung der
Erwartungen/Bedürfnisse)
Forderungen der Umwelt
Fähigkeiten und Möglichkeit der
Person, um diese zu erfüllen
Die Person-Job-Fit-Theorie kann auch auf die Universität übertragen werden.
Entsprechend kann zum einen die subjektiv empfundene Diskrepanz zwischen den
Bedürfnissen der Studierenden und den Angeboten der Universität und zum anderen die
erlebte Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten der Studierenden und den Anforderungen,
die im Rahmen des Studiums an sie gestellt werden, als Ursache für
Studienunzufriedenheit betrachtet werden.
Analysen zur Struktur von Studienzufriedenheit deuten auf drei allgemeine
Komponenten hin, die durch drei Skalen erfasst werden können (Westermann, 1996):
1. Zufriedenheit mit den Studieninhalten
2. Zufriedenheit mit den Studienbedingungen
3. Zufriedenheit mit der Bewältigung der Studien- und Lebensbelastungen
Theorie: Kriterien des Studienerfolgs
12
Die Validitäten der drei Faktoren können als gut bezeichnet werden, da sie das
Kriterium von H = .50 des Homogenitätsindex einer eindimensionalen Skala erreichten.
Die Reliabilitätsschätzungen (Cronbachs ) der drei Skalen lagen zwischen .71 und .89.
Die drei gebildeten Skalen besitzen damit auch eine valide und zuverlässige Schätzung
der drei Zufriedenheitskomponenten.
2. Prädiktoren des Studienerfolgs
Schneewind (2000, S. 236) definiert die Struktur der Persönlichkeit folgendermaßen:
,,Die Struktur der individuellen Persönlichkeit ist das zu jedem Entwicklungszeitpunkt
eines bestimmten menschlichen Individuums einzigartige Gesamtsystem seiner
grundlegenden physischen und psychischen Merkmale, seiner charakteristischen
Anpassungsweisen in der Auseinandersetzung mit personeninternen und
personenexternen Gegebenheiten und seines Selbst- und Welterlebens." Zu den drei
grundlegenden physischen und psychischen Merkmalen zählen nach Schneewind
(2000):
1. Persönlichkeitsmerkmale
Darunter versteht man die wesentlichen Charaktereigenschaften einer Person. Das
bisher bekannteste Persönlichkeitsmodell stellen die Big Five Persönlichkeitsfaktoren
(Amelang & Bartussek, 1997) dar. In diesem Modell wird die generelle Persönlichkeit
auf den fünf Dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Gewissenhaftigkeit,
Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrung beschrieben.
2. Kognitive Fähigkeiten
Unter kognitiven Fähigkeiten werden vor allem die Intelligenz und die
Konzentrationsfähigkeit einer Person subsumiert. Ein verbreitetes Intelligenzmodell
geht auf Thurstone (1947) zurück, der Intelligenz in die Primärfaktoren
schlussfolgerndes Denken, verbales Verständnis, Wortflüssigkeit, numerisches Denken,
figurales Denken, Merkfähigkeit und Wahrnehmungsgeschwindigkeit unterteilte.
3. Motiv- und Interessensdispositionen
Motivierungsdispositionen sind Präferenzen für bestimmte Zielzustände. Neben
Leistungs-motiv unterscheidet man häufig noch nach Anschlussmotiv oder Machtmotiv
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
13
(McClelland, 1985). Interessensdispositionen bezeichnet man als Einstellungen zu
unterschiedlichsten Objekten wie Tätigkeiten, Erlebnissen, Personen oder
Lebensbereichen (Krapp, 1992).
Die interindividuellen Ausprägungen der Persönlichkeit bestimmen wiederum die
charakteristischen Anpassungsweisen einer Person in herausfordernden Situationen.
Schneewind (2000) unterscheidet sechs Klassen von Anpassungsprozessen einer
Persönlichkeit, die je nach Charakteristik einer Situation bestimmte Prozesse
erforderlich machen:
1. Informationsverarbeitungsprozesse,
2. Bewältigungsprozesse,
3. volitionale Prozesse,
4. Emotionsregulationsprozesse,
5. interpersonale Prozesse,
6. Identitätsbildungsprozesse.
Das Studium bietet für jede Person zahlreiche Situationen, die nur durch bestimmte
Anpassungsprozesse bewältigt werden können. Ob eine Person die erforderlichen
situativen Anpassungsprozesse mitbringt, hängt von seiner spezifischen
Persönlichkeitsstruktur ab. Je nach Studiengang und Prüfungssituationen werden dabei
unterschiedliche Prozesse eine Rolle spielen. Bei Referaten oder mündlichen Prüfungen
werden vor allem interpersonale Prozesse wie die Kommunikationsfähigkeit und
Emotionsregulationsprozesse von größerer Bedeutung sein. Bei der Emotionsregulation
ist vor allem die Angstregulationsfähigkeit wichtig, um Stress in Leistung und nicht in
Denkblockaden umzuwandeln. Bei der Wahl und Durchführung eines Studiums werden
andererseits Identitätsbildungsprozesse wie z.B. die Zielsetzungsfähigkeit und
volitionale Prozesse wie z.B. die Handlungsinitiierungsfähigkeit von größerem Gewicht
sein. Andererseits erfordern gerade die praxisorientierten Studiengänge an der
Fachhochschule Informationsverarbeitungsprozesse, die den schnellen Erwerb eines
prozeduralen Wissens (Handlungswissen) ermöglichen. Letztlich sind bei
außeruniversitären Belastungen wie Partnerschaftsprobleme während des Studiums
Bewältigungsprozesse wie problem- und emotionsfokussierte Formen der
Belastungsbewältigung unabdingbar. Aufgrund gewisser studienbedingten
Voraussetzungen werden je nach erforderlicher Anpassungsprozesse während eines
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
14
Studiums auch nur ganz spezifische Konfigurationen der Persönlichkeit für den
Studienerfolg förderlich sein.
Entsprechend der oben skizzierten Dreiteilung der Persönlichkeit in
Persönlichkeitsmerkmale (siehe I-2.1), kognitive Fähigkeiten (siehe I-2.2) und Motiv-
und Interessensdispositionen (siehe I-2.3) werden in den Abschnitten I-2.1 bis I-2.3 die
bisherigen empirischen Befunde zur prädiktiven Qualität dieser Merkmale für den
Studienerfolg zusammengefasst. Darüber hinaus soll in I-2.4 noch auf biographische
Merkmale als mögliche Einflussquelle für die Studienleistung eingegangen werden. Die
ausgewählten Prädiktoren werden dabei bzgl. ihrer prognostischen Validität für die
Studienerfolgskriterien Studiennote, Praktikumsbeurteilung und Studienzufriedenheit
untersucht. Da es kaum Studien zur direkten Vorhersage relevanter Merkmale auf die
Praktikumsbeurteilung im Studium gibt, beziehen sich im Folgenden die untersuchten
Merkmale auf die Prognose beruflicher Leistungen. Daher ist es aufgrund der gleichen
Inhaltsvalidität von Berufsleistung und Praktikumsleistung sinnvoll, Untersuchungen
zum Kriterium Berufserfolg heranzuziehen.
2.1 Persönlichkeitsmerkmale
Nach Eysenck (1992) erzeugen Persönlichkeitsmerkmale interindividuelle
Unterschiede, in der Weise Studenten lernen, sich zu motivieren, sich in
Arbeitssituationen zu verhalten oder wie sie auf bestimmte Lehrmethoden reagieren.
Für die Beurteilung von Studienerfolg scheint die Persönlichkeitseigenschaft daher noch
eine wichtigere Rolle als die Intelligenz einer Person zu spielen (Eysenck, 1992). Aus
diesen Gründen haben viele Studien, die den Auswahlprozess von Studenten
evaluierten, auf die Persönlichkeitsmerkmale als Indikator für den akademischen Erfolg
fokussiert. In der Forschung spielen die so genannten Big Five die vorherrschende
Rolle. Dieses Modell hat den Anspruch, die Persönlichkeit ökonomisch abzubilden. Das
Konstrukt geht hauptsächlich auf Jung (1972) zurück, war aber auch Gegenstand
späterer Untersuchungen. In der heutigen Persönlichkeitsforschung hat es seinen festen
Platz als eine der fünf großen Persönlichkeitsmerkmale (Costa & McCrae, 1992).
Obwohl es während den letzten Jahrzehnten verschiedene Versuche gab, die fünf
Faktoren unterschiedlich zu benennen, hat sich weitgehend das Modell von Costa et al.
(1992) mit den Faktoren Neurotizismus, Extraversion, Gewissenhaftigkeit,
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
15
Verträglichkeit, und Offenheit für neue Erfahrung durchgesetzt. Im amerikanischen
Sprachraum gibt es inzwischen etwa sieben verschiedene Inventare - sehr ausführliche
und sehr kurze Versionen, Adjektivlisten und Sätze - zur Erfassung der fünf
Faktoren. Ebenso ist im amerikanischen Sprachraum bereits seit Jahren ein erheblich
verfeinertes Instrument der Big Five in Gebrauch, der NEO-PI-R von Costa et al.
(1992), der mit 240 Fragen jeweils sechs Facetten eines einzelnen Faktors misst, also 30
Facetten insgesamt. Aufgrund ihrer starken Dominanz in der Forschung werden im
folgenden Argumentationsverlauf zuerst die einflussreichsten Big Five Faktoren für das
Studium erläutert.
Dabei werden ihre Facetten näher beschrieben. Die Etikettierung und
Interpretation der Faktoren und ihrer Facetten werden in Anlehnung an die deutsche
Version des NEO-PI-R (Angleitner & Ostendorf, 2003) formuliert. Anschließend wird
das Persönlichkeitskonstrukt Soziale Kompetenz beschrieben, das nicht zu den Big Five
Faktoren zählt, jedoch in einzelnen Studien Beachtung bzgl. seiner prädiktiven Qualität
fand.
2.1.1 Extraversion
Extraversion hat mit der Zahl von Beziehungen zu tun, mit der sich jemand gut fühlt.
Extravertierte Menschen neigen dazu, sich in Gesellschaft stärker zu exponieren, sie
reden mehr und gehen mehr aus sich heraus. Extravertierte mögen Menschen und
Menschenansammlungen. Sie sind darüber hinaus selbstbewusst, aktiv, gesprächig,
energisch und optimistisch. Sie lieben Aufregung und Anregung und neigen zu einem
heiteren Naturell. Der Globalfaktor Extraversion besteht aus den 6 Primärfaktoren
(Facetten) Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungskraft, Aktivität, Erlebnishunger und
Fröhlichkeit (siehe Tabelle I-1).
Tabelle I-1: Facetten von Extraversion
6 Facetten von
Extraversion
Introvertiert
Extravertiert
Herzlichkeit
reserviert, formal
herzlich, freundlich,
vertraulich
Geselligkeit
sucht selten Gesellschaft
gesellig, zieht Begleitung
vor
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
16
Durchsetzungskraft
bleibt im Hintergrund
bestimmt, spricht
vernehmlich, führt
Aktivität
geruhsame Gangart
kraftvolles Tempo
Erlebnishunger
geringer Bedarf an
Aufregungen
Verlangen nach Erregung
Frohsinn
wenig überschwenglich
fröhlich, optimistisch
Introversion versteht sich als Gegenpol zu Extraversion.
Introversion sollte man jedoch
nach Meinung von Costa et al. (1992) eher als Fehlen von Extraversion statt das
Gegenteil zu Extraversion sehen. So sind Introvertierte eher zurückhaltend als
unfreundlich, eher geruhsam als träge, eher unabhängig als gefolgsam. Wenn sie sagen,
sie seien schüchtern, meinen sie in Wirklichkeit, dass sie es vorziehen, allein zu sein.
Introvertierte sind nicht notwendigerweise sozial ängstlich. Wenn ihnen auch nicht die
überschäumende Lebhaftigkeit des Extravertierten eigen ist, so sind Introvertierte doch
nicht unglücklich oder pessimistisch.
Bisherige Untersuchungen deuten darauf hin, dass Personen mit einer starken
Ausprägung des Merkmals Introversion tendenziell besser im Studium abschneiden als
extravertierte Personen. Exemplarisch werden nachfolgend wichtige Studien erläutert.
In einer groß angelegten Validitätsstudie (Brandstätter et al., 2002) mit 1024 Studenten
einer technisch-naturwissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen und sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde anhand der Adjektivliste 16PA 5
Sekundärfaktoren der Persönlichkeit und dazugehörige 16 Primärfaktoren erfragt. Die
Persönlichkeitsmerkmale wurden im Rahmen mehrerer Testverfahren erhoben, um den
Studienerfolg anhand eines Regressionsmodells zu validieren. Als Erfolgskriterium
wurde der Notendurchschnitt aus zwei zufällig herausgegriffenen Prüfungen im
Studium verwendet. Unter allen erhobenen Persönlichkeitsfaktoren wies Extraversion
als Gegenpol zu Introversion den höchsten partiellen Korrelationskoeffizienten (r = .26)
mit der Studienleistung auf. Sie fanden heraus, dass Extrovertierte substantiell
schlechtere Noten als Introvertierte erreichten. Die Autoren führen dies darauf zurück,
dass Extravertierte schneller durch leistungshemmende Reize abzulenken sind als
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
17
Introvertierte. Introvertierte scheinen dagegen eher die Fähigkeit zu haben, sich auf
einen leistungsfördernden Stimulus im Studium zu konzentrieren.
Eine andere Erklärung für die prädiktive Validität von Introvertierten lieferte Gallagher
(1996) in seiner Studie über die Beziehung zwischen Persönlichkeit, Copingstil und
akademischer Leistung. 364 männliche und weibliche Psychologiestudenten im ersten
Semester in den USA wurden zu diesem Zweck befragt. Der Persönlichkeitsfaktor
Introversion wurde mit dem Eysenck Personality Inventory (EPI) und der Copingstil mit
der Ways of Coping Checklist (WCCL) erhoben. Die besseren Examensnoten im ersten
Semester durch Introvertierte zeigte sich insbesondere in den Unterschieden ihres
Copingstils ,,Avoid Social Support". Introvertierte mieden eher die soziale
Unterstützung bei Problemen als Extrovertierte.
Diese Interpretation wird auch durch den Befund von Schwendewein (1980) bekräftigt.
64 Hauptfachpädagogen wurden 1976 bzgl. individualpsychologischer Merkmale mit
einem selbstkonstruierten Fragebogen getestet. Als Studienerfolgskriterium wurde der
erfolgreiche Abschluss von Proseminaren und Vorlesungen innerhalb eines
Studienjahres mit den Noten Sehr gut, Gut oder Mäßig definiert. Besonders auffällig
war der Zusammenhang zwischen sozialer Lernsituation der Studenten und ihrem
Studienerfolg. Personen mit isolierter Prüfungsvorbereitung hatten fast doppelt so
häufig das Erfolgskriterium erreicht als Personen mit gruppenspezifischer
Prüfungsvorbereitung.
Eindeutige Beziehungen fanden auch Sanchez, Rejano und Rodriguez (2001). 103
Studenten nahmen an der Studie teil. Extraversion wurde mit dem Persönlichkeitstest 16
PF gemessen. Die Studienleistung wurde in diesem Fall mit der Häufigkeit des
Nichtbestehens einer Prüfung in den belegten Kursen der Studenten gemessen.
Extravertierte scheiterten signifikant häufiger als Introvertierte.
Bezüglich der prädiktiven Validität von Introversion kommt Lievens und Coetsier
(2002) in einer Studie von 610 Medizin-Studenten zu kongruenten Ergebnissen. Werte
zur Introversion wurden mit dem NEO-PI-R ermittelt. Als Kriterienmaß diente die
Durchschnittsnote aus allen Kursen nach Abschluss des ersten Studienjahrs.
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
18
Extraversion korrelierte zwar nur geringfügig (r = -.10) mit der Note, jedoch zeigten
sich auch hier signifikante Zusammenhänge.
Dass nicht nur der Globalfaktor Extraversion negativ mit dem Studienerfolg korrelierte,
sondern in gleichem Maße seine Primärfaktoren konnte in der folgenden Untersuchung
bewiesen werden. In einer von wenigen Studien über Dominanzstreben, das in etwa
dem Primärfaktor Durchsetzungskraft von Extraversion entspricht, berichtet
Schwendenwein (1980) von 64 Hauptfachpädagogen, die unter anderem mit dem
Freiburger Persönlichkeits-Inventar getestet wurden. Die Personen wurden in
Nachgiebige, Normale und Durchsetzende kategorisiert. Es wurden drei Bereiche von
Studienerfolg definiert: mäßiger, guter und sehr guter Studienerfolg. Der
Kontigenzkoeffizient (Cccorr = .33) zeigte einen signifikanten Zusammenhang
zwischen nachgiebigen Personen und Studienerfolg. Durchsetzende Personen
verzeichneten häufiger mäßigen und guten Studienerfolg, Nachgiebige jedoch
signifikant häufiger sehr guten Studienerfolg. Interessanterweise konnte keine als
durchsetzend eingestuften Personen das Kriterium sehr guten Studienerfolg erreichen.
2.1.2 Gewissenhaftigkeit
Gewissenhaftigkeit, die oft auch mit Selbstkontrolle oder Normgebundenheit
gleichgesetzt wird, bezieht sich auf die Fähigkeit, eigene Antriebe und Impulse zu
kontrollieren, um persönliche und berufliche Ziele zu erreichen. Die dafür notwendige
Selbstkontrolle äußert sich im aktiven Prozess der Planung, Organisation und
Durchführung von Aufgaben. Der Globalfaktor Gewissenhaftigkeit kann weiter
unterteilt werden in die Subfaktoren: Kompetenz, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein,
Zielorientiertheit, Selbstdisziplin und Besonnenheit (siehe Tabelle I-2).
Fokussierende Personen kennzeichnet ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit. Dazu
gehören Menschen, die auf eine geringere Anzahl von Zielen fokussiert sind und die
Selbstdisziplin zeigen, die zur Zielerreichung notwendig ist. Sie zeigen eine hohe
Selbstkontrolle mit dem Resultat einer konsistenten Ausrichtung auf persönliche und
berufliche Ziele. Im Regelfall wird eine solche Person eine erfolgreiche Karriere
aufweisen. Wenn die Konzentration auf das Ziel zu extrem
ausfällt, mutiert der
entsprechende zum Workaholic.
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
19
Flexible Personen charakterisiert ein geringes Maß an Gewissenhaftigkeit. Das sind
Menschen, die eine große Zahl von Zielen verfolgen und die Ablenkbarkeit und
Spontaneität an den Tag legen, die mit diffuserem Fokussieren verbunden ist. Eine
flexible Person ist leichter ablenkbar, weniger fokussiert auf Ziele, hedonistischer und
lockerer, was die Konzentration auf Ziele anbetrifft. Sie wird von Gedanken,
Aktivitäten oder Personen, die gerade vorbeikommen, leicht von der Aufgabe
weggeführt, was bedeutet, dass sie ihre Impulse nur wenig kontrollieren können. Es ist
nicht so, dass sie weniger arbeiten als stärker fokussierte Menschen, aber ein deutlich
geringerer Anteil ihres gesamten Arbeitseinsatzes ist zielbestimmt. Diese flexible
Haltung fördert Kreativität insofern, als sie länger für äußere Reize offen bleibt, anstatt
die Aufgabe zu fokussieren und dadurch Äußeres auszublenden.
Tabelle I-2: Facetten von Gewissenhaftigkeit
6 Facetten von
Gewissenhaftigkeit
Flexibel-nachlässig
Fokussiert-pedantisch
Kompetenz
fühlt sich oft
unvorbereitet
fühlt sich fähig und
effektiv
Ordnungsliebe
unorganisiert,
unmethodisch
gut organisiert, gepflegt,
ordentlich
Pflichtbewusstsein
flüchtig, lässig mit
Verpflichtungen
bestimmt durch sein
Gewissen, zuverlässig
Leistungsstreben
geringes Bedürfnis nach
Erfolg
getrieben, Erfolg zu
haben
Selbstdisziplin
zögernd, zaudernd,
zerstreut
Fokus auf Fertigstellung
der Aufgaben
Besonnenheit
spontan, hastig
denkt sorgfältig vor dem
Handeln
Die nachfolgenden Untersuchungen berichten von der Bedeutsamkeit der
Persönlichkeitsdimension Gewissenhaftigkeit für den Studienerfolg.
Eine der aktuellsten Studien dazu stammt von Paunonen (2003). Die Untersuchung
fokussierte auf eine wiederholte Vorhersage mit drei verschiedenen Maßen der Big Five
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
20
(FF-NPQ, NEO-FFI, NEO-PI-R) anhand zweier verschiedener Stichproben von 276 und
142 Erstsemester-Psychologiestudenten. Als eines von mehreren Zielvariablen wurde
der Notendurchschnitt im Studium gemessen. Bemerkenswerterweise stellte sich über
alle drei Persönlichkeitsinventare und beiden Stichproben Gewissenhaftigkeit als der
höchste und zuverlässigste Prädiktor für den Studienerfolg heraus. Die Korrelationen
schwankten zwischen r = .13 und r = .27.
In einer älteren Studie kam Paunonen und Ashton (2001) bereits zu ähnlichen
Ergebnissen. Sie untersuchten 717 Personen mit der Personality Research Form (PRF).
Als akademisches Leistungsmaß wurde ein Mittelwert aus drei Examen während eines
psychologischen Kurses im zweiten Studienjahr herangezogen. Der Faktor
Gewissenhaftigkeit wurde dabei positiv durch die Subskalen Leistungsstreben
(achievement), kognitive Strukturiertheit (cognitive structure), Zielstrebigkeit
(desireability), Ausdauer (endurance), Ordnung (order) und negativ durch die Subskala
Impulsivität (impulsivity) erfasst. Insgesamt erwies sich der Faktor Gewissenhaftigkeit
als signifikant korrelierend mit den Examensnoten (r = .21). Interessanterweise war
jedoch die Subskala Leistungsstreben (Achievement) ein besserer Prädiktor für den
Erfolg im Examen (r = .26). Erwähnenswert ist noch das alle Primärfaktoren außer
Ordnung signifikant mit der Examensnote korrelierten: Ausdauer: r = .19, Impulsivität:
r = - .17, Zielstrebigkeit: r = .16, kognitive Strukturiertheit: r = .11. Auch dies zeigt, das
einzelne Primärfaktoren mindestens genauso gut das Kriterium vorhersagen können wie
sein Globalfaktor Gewissenhaftigkeit und man wichtige Informationen verlieren würde,
wenn man sich nur auf die Globalfaktoren konzentrieren würde.
Zu dem gleichen Ergebnis gelang auch Gray und Watson (2002). 334 Studenten füllten
den NEO PI-R zur Messung der Big Five aus. Zusätzlich wurden die aktuellen
Universitätsnoten als Leistungskriterium aufgezeichnet. Von allen
Persönlichkeitsfaktoren erwies sich der Faktor Gewissenhaftigkeit als dominant (r =
.36) für die Vorhersage der Studienleistung. Genauso dominant als Prädiktoren
erwiesen sich die sechs Facetten von Gewissenhaftigkeit. Unter allen signifikanten
Primärfaktoren zeigten sich Leistungsstreben (r = .39) und Selbstdisziplin (r = .36) als
herausragende Determinanten. Bei einer durchgeführten multiplen Regressionsanalyse
offenbarte sich Leistungsstreben unter allen sechs Facetten mit als stärkster Prädiktor
(R² = .15).
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
21
Ergebnisse zur Persönlichkeitsstruktur von erfolgreichen Studenten berichtet Wong und
Csikszentmihalyi (1991). 208 Studenten, die alle exzellente Noten hatten, nahmen an
einer vierjährigen Längsschnittstudie teil. Im ersten Jahr der Studie füllten die
Studenten die Personality Research Form (PRF) aus, mit der insgesamt 20 verschiedene
Persönlichkeitsmerkmale sowie die Big Five gemessen wurden. Die Studienleistung
wurde im zweiten Jahr aus allen während dem Jahr absolvierten Prüfungen sowie aus
dem Schweregrad der belegten Kurse ermittelt. Wie schon in den vorausgegangenen
Studien wies der Faktor Gewissenhaftigkeit, bezeichnet als Arbeitsorientierung, die
höchste Korrelation (r = .33) aller Persönlichkeitsvariablen aus. Gewissenhaftigkeit
setzte sich aus den Faktoren Leistungsmotivation, Ausdauer, kognitiver Strukturiertheit,
Ordnung und Impulsivität (negativ) zusammen. Darüber hinaus konnte festgestellt
werden, dass die ausgewählten erfolgreichen Studenten überdurchschnittlich hohe
Selbstsicherheits- und Konzentrationswerte hatten. Diese beiden Faktoren werden von
Csikszentmihalyi (1990) wiederum als Indikatoren für Flow postuliert, welches ein
Stadium ist, in dem die Fähigkeit einer Person mit der Herausforderung einer Aktivität
übereinstimmt.
In einer anderen Studie von Lievens et al. (2002), bestehend aus 610 Medizinstudenten,
wurden die Big Five mit den Studiennoten in Beziehung gesetzt. Bezüglich der
prädiktiven Validität war von allen fünf Faktoren Gewissenhaftigkeit mit Abstand am
wichtigsten. Die Korrelation zwischen Gewissenhaftigkeit und den Noten aus dem
ersten Studienjahr betrug r = .20. Die signifikante Korrelation von Gewissenhaftigkeit
unterstreicht die vorhergehenden Ergebnisse im Feld der akademischen Leistung.
In einer anderen aktuellen Studie konnte auch McIllroy und Bunting (2002) anhand
einer Regressionsanalyse den einzigartigen Beitrag von Gewissenhaftigkeit belegen.
219 Psychologiestudenten komplettierten verschiedene Persönlichkeitsmaße. Zur
Erfassung von Gewissenhaftigkeit wurden die entsprechenden Items aus dem 16 PF
verwendet. Ihre Antworten wurden bzgl. ihrer folgenden Examensleistung analysiert.
Insgesamt konnten durch drei Variablen 51% der Prüfungsleistungsvarianz
vorhergesagt werden. Als zweitstärkstes Betagewicht konnte direkt hinter der Variable
letzte Schulnote und vor der Persönlichkeitsvariable testirrelevante Gedanken das
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
22
Persönlichkeitsmaß Gewissenhaftigkeit in die Regressionsgleichung eingehen. Die
Korrelation zwischen Gewissenhaftigkeit und Testergebnisse betrug r = .35.
Gewissenhaftigkeit im Sinne von Normgebundenheit konnte auch Brandstätter et al.
(2002) als valides Vorhersagemaß ermitteln. Als Vorhersagekriterium wurden unter
anderem mittels der 16 PA die Big Five erfragt. Als Erfolgskriterium wurde auch der
Notendurchschnitt von 1024 Teilnehmern verwendet. Auch hier wurden partielle
Regressionskoeffizienten zur optimalen Prognose des Studienerfolgs berechnet. Dabei
erwies sich Normgebundenheit zwar nur in geringem Maße als förderlich. Dies
erklärten Sie aber damit, dass durch die übergeordnete Einnahme der Schulnote und des
kognitiven Leistungstests, übereinstimmende Varianzanteile mit Normgebundenheit
bereits in die Vorhersage eingingen. Eine zusätzliche Analyse zeigte, dass
Normgebundenheit über den Arbeitsstil und damit verbunden über die
Konzentrationsfähigkeit positiv auf die Studienleistung wirkt.
Die darauf folgenden Studien zeigen auch die Bedeutsamkeit der Variable
Gewissenhaftigkeit für die berufliche Leistung. Explizite Forschungen zur Beziehung
zwischen Personenmerkmalen und der Praktikumsbeurteilung in einem Studium sind
kaum vorhanden. Jedoch ist es aufgrund der Ähnlichkeit der Messung von Berufserfolg
sinnvoll, diesbezügliche Untersuchungen heranzuziehen.
Hinsichtlich der prognostischen Validität von Persönlichkeit für den Berufserfolg fand
eine groß angelegte Metaanalyse große Beachtung. Die Metaanalyse von Barrick und
Mount (1991) untersuchte die Beziehung zwischen den Big Five Dimensionen und
dreier Berufserfolgskriterien (Berufsleistung, Trainingsleistung, Personaldaten) für fünf
verschiedene Berufsgruppen. Insgesamt wurden 162 Stichproben aus 117 Studien mit
einer Gesamtstichprobe von 23.994 ausgewählt. Die Ergebnisse zeigten, dass
Gewissenhaftigkeit sowohl für alle Berufsgruppen wie auch über alle Kriterien ein
valider Prädiktor war. Die durchschnittliche Korrelation von r = .22 über alle
Berufsgruppen hinweg war die Höchste unter allen 5 Dimensionen. Barrick et al. (1991)
interpretierten dies damit, dass dieses Merkmal mit einem starken Ziel-,
Pflichtbewusstsein und starker Persistenz verbunden ist. Genauso interessant war, dass
subjektive Erfolgskriterien (Führungskraftrating) weit höher mit Gewissenhaftigkeit
zusammenhängen als mit objektiven Erfolgskriterien (Gehalt, Status etc.). Sie
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
23
begründen das mit der Empfänglichkeit von subjektiven Maßen auf die
Persönlichkeitswahrnehmung. Persönlichkeitswahrnehmung bezieht sich immer auf die
Stärke der Wertschätzung und den Status, die ihr die soziale Gruppe verleiht. Daher
beeinflusst die Persönlichkeit die Reputation einer Person und die wiederum die
Beurteilung der Leistung.
Nicht ganz so hohe und eindeutige Ergebnisse berichteten Tett, Jackson und Rothstein
(1991) in einer metaanalytischen Studie. Wie bei Barrick et al. (1991) wurden die Big
Five in Beziehung mit beruflicher Leistungsbeurteilung gebracht. Überraschenderweise
konnte Gewissenhaftigkeit nicht den höchsten Zusammenhang mit dem Kriterium
erzielen. Immerhin konnte noch eine gerade noch akzeptable Korrelation von r = .18
erreicht werden, der jedoch unter der mittleren Korrelation (r = .24) aller erhobenen
Persönlichkeitsmerkmale mit dem Kriterium lag.
Erste Befunde für den Einfluss von Arbeitsgewohnheit als konstruktähnliches Merkmal
von Gewissenhaftigkeit auf das Kriterium Studienzufriedenheit konnte Spies et al.
(1998) bekannt geben. 325 Studierende wurden einerseits bzgl. ihrer
Studienzufriedenheit und andererseits bzgl. ihrer Arbeitsgewohnheiten und anderen
Merkmalen befragt. Arbeitsgewohnheiten wurden mit dem Inventar zur Erfassung von
Lernstrategien im Studium (LIST) gemessen. Dieser umfasst Eigenschaften wie
Arbeitsplanung oder allgemeine Planung und Gestaltung des Lernens.
Studienzufriedenheit wurden mit drei Skalen operationalisiert: Studieninhalten,
Studienbedingungen und Bewältigung der Studienbelastung. Nach Durchführung einer
Regressionsanalyse erwies sich der Faktor Arbeitstechniken vor allem bzgl. der
Zufriedenheit mit den Studieninhalten als signifikant (Beta = .15). Dies konnte vor
allem im Fachbereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen
werden.
Eine Bedingungsanalyse des subjektiven Studienerfolgs bei Studienabbrechern und
Nichtabbrechern von Gold (1988) kam zu ähnlichen Ergebnissen wie Spies et al.
(1998). Gewöhnlich ist in der Einteilung in Studienabbrecher und Nichtabbrecher das
Konzept der Studienzufriedenheit impliziert, da Studienabbrecher aufgrund hoher
Studienunzufriedenheit abbrechen. 2129 Studenten wurden über den gesamten
Studienverlauf beobachtet. Darüber hinaus wurden 26 ausgewählte
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
24
Persönlichkeitsmerkmale erhoben. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen wurden
mit einer Diskriminanzanalyse dargestellt. Als hochdiskriminierende Variablen stellte
sich Leistungsmotivation, Fleiß und Konzentration heraus. All jene Variablen stehen in
enger Verbindung mit dem Konstrukt Gewissenhaftigkeit.
2.1.3 Neurotizismus
Diese Dimension erfasst die Unterschiede zwischen emotionaler Stabilität auf der einen
Seite und emotionaler Sensibilität oder Unausgeglichenheit auf der anderen. Der
Fachbegriff Neurotizismus sollte nicht so missverstanden werden, als ob der Faktor
psychische Störung impliziere. Der gemeinsame Kern der verschiedenen Aspekte oder
Facetten dieser Dimension liegt in der Art und Weise, wie Emotionen, vor allem
negative Emotionen, erlebt werden. Der Faktor umfasst die folgenden Facetten:
Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Entmutigung, Befangenheit, Impulsivität und Verletzlichkeit
(siehe Tabelle I-3).
Emotional Sensible kennzeichnen sich dadurch, dass sie mehr negative Gefühle als die
meisten Menschen erfahren und mit ihrem Leben deutlich weniger Zufriedenheit äußern
als andere. Sie sind leichter aus dem Gleichgewicht zu bringen, neigen mehr dazu,
erschüttert, betroffen, beschämt, ängstlich und traurig zu sein, weil sie negative
Gefühlszustände stärker wahrnehmen bzw. davon geradezu überwältigt werden können.
Emotional stabile Menschen erleben sich selbst als ausgeglichen, sind mit sich selbst
im Reinen, und geraten auch in Stresssituationen nicht aus der Fassung. Sie sind sicher,
widerstandsfähig und gewöhnlich entspannt, selbst unter belastenden Umständen. Nun
kann man nicht sagen, dass die eine Seite der Dimension nur negative, die andere nur
positive Seiten hätte. Personen, die nicht erschüttert werden können, haben, wenn man
so will, ein weniger reiches Gefühlsleben, und sie wirken daher auch auf andere häufig
unsensibel. Empfindsamkeit, das Teilen von Gefühlen, Mitbetroffensein setzt zunächst
einmal voraus, dass man Zugang zu den eigenen Emotionen hat. Sie benötigen daher
stärkere Reize, um aus dem Lot gebracht zu werden. Sie erfahren das Leben auf einer
stärker rationalen Ebene als die meisten um sie herum und wirken mitunter ziemlich
unzugänglich und unbeeindruckt auf andere.
Tabelle I-3: Facetten von Neurotizismus
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
25
6 Facetten von
Neurotizismus
Stabil
Sensibel
Ängstlichkeit
entspannt, ruhig
besorgt, beklommen
Reizbarkeit
gelassen, wird nicht
leicht ärgerlich
wird leicht ärgerlich
Entmutigung,
Depression
nicht leicht entmutigt
leicht entmutigt
Befangenheit,
Gehemmtheit
schwer in
Verlegenheit zu
bringen
wird leicht verlegen
Impulsivität
Bedürfniskontrolle
fällt leicht
leicht in Versuchung
zu führen
Verletzlichkeit
problemloser Umgang
mit Stress
Probleme, mit Stress
fertig zu werden
Eindeutige Beziehungen des Persönlichkeitsmaßes zu Studierenden, die im Studium
versagen, fanden Sanchez et al. (2001). Eine Stichprobe von 103 Studenten
beantwortete zur Erhebung von Neurotizismus den Persönlichkeitsfragebogen 16 PF.
Das Persönlichkeitsprofil wurde mit einer repräsentativen Studienpopulation verglichen.
Erfolgreiche Studenten offenbarten signifikant niedrigere Werte bei Neurotizismus.
Nicht erfolgreiche Studenten zeigten dagegen höhere Werte. Insbesondere zeichneten
sich erfolglose Personen innerhalb der Primärfaktoren des 16 PF durch eine höhere
Anspannung aus.
In einer anderen Studie belegte McIllroy et al. (2002), dass der Primärfaktor
Ängstlichkeit einen höheren Einfluss auf die Studienleistung hat als sein Globalfaktor
Neurotizismus. Ängstlichkeit, die mit den vier Faktoren Sorge, Erregung,
Körpersymptome und testirrelevante Gedanken des Revised Test Anxiety Scale bei 219
Studenten erfragt wurde, konnte als substantieller Erfolgshemmer bestätigt werden.
Insbesondere die beiden Faktoren Sorge (r = -.35) und testirrelevanten Gedanken (r = -
.35) zeigten eindeutige Beziehungen mit der Prüfungsleistung. Dies wiederum beweist,
dass vor allem kognitive Faktoren (Sorge, testirrelevante Gedanken) von Ängstlichkeit
negative Testergebnisse indizieren und damit den Studienerfolg gefährden.
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
26
Dass Neurotizismus nicht nur auf die Studiennoten, sondern auch auf den späteren
beruflichen Werdegang negativen Einfluss hat, enthüllte auch Tett et al. (1991) in einer
umfassenden Metaanalyse. Das Ziel der Studie bestand darin, die bisher teilweise
widersprüchlichen Ergebnisse über die Persönlichkeit und den Berufserfolg zu
systematisieren. Dazu wurden unter anderem als Prädiktorenmaß die Big Five erhoben.
Neurotizismus erwies sich als Risikomerkmal für berufliche Leistung. Neurotizismus
und Berufserfolg erzielten einen mittleren reliabilitätskorrigierten Zusammenhang von r
= -.22.
Bedeutsame Ergebnisse für emotionale Stabilität bzgl. der Studienzufriedenheit konnte
Spies et al. (1998) berichten. Es wurden zu diesem Zweck bei 325 Studierenden
mehrere Variablen erhoben. In diesem Fall wurde emotionale Stabilität durch das
Konstrukt psychische Stabilität unter anderem mit den Aspekten Frustrationstoleranz,
Aushalten von Belastungen, Prüfungsangst, Ambiguitätstoleranz und Selbstbewusstsein
gemessen. Das Kriterium Studienzufriedenheit wurden mit drei Skalen operationalisiert:
Studieninhalte, Studienbedingungen und Bewältigung der Studienbelastung. Nach
Durchführung einer Regressionsanalyse erwies sich der Faktor psychische Stabilität als
der mit Abstand beste Prädiktor. Die Beta-Koeffizienten reichten von .20 (Zufriedenheit
mit Studienbedingung) bis .48 (Zufriedenheit mit der Bewältigung der
Studienbelastung). Sie interpretierten es mit der ,,dicke Fell"-Theorie. Das heißt: Eine
geringe Irritierbarkeit und hohe psychische Belastbarkeit würde jemanden besser für das
Studium und gegen einen möglichen Studienabbruch wappnen.
Gold (1988) konnte ähnliche Ergebnisse für den subjektiven Studienerfolg berichten.
Die Einteilung in Studienabbrecher und Nichtabbrecher als Studienerfolgskriterium
impliziert das Konzept der Studienzufriedenheit. Von 2129 Studenten wurden 26
ausgewählte Persönlichkeitsmerkmale sowie deren Studienabbruch über den gesamten
Studienverlauf erhoben. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen wurde mit einer
Diskriminanzanalyse dargestellt. Als hochdiskriminierende Variablen stellte sich
Neurotizismus und Leistungsängstlichkeit heraus. Da Leistungsängstlichkeit stark mit
Neurotizismus korreliert, konnte konstatiert werden, dass neurotische Personen vor
allem leistungsängstlicher sind und dadurch auch signifikant unzufriedener in ihrem
Studium sind.
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
27
2.1.4 Offenheit für neue Erfahrung
Offenheit für neue Erfahrung bezieht sich auf die Anzahl der Interessen, von denen man
sich angezogen fühlt und die Tiefe, bis zu der man bzgl. solcher Interessen vordringt.
Die folgenden Facetten der Dimension unterscheiden sechs Aspekte oder Bereiche der
Erfahrung, in denen Personen mehr oder weniger große Offenheit zeigen können:
Fantasie, Ästhetik, Offenheit für Gefühle, Experimentierfreudigkeit, Ideen und
Liberalismus (siehe Tabelle I-4).
Der Explorative verfügt über eine breitere Streuung seiner Interessen, fühlt sich von
Neuigkeiten und Innovationen fasziniert, wird allgemein als liberal wahrgenommen und
äußert mehr Introspektion und Reflektion. Explorative sind nicht prinzipienlos, neigen
aber stärker dazu, neue Ansätze in Betracht zu ziehen. Sie sind wissbegierig,
intellektuell, theoretisch und kulturell interessiert, sind bereit bestehende Normen
kritisch zu hinterfragen und auf neuartige soziale, ethische und politische
Wertvorstellungen einzugehen. Sie verhalten sich häufig unkonventionell und erproben
neue Handlungsweisen.
Der Konservative hat ein engeres Interessensspektrum, wird als konventioneller und
traditionsbewusster wahrgenommen und fühlt sich mit Vertrautem, Bekanntem wohl.
Konservative müssen nicht notwendig autoritär sein. Sie ziehen Bekanntes und
Bewährtes dem Neuen vor, und ihre emotionalen Reaktionen sind eher gedämpft.
Tabelle I-4: Facetten von Offenheit für neue Erfahrung
6 Facetten von
Offenheit
Konservativ
Explorativ
Fantasie
beschäftigt mit dem
Hier und Jetzt
imaginativ,
tagträumerisch
Ästhetik
künstlerisch
uninteressiert
schätzt Kunst und
Schönheit
Offenheit für Gefühle
ignoriert Gefühle
schätzt Gefühle hoch
ein
Experimentierfreudigkeit
zieht Vertrautes vor
zieht Neues vor,
schätzt Vielfalt
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
28
Ideen
enger intellektueller
Fokus
breite intellektuelle
Neugier
Liberalismus
dogmatisch,
konservativ
offen für die
Infragestellung von
Werten
Die Forschungsbefunde des Big Five Faktors Offenheit für neue Erfahrung bzgl. seiner
prädiktiven Validität im Studium ist bisher nicht eindeutig belegt. Trotz der bisher
uneinheitlichen Darstellung in der Forschung gibt es zumindest Hinweise für deren
Relevanz. Eine der groß angelegtesten Studien dazu führte Paunonen et al. (2001) mit
717 Studenten durch. Wie schon in einigen vorausgegangenen Studien wurden hier
mittels des Fragebogens PRF die Persönlichkeitsvariablen erhoben. Als akademisches
Leistungsmaß wurde ein Mittelwert aus drei Examen während eines psychologischen
Kurses im zweiten Studienjahr herangezogen. Obwohl der Globalfaktor Offenheit für
neue Erfahrung mit dem Leistungsmaß nicht korrelierte, zeigten sich zumindest deren
Primärfaktoren teilweise hochsignifikant. Als bester Prädiktor erwies sich der Faktor
Intellektuelle Neugier (r = .23), der dem Primärfaktor Ideen entspricht. Auch dies zeigt,
wie wichtig einzelne Facetten einer Globaldimension für den Studienerfolg sind, auch
wenn der Globalfaktor nicht direkt zur Varianzaufklärung beiträgt.
Ein weiterer Beleg für die Wichtigkeit von Offenheit im Studium berichtet
Schwendenwein (1980). 64 Hauptfachpädagogen wurden bzgl. ihres Studienerfolgs
unter anderem mit dem Freiburger Persönlichkeits-Inventar getestet. Die Personen
wurden in Offene, Normale und Verschlossene kategorisiert. Es wurden drei Bereiche
von Studienerfolg definiert: mäßiger, guter und sehr guter Studienerfolg. Der
Kontigenzkoeffizient (Cccorr = .46) berichtete einen starken Zusammenhang zwischen
offenen Personen und Studienerfolg. Dominiert unter den verschlossenen Studenten
mäßiger, so überwiegt bei ausgesprochen Offenen guter und sehr guter Studienerfolg.
Zu dem gleichen Ergebnis gelang auch Gray et al. (2002). 334 Studenten füllten den
NEO PI-R zur Messung der Big Five aus. Zusätzlich wurden die aktuellen
Universitätsnoten als Leistungskriterium aufgezeichnet. Als zweitstärkster
Persönlichkeitsprädiktor erwies sich Offenheit für neue Erfahrungen. Insgesamt zeigte
sich ein Zusammenhang von r = .18 mit dem Kriterium.
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
29
Die Bedeutsamkeit von Offenheit auf dem beruflichen Sektor konnte in einer
umfassenden Metaanalyse von Tett et al. (1991) verifiziert werden. Auf der Basis von
494 Studien wurden acht Persönlichkeitsmerkmale mit dem Berufserfolg in
Zusammenhang gesetzt. Als zweitwichtigste Variable erwies sich Offenheit mit einer
reliabilitätskorrigierten Kriterienkorrelation von r = .27.
Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangen auch Barrick et al. (1991) in einer parallel
durchgeführten Metaanalyse. Hier wurden die Big Five Dimensionen mit drei
verschiedenen Berufserfolgskriterien (Berufsleistung, Trainingsleistung, Personaldaten)
in Beziehung gebracht. Gerade im Kriterium Trainingsleistung, das viel mit der
studienbezogenen Praktikumsleistung gemein hat, offenbart Offenheit seine
prognostische Güte. Barrick et al. (1991) deuten die Ergebnisse damit, dass offene
Personen wahrscheinlich eine positivere Einstellung gegenüber Lernerfahrungen haben.
Demzufolge identifiziert diese Eigenschaft Personen, die am meisten gewillt sind, sich
in Trainingserfahrungen zu engagieren und daher auch nützlich ist, die Personen
herauszufiltern, die vom Training individuell am meisten profitieren. Sie nehmen an,
dass Offenheit die Fähigkeit und die Motivation misst, zu lernen. Diese Annahme
unterstreichen sie mit dem Befund, dass Offenheit das Personenmerkmal ist, das die
höchste Korrelation (r = .30) mit kognitiver Fähigkeit aufweist (Costa et al., 1992).
2.1.5 Verträglichkeit
Verträglichkeit ist in erster Linie eine Dimension, die Verhaltenstendenzen und
Einstellungen im Bereich sozialer Beziehungen beschreibt. Insbesondere bezieht es sich
auf die Zahl der Quellen, von denen man seine Normen für richtiges Verhalten bezieht.
Menschen mit einem hohen Verträglichkeitswert beziehen ihre Verhaltensnormen aus
einer Vielzahl von Quellen wie z.B. vom Ehegatten, von einem Religionsführer, einem
Freund, dem Chef oder einem Popidol. Geringe Verträglichkeit beschreibt einen
Menschen, der im Extrem vielleicht nur seiner eigenen inneren Stimme folgt. Die
Primärfaktoren beziehen sich auf Vertrauen, Freimütigkeit, Altruismus, Kooperation,
Bescheidenheit und Mitgefühl (siehe Tabelle I-5).
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
30
Der Nachgiebige neigt dazu, seine persönlichen Bedürfnisse denen der Gruppe
unterzuordnen, also die Gruppennormen eher zu übernehmen als auf seinen
persönlichen Normen zu bestehen. Dem Nachgiebigen ist Harmonie in diesem Falle
wichtiger, als die anderen mit seiner persönlichen Sicht der Wahrheit zu missionieren.
Sie begegnen anderen mit Wohlwollen, sind bemüht, anderen zu helfen und sind
überzeugt, dass diese sich ebenso mit Hilfsbereitschaft revanchieren werden.
Tabelle I-5: Facetten von Verträglichkeit
6 Facetten von
Verträglichkeit
Antagonistisch
Nachgiebig
Vertrauen
zynisch, skeptisch
andere als aufrichtig
und wohlmeinend
sehen
Freimütigkeit, Moralität
vorsichtig, ist auf der
Hut
aufrichtig, freimütig,
offen
Altruismus
Abneigung dagegen,
hineingezogen zu
werden
hilft anderen gerne
Kooperation
aggressiv, kompetitiv
gibt im Konfliktfall auf,
fügt sich
Bescheidenheit
fühlt sich anderen
überlegen
zurückhaltend,
bescheiden
Mitgefühl
nüchtern, rational
mitfühlend, leicht
bewegt
Der Herausforderer (Antagonist) auf der anderen Seite ist stärker auf seine persönlichen
Normen und Bedürfnisse fokussiert als auf die der Gruppe. Er ist mehr damit
beschäftigt, Macht und Einfluss zu erlangen und auszuüben. Antagonistische Personen
sind egozentrisch, misstrauisch gegenüber den Motiven anderer Menschen, und neigen
eher zu Wettbewerbsverhalten als zu Kooperativität.
Obwohl es bei anderen Vorhersagekriterien wie z.B. beim Raucherverhalten eine
nachgewiesene negative Korrelation (Paunonen, 2003) mit Verträglichkeit existiert, gibt
es bisher nur schwache bis uneinheitliche Effektstärken für den Faktor Verträglichkeit
bzgl. des Studienerfolgs zu berichten. Jedoch soll hier auf eine kurze Darstellung von
wichtigen Studien nicht verzichtet werden. Gray et al. (2002) untersuchte 334 Studenten
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
31
mit den NEO PI-R zur Messung der Big Five. Zusätzlich wurden die aktuellen
Universitätsnoten als Leistungskriterium aufgezeichnet. Obwohl die Korrelation nur
gering ausfiel (r = .15), erreichte das Merkmal Verträglichkeit die Signifikanzgrenze.
Andere Befunde, die in die gleiche Richtung zeigen, berichtete King (1998) in einer
umfassenden Studie von 720 Studenten. Persönlichkeitsvariablen wurden mit dem
Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-II) abgefragt, der vor allem
Persönlichkeitsstörungen des DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders) erfasst. Als Zielvariableben wurden insgesamt drei Kriterien erhoben: 1.
Akademische Abschlussnote, 2. Anwesenheitshäufigkeit, 3. Kursnoten. Auffallend war,
dass vor allem die konstruktähnlichen Merkmale antisoziale (r = -.20) und passiv-
aggressive (r = -.18) Persönlichkeit negativ mit der akademischen Abschlussnote
korrelierten. Teilnehmer, die bei beiden Merkmalen zu der Hälfte mit einer hohen
Ausprägung gehörten, hatten ein dreifach höheres Risiko, zu den 10% der Schlechtesten
bei der Abschlussnote zu zählen. Erwähnenswert ist noch, dass die antisozialen
Personen die geringste Anwesenheitshäufigkeit im Studium aufwiesen. Insgesamt
erschienen sie nur 65% aller Zeiten.
Hinsichtlich der prognostischen Validität von Verträglichkeit für den Berufserfolg fand
die Metaanalyse von Tett et al. (1991) große Beachtung. Im Rahmen von 494 Studien,
97 Stichproben mit einer Gesamtpopulation von 13.521 Probanden wurden acht
verschiedene Persönlichkeitskonstrukte wie auch die Big Five Dimensionen auf die
Vorhersagbarkeit von Berufserfolg bewertet. Die Ergebnisse indizierten die Wichtigkeit
von Verträglichkeit bei erfolgreichen Personen im Beruf. Verträglichkeit erreichte die
mit Abstand größte mittlere Korrelation (r = .33) mit dem Kriterium Berufserfolg. Die
Korrelation wurde bzgl. der Prädiktoren- und Kriterienreliabilität korrigiert. Insgesamt
ergab sich über alle acht Persönlichkeitsmaße eine mittlere reliabilitätskorrigierte
Korrelation von r = .24, wobei nur drei Maße eine Korrelation von über r = .20 mit dem
Kriterium erreichten.
2.1.6 Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz, die auch oft mit sozialer Intelligenz beschrieben wird, ist ein
Sammelbegriff für Fähigkeiten, die ein erfolgreiches Bewältigen von täglichen
Theorie: Prädiktoren des Studienerfolgs
32
Interaktionen erlauben. Auch wenn bisher Einigkeit über die Existenz dieses
Persönlichkeitskonstrukts besteht, gibt es bisher keine empirisch hinreichend
abgesicherten Dimensionen des Konstrukts. Viele Autoren haben nur wenige Aspekte
der sozialen Intelligenz betrachtet. Greenspan (1992) versucht in seinem Modell der
sozialen Intelligenz die Aspekte aufzuschlüsseln. Nach dem Modell spaltet sich die
soziale Intelligenz in soziale Sensitivität (social sensitivity), soziales Verständnis (social
insight) und soziale Kommunikation (social communication).
Soziale Sensitivität beschreibt die Fähigkeit, in Situationen zwischenmenschliche
Hinweise richtig zu verstehen. Es besteht aus zwei Aspekten: ,,role taking" und ,,social
inference". Mit ,,role taking" ist gemeint, sich in andere hineinversetzen zu können, eine
Situation aus der Sicht eines anderen sehen zu können und sich so entsprechend zu
verhalten. Dieser Aspekt wird bei anderen Autoren oft mit ,,Egozentrik" beschrieben,
wenn er schlecht ausgebildet ist. ,,Social Inference" ist die Fähigkeit, über soziale
Hinweise auf eine Situation zu schließen, also aus dem, was der andere auf die eine oder
andere Art mitteilt, aus dem, was in der Situation passiert, richtig zu folgern.
Soziales Verständnis wird als die Fähigkeit definiert, über soziale Zusammenhänge und
Prozesse zu reflektieren. Diese Fähigkeit wird in drei Aspekte unterteilt: ,,social
comprehension" - die Fähigkeit über soziale Zusammenhänge nachzudenken,
,,psychological insight" die Fähigkeit über die Motivation und den Charakter anderer
nachzudenken und ,,moral judgement" die Fähigkeit über ethische Aspekte des
zwischenmenschlichen Verhaltens nachzudenken.
Soziale Kommunikation beschreibt die Fähigkeit, andere mit Absicht dazu zu bringen,
sich mit den Bedürfnissen einer Person auseinander zu setzen. Zwei Variablen
bestimmen diesen Aspekt: ,,referential communication" die Fähigkeit, anderen
Hinweise zu geben, so dass sie erkennen können, was eine Person sieht, denkt oder fühlt
und ,,social problem solving" die Fähigkeit sich mit Konflikten sinnvoll auseinander
zu setzen.
Obwohl es zur Vorhersage des Studienabbruchs durch das Merkmal soziale Kompetenz
vielfach positive Belege (Soziale Kompetenz verringert den Studienabbruch, Wortman
& Napoli, 1996) gibt, sind Untersuchungen bzgl. der Studienleistung nur sehr selten.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832480738
- ISBN (Paperback)
- 9783838680736
- DOI
- 10.3239/9783832480738
- Dateigröße
- 920 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- globalmodell notenreduziertes modell eignungsdiagnostisches studienerfolg kundenorientierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de