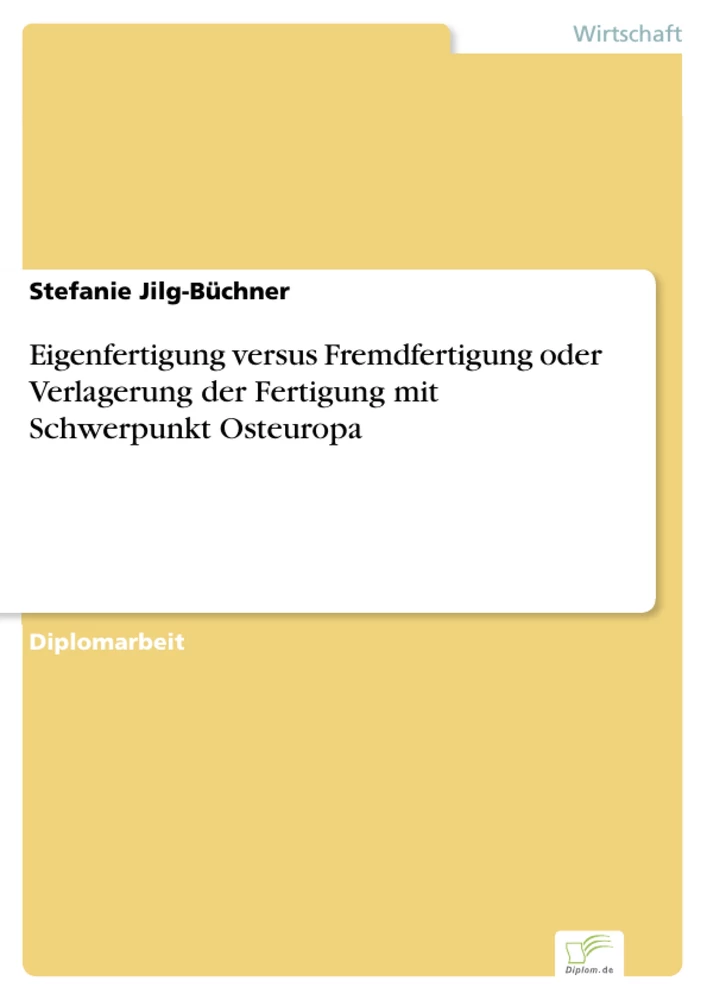Eigenfertigung versus Fremdfertigung oder Verlagerung der Fertigung mit Schwerpunkt Osteuropa
©2004
Diplomarbeit
175 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Die Länder Mittel- und Osteuropas sind beliebte Ziele für die Verlagerung von Unternehmensbereichen, meist der Produktion. Vor allem die Tschechische Republik, Ungarn und Polen sowie die Slowakei waren bislang die Hauptinvestitionsländer, in erster Linie bedingt durch die wesentlich geringeren Lohnniveaus. Inzwischen geht der Trend jedoch noch weiter in den Osten. In Rumänien und Bulgarien sind die Arbeitskosten noch geringer als in den neuen EU-Mitgliedsstaaten. Auch steigen die Löhne in Osteuropa inzwischen rapide an, und können eine Auslagerung hinsichtlich der Kosteneinsparungen schon nach wenigen Jahren uninteressant machen. Zwar liegen die Arbeitskosten pro Stunde, beispielsweise in Tschechien, mit 4,19 Euro noch bei ca. 1/6 der deutschen Kosten, jedoch erfolgt der Anstieg bedeutend stärker als z.B. in Deutschland.
Natürlich wird es einige Jahre dauern, bis westeuropäische Standards erreicht werden. Wie lange der Prozess bis zur Annäherung hinziehen wird, stellt mit das Kernthema dieser Diplomarbeit dar.
Der Autor gibt zu Beginn der Arbeit einen Überblick über theoretische Aspekte von Make-or-buy bzw. Outsourcing, die Schwierigkeit einer solchen Entscheidungsfindung sowie die Kriterien die dafür wichtig sind.
Weiterhin werden die, in dieser Ausführung relevanten Länder, Tschechische Republik, Polen, Ungarn und Rumänien hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und politischen Situation durchleuchtet, das Arbeitskräftepotential und die Qualitätsansprüche untersucht. Anhand von Erfahrungsberichten bereits in Osteuropa tätiger Unternehmen, allgemeinen Umfragen und öffentlichen Diskussionen werden die Möglichkeiten und Grenzen eines Standortes, einer Beteiligung oder Fremdvergabe in die oben genannten Länder untersucht.
Da die sehr geringen Arbeitskosten in den Ländern Mittel- und Osteuropas eine der wichtigsten Kriterien für eine Auslagerung oder Fremdvergabe darstellen, werden diese näher untersucht. Anhand von Entwicklungen der Löhne in den einzelnen Ländern in den letzen Jahren wird eine Prognose erstellen, die Unternehmen helfen soll und die Entscheidung Make-or-buy bzw. Verlagerung der Fertigung zu erleichtern.
Mit verschiedenen Prognoseverfahren wird hochgerechnet, wie lange die Differenz zwischen den deutschen, und den Löhnen in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und Rumänien noch so extrem groß ist. Anhand dieser Berechnungen die allerdings keine verbindliche Aussage, sondern lediglich auf […]
Die Länder Mittel- und Osteuropas sind beliebte Ziele für die Verlagerung von Unternehmensbereichen, meist der Produktion. Vor allem die Tschechische Republik, Ungarn und Polen sowie die Slowakei waren bislang die Hauptinvestitionsländer, in erster Linie bedingt durch die wesentlich geringeren Lohnniveaus. Inzwischen geht der Trend jedoch noch weiter in den Osten. In Rumänien und Bulgarien sind die Arbeitskosten noch geringer als in den neuen EU-Mitgliedsstaaten. Auch steigen die Löhne in Osteuropa inzwischen rapide an, und können eine Auslagerung hinsichtlich der Kosteneinsparungen schon nach wenigen Jahren uninteressant machen. Zwar liegen die Arbeitskosten pro Stunde, beispielsweise in Tschechien, mit 4,19 Euro noch bei ca. 1/6 der deutschen Kosten, jedoch erfolgt der Anstieg bedeutend stärker als z.B. in Deutschland.
Natürlich wird es einige Jahre dauern, bis westeuropäische Standards erreicht werden. Wie lange der Prozess bis zur Annäherung hinziehen wird, stellt mit das Kernthema dieser Diplomarbeit dar.
Der Autor gibt zu Beginn der Arbeit einen Überblick über theoretische Aspekte von Make-or-buy bzw. Outsourcing, die Schwierigkeit einer solchen Entscheidungsfindung sowie die Kriterien die dafür wichtig sind.
Weiterhin werden die, in dieser Ausführung relevanten Länder, Tschechische Republik, Polen, Ungarn und Rumänien hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und politischen Situation durchleuchtet, das Arbeitskräftepotential und die Qualitätsansprüche untersucht. Anhand von Erfahrungsberichten bereits in Osteuropa tätiger Unternehmen, allgemeinen Umfragen und öffentlichen Diskussionen werden die Möglichkeiten und Grenzen eines Standortes, einer Beteiligung oder Fremdvergabe in die oben genannten Länder untersucht.
Da die sehr geringen Arbeitskosten in den Ländern Mittel- und Osteuropas eine der wichtigsten Kriterien für eine Auslagerung oder Fremdvergabe darstellen, werden diese näher untersucht. Anhand von Entwicklungen der Löhne in den einzelnen Ländern in den letzen Jahren wird eine Prognose erstellen, die Unternehmen helfen soll und die Entscheidung Make-or-buy bzw. Verlagerung der Fertigung zu erleichtern.
Mit verschiedenen Prognoseverfahren wird hochgerechnet, wie lange die Differenz zwischen den deutschen, und den Löhnen in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und Rumänien noch so extrem groß ist. Anhand dieser Berechnungen die allerdings keine verbindliche Aussage, sondern lediglich auf […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8231
Jilg, Stefanie: Eigenfertigung versus Fremdfertigung oder Verlagerung der Fertigung mit
Schwerpunkt Osteuropa
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Fachhochschule Offenburg, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
I
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS... I
TABELLENVERZEICHNIS ... IV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...V
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS...VII
1
EINLEITUNG...1
1.1
P
ROBLEMSTELLUNG
...1
1.2
M
ETHODISCHER
A
UFBAU DER
A
RBEIT
...2
1.3
A
USGANGSSITUATION
D
EUTSCHLAND
...3
2
DIE WAHL ZWISCHEN EIGENFERTIGUNG UND FREMDBEZUG...12
2.1
B
EGRIFFE
...12
2.1.1
Outsourcing...13
2.1.2
Make-or-Buy...14
2.2
R
ELEVANZ DER
E
NTSCHEIDUNGSFINDUNG
...15
2.3
S
CHWIERIGKEIT DER
E
NTSCHEIDUNGSFINDUNG
...16
2.3.1
Motive zur Verringerung der Fertigungstiefe...17
2.3.2
Risiken der Verringerung der Fertigungstiefe...18
2.4
E
NTSCHEIDUNGSKRITERIEN
...19
2.4.1
Kernkompetenz ...19
2.4.2
Qualität ...20
2.4.3
Wirtschaftlichkeit ...22
2.4.3.1
Kostenvergleichsrechnung...22
2.4.3.2
Transaktionskostentheorie ...24
3
BASISDATEN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, POLEN, RUMÄNIEN UND UNGARN 25
3.1
D
IE
T
SCHECHISCHE
R
EPUBLIK
...30
3.1.1
Allgemeines ...30
3.1.2
Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen...31
3.1.2.1
Bruttoinlandsprodukt ...31
3.1.2.2
Inflationsrate...33
3.1.2.3
Außenhandel...34
3.1.2.4
Direktinvestitionen ...35
3.1.2.5
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ...37
3.1.3
Infrastruktur ...38
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
II
3.1.4
Arbeitskräftepotenzial und Bildung...38
3.1.5
Qualität der Arbeitsleistung ...41
3.2
P
OLEN
...43
3.2.1
Allgemeines ...43
3.2.2
Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen...44
3.2.2.1
Bruttoinlandsprodukt ...44
3.2.2.2
Inflationsrate...46
3.2.2.3
Außenhandel...46
3.2.2.4
Direktinvestitionen ...47
3.2.2.5
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ...49
3.2.3
Infrastruktur ...50
3.2.4
Arbeitskräftepotenzial und Bildung...51
3.2.5
Qualität der Arbeitsleistung ...53
3.3
U
NGARN
...55
3.3.1
Allgemeines ...55
3.3.2
Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen...55
3.3.2.1
Bruttoinlandsprodukt ...56
3.3.2.2
Inflationsrate...57
3.3.2.3
Außenhandel...58
3.3.2.4
Direktinvestitionen ...59
3.3.3
Infrastruktur ...60
3.3.3.1
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ...61
3.3.4
Arbeitskräftepotential und Bildung ...62
3.3.5
Qualität der Arbeitsleistung ...64
3.4
R
UMÄNIEN
...65
3.4.1
Allgemeines ...65
3.4.2
Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen...66
3.4.2.1
Bruttoinlandsprodukt ...66
3.4.2.2
Inflationsrate...68
3.4.2.3
Außenhandel...69
3.4.2.4
Direktinvestitionen ...70
3.4.2.5
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen ...71
3.4.3
Infrastruktur ...72
3.4.4
Arbeitskräftepotential und Bildung ...73
3.4.5
Qualität der Arbeitsleistung ...75
3.5
Z
WISCHENFAZIT
...77
4
EINFLUSSGRÖßEN BEI DER WAHL EINES STANDORTS IN OSTEUROPA...81
4.1
D
IE
A
UTOMOBILINDUSTRIE IN
M
ITTEL
-
UND
O
STEUROPA
...81
4.2
I
NVESTITIONSRISIKEN UND
K
ORRUPTION
...84
4.3
A
RBEITSKOSTEN
,
E
INKOMMEN UND
P
RODUKTIVITÄT
...87
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
III
4.3.1
Mindestlöhne ...88
4.3.2
Arbeitskosten pro Stunde...89
4.3.3
Struktur der Arbeitskosten und Lohnnebenkosten ...91
4.3.4
Produktivität...93
4.3.5
Arbeitszeit...94
4.3.6
Verbindung zwischen Einkommen und Produktivität ...95
4.3.7
Verbindung zwischen Einkommen und Direktinvestition ...97
4.4
S
TEUERLICHE
A
SPEKTE
...101
4.5
G
EWERKSCHAFTEN UND
F
LEXIBILITÄT DER
A
RBEITSZEIT
...103
4.6
B
ÜROKRATIE UND
U
MWELTAUFLAGEN
...105
4.7
Z
WISCHENFAZIT
...107
5
PROGNOSEN ÜBER DIE BRUTTOLOHNENTWICKLUNG IN DEN VIER
BEISPIELLÄNDERN...109
5.1
G
RUNDBEGRIFFE
...109
5.2
P
ROGNOSEN AUF
B
ASIS EXPONENTIELLER
F
UNKTIONEN
...110
5.2.1
Die Tschechische Republik...111
5.2.2
Polen ...114
5.2.3
Ungarn ...117
5.2.4
Rumänien...119
5.3
Z
WISCHENFAZIT
...122
5.4
E
INFLUSSGRÖßEN AUF DIE
P
ROGNOSEN
...123
5.5
P
ROGNOSEN UNTER
Z
UHILFENAHME DER
L
OHNENTWICKLUNG IN
S
PANIEN
...125
5.6
Z
WISCHENFAZIT
...128
5.7
P
ROGNOSEN AUF
B
ASIS LOGISTISCHER
F
UNKTIONEN
...129
5.7.1
Die Tschechische Republik...131
5.7.2
Polen ...133
5.7.3
Ungarn ...135
5.7.4
Rumänien...137
5.8
Z
WISCHENFAZIT
...139
6
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK...140
EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG ... VIII
QUELLENVERZEICHNIS ... IX
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
IV
Tabellenverzeichnis
Tab. 1 Arbeitslosenquote, Wochenarbeitszeit und Urlaub/Feiertage im Ländervergleich ...5
Tab. 2 Kostenvergleich Eigenfertigung und Fremdbezug ...23
Tab. 3 Inflationsrate in Tschechien...33
Tab. 4 Direktinvestitionen in Tschechien ...35
Tab. 5 Emigrationsabsicht der Beitritts- und Kandidatenländer - Tschechien ...41
Tab. 6 Inflationsrate in Polen...46
Tab. 7 Direktinvestitionen in Polen ...48
Tab. 8 Emigrationsabsicht der Beitritts- und Kandidatenländer - Polen ...53
Tab. 9 Inflationsrate in Ungarn ...58
Tab. 10 Direktinvestitionen in Ungarn...60
Tab. 11 Emigrationsabsicht der Beitritts- und Kandidatenländer...63
Tab. 12 Inflationsraten in Rumänien...68
Tab. 13 Direktinvestitionen in Rumänien ...71
Tab. 14 Emigrationsabsicht der Beitritts- und Kandidatenländer - Polen ...74
Tab. 15 Bewertung von Investitionsrisiken durch internationale Ratingagenturen...84
Tab. 16 Korruptions-Index 2003...87
Tab. 17 Entwicklung der Arbeitskosten pro Stunde ...89
Tab. 18 Arbeitsproduktivität pro Mitarbeiter in % ...93
Tab. 19 Bruttolöhne in der Tschechischen Republik ...112
Tab. 20 Bruttolöhne in Deutschland ...112
Tab. 21 Bruttolöhne in Polen ...115
Tab. 22 Bruttolöhne in Ungarn ...117
Tab. 23 Bruttolöhne in Rumänien...120
Tab. 24 Annäherungszeiten der Bruttolöhne an deutsche Standards...122
Tab. 25 Bruttomonatslohn Spanien Deutschland in Euro/Stunde...125
Tab. 26 Prognose der Bruttolohnentwicklung in Tschechien in Euro/Monat...132
Tab. 27 Prognose der Bruttolohnentwicklung in Polen in Euro/Monat...135
Tab. 28 Prognose über die Bruttolohnentwicklung in Ungarn in Euro/Monat...136
Tab. 29 Prognose über die Bruttolohnentwicklung in Rumänien in Euro/Monat ...138
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
V
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Arbeitslosenquote, Wochenarbeitszeit und Urlaub/Feiertage im Ländervergleich ...6
Abb. 2 Arbeitskosten im internationalen Vergleich von Industrieländern ...7
Abb. 3 Motive für den Aufbau von Produktionsstätten im Ausland...11
Abb. 4 BIP im EU-Vergleich 2002 in Mrd. Euro ...27
Abb. 5 BIP je Einwohner im EU-Vergleich 2002 in Euro...28
Abb. 6 Die Wachstumsraten des BIP in % - EU-15 und EU-10...29
Abb. 7 Die Wachstumsraten des BIP in % - Tschechische Republik...32
Abb. 8 Aufteilung des BIP in der Tschechischen Republik...32
Abb. 9 Import Exportvolumen in Mrd. Euro in Tschechien...34
Abb. 10 Arbeitslosigkeit in Tschechien in %...39
Abb. 11 Wachstumsraten des BIP in % - Polen...44
Abb. 12 Aufteilung des BIP in Polen...45
Abb. 13 Import Export Volumen in Mrd. US$ - Polen...47
Abb. 14 Arbeitslosigkeit in Polen in %...52
Abb. 15 Wachstumsraten des BIP in % - Ungarn...56
Abb. 16 Aufteilung des BIP in Ungarn...57
Abb. 17 Import Export Volumen in Mrd. Euro in Ungarn ...59
Abb. 18 Arbeitslosigkeit in Ungarn in %...62
Abb. 19 Wachstumsraten des BIP in % - Rumänien ...67
Abb. 20 Aufteilung des BIP in Rumänien ...67
Abb. 21 Import Export Volumen in Mrd. US$ - Rumänien ...70
Abb. 22 Arbeitslosigkeit in Rumänien...73
Abb. 23 Status-Index und Ranking für das Jahr 2003 ...79
Abb. 24 Management-Index und Ranking für das Jahr 2003 ...80
Abb. 25 Pkw-Produktion...82
Abb. 26 Pkw-Dichte 2002...83
Abb. 27 Mindestlöhne (nominal und in KKS) in Euro/Monat...88
Abb. 28 Verlauf der Arbeitskosten/Stunde 1995-2002 in Euro/Jahr ...90
Abb. 29 Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil der Lohnnebenkosten...92
Abb. 30 Arbeitsproduktivität pro Mitarbeiter in %...94
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
VI
Abb. 31 Durchschnittliche Arbeitszeit pro Monat ...95
Abb. 32 Einkommen und Produktivität - D ...97
Abb. 33 Einkommen und Produktivität - Hu ...96
Abb. 34 Einkommen und Produktivität - PL ...97
Abb. 35 Einkommen und Produktivität - CZ...96
Abb. 36 Einkommen und DI CZ...98
Abb. 37 Einkommen und DI - HU...99
Abb. 38 Einkommen und DI - PL ...100
Abb. 39 Steuersätze 2003 in % ...102
Abb. 40 Bruttolohnverläufe im Branchendurchschnitt Deutschland Tschechien...113
Abb. 41 Bruttolohnverläufe der Fahrzeugherstellung Deutschland Tschechien ...114
Abb. 42 Bruttolohnverläufe im Branchendurchschnitt Polen - Deutschland...115
Abb. 43 Bruttolohnverläufe in der Fahrzeugherstellung Polen - Deutschland ...116
Abb. 44 Bruttolohnverläufe im Branchendurchschnitt Ungarn Deutschland ...118
Abb. 45 Bruttolohnverläufe in der Fahrzeugherstellung Ungarn - Deutschland ...119
Abb. 46 Bruttolohnverläufe im Branchendurchschnitt Rumänien - Deutschland ...121
Abb. 47 Bruttolohnverläufe in der Fahrzeugherstellung Ungarn - Deutschland ...121
Abb. 48 Bruttolöhne in % zum Vorjahr Spanien ...126
Abb. 49 Bruttolöhne in Euro/Stunde - Spanien ...126
Abb. 50 Mögliche Lohnentwicklung in Euro/Monat - Tschechien ...127
Abb. 51 Bruttolohnentwicklung in Spanien in Euro/Stunde...130
Abb. 52 Prognose der Bruttolohnentwicklung in Tschechien in Euro/Monat ...132
Abb. 53 Prognose der Bruttolohnentwicklung Polen in Euro/Monat ...134
Abb. 54 Bruttolohnentwicklung Ungarn in Euro/Monat ...136
Abb. 55 Bruttolohnentwicklung Rumänien ...138
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
VII
Abkürzungsverzeichnis
BIP
Bruttoinlandsprodukt (Definition siehe Kapitel 3)
CZ Tschechische
Republik
DI
Direktinvestitionen (Definition siehe Kapitel 3.1.2.4)
ESt. Einkommenssteuer
EU Europäische
Union
EU-10 Neue
EU-Staaten
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Polen, Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Ungarn, Zypern
EU-15
Staaten, die vor dem 01. Mai 2004 zur EU gehörten:
Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Finnland, Griechenland,
Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich,
Portugal, Schweden, Spanien
HU Ungarn
IWF
Internationaler Währungsfond (Erläuterung siehe Kapitel 3.2.3)
KKP Kaufkraftparität
(Definition siehe Kapitel 3)
KKS Kaufkraftstandard
(Definition siehe Kapitel 3)
KöSt. Körperschaftssteuer
M.o.B. Make-or-Buy
Mio. Million
MOE Mittel-
und
Osteuropa
MOEL
mittel- und osteuropäische Länder
Mrd. Milliarde
MwSt. Mehrwertsteuer
NATO Nordatlantikorganisation
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
(Definition siehe Kapitel 3.1.3)
PL Polen
RO
Rumänien
s.r.o.
Tschechische Gesellschaftsform, entsprechend der deutschen GmbH
WTO
World Trade Organisation (Erläuterung siehe Kapitel 3.2.3)
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Länder Mittel- und Osteuropas sind beliebte Ziele für die Verlagerung von
Unternehmensbereichen, meist der Produktion. Vor allem die Tschechische
Republik, Ungarn und Polen sowie die Slowakei waren bislang die
Hauptinvestitionsländer - in erster Linie bedingt durch die wesentlich geringeren
Lohnniveaus. Inzwischen geht der Trend jedoch noch weiter in die Länder im Osten.
In Rumänien und Bulgarien sind die Arbeitskosten noch geringer als in den neuen
EU-Mitgliedsstaaten.
Der Kostendruck in deutschen Unternehmen wird immer größer. Die derzeitige
wirtschaftliche Situation, wachsende Qualitätsansprüche und eine Vielzahl von
Wettbewerbern, die die Globalisierung der Märkte mit sich bringen, machen es den
Unternehmen nicht leicht. Eine der wichtigsten Aufgaben eines Managers ist es so,
die Kosten zu minimieren und die ganzen Strukturen zu überdenken.
Unternehmensberater und Wirtschaftswissenschaftler raten oft zu einer Auslagerung
in osteuropäische Länder oder zu einer Fremdvergabe von Produktionsbereichen.
Eine Vielzahl von Unternehmen hat diesen Trend bereits aufgegriffen. Weitere
Direktinvestitionen in Osteuropa sind geplant. Die Rechnung ging bisher auf; durch
deutlich geringere Arbeitskosten kann wesentlich günstiger produziert werden. Es
stellt sich nun aber die Frage, wie lange das anhalten wird. Mit den
Produktionsstätten aus Westeuropa wird auch die Entwicklung der Länder
vorangetrieben. Die Löhne steigen dadurch deutlich schneller, ein Effekt, der durch
den EU-Beitritt zusätzlich beschleunigt wird.
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
2
Aus diesem Grund soll jetzt untersucht werden, ob eine Auslagerung zu einer
dauerhaften Reduzierung der Kosten führt. Die Unternehmensberatungsfirmen
rechnen sich das Einsparpotenzial aus der Differenz zwischen den
Durchschnittslöhnen in der Bundesrepublik Deutschland und den Löhnen in den
Ostgebieten Tschechien, Rumänien, Polen und Ungarn aus.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deshalb in der Untersuchung der
Lohnentwicklung in den genannten Ländern, sowohl in der Vergangenheit, als auch
in Form einer Prognose für die nächsten 10 Jahre. Mit Hilfe dieser Analyse soll
festgestellt werden, für welchen Zeitraum eine Auslagerung von Fertigungsbereichen
in Billiglohnländer noch von Vorteil ist, auch unter dem Aspekt, dass die
Produktivität am heimischen Standort sehr hoch ist. Als Entscheidungskriterien
werden neben den Lohnkosten auch das Investitionsrisiko, Qualität der
Arbeitsleistung, Bildungsniveau und Produktivität sowie Leistungsbereitschaft
steuerliche Vergünstigungen untersucht.
1.2 Methodischer Aufbau der Arbeit
Das Kernthema dieser Arbeit besteht darin, herauszufinden, wie lange die
osteuropäischen Länder mit ihrem Lohnniveau noch so weit unter dem Durchschnitt
der EU-15 Länder liegen. Das heißt, wie lange lohnt sich eine Auslagerung in den
Osten unter dem Gesichtspunkt günstiger Arbeitskosten noch.
Zu Beginn der Arbeit werden die Hintergründe zum Thema ,,Make-or-buy" bzw.
,,Outsourcing" erläutert, deren Chancen und Risiken aufgezeigt und die Problematik
der Entscheidung verdeutlicht. Die Kriterien, die in der Entscheidungsfindung eine
Rolle spielen, werden erläutert und deren Schwachstellen aufgezeigt.
Danach werden die vier zu untersuchenden Länder, die Tschechische Republik,
Polen, Ungarn und Rumänien, auf ihre wirtschaftliche und politische Situation sowie
auf das Arbeitskräftepotenzial, die Arbeitskosten und mögliche Risiken untersucht.
Es werden ferner die Qualität des Outputs sowie der Arbeitswille der Bevölkerung
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
3
anhand von Erfahrungsberichten dargestellt, um das Niveau der Arbeitsleistung zu
veranschaulichen.
Im Anschluss wird das eigentliche Kernthema dieser Arbeit durchleuchtet. Es wird
versucht, anhand der Vergangenheitswerte und Faktoren wie Wirtschaftsentwicklung
und Direktinvestitionen sowie Ergebnissen wissenschaftlicher Studien, die
Lohnentwicklungen der Zukunft abzuschätzen. Hierzu wird die Entwicklung
Spaniens nach dem EG-Beitritt im Jahr 1986 herangezogen und statistische
Prognoseverfahren angewendet.
1.3 Ausgangssituation Deutschland
Der Wunsch, Unternehmensteile auszulagern, entsteht sicherlich nicht zuletzt
dadurch, dass der Standort Deutschland durch die hohen Arbeitskosten die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erschwert. Die Globalisierung der Märkte
und die steigenden Ansprüche der Kunden bringen die Unternehmen in eine
schwierige Lage. Einerseits sollen die Produktvielfalt und Qualität erhöht, auf der
anderen Seite die Kosten verringert werden. Bei der Überarbeitung der
Unternehmensstrukturen kommt es oft zu der Überlegung, bestimmte
Unternehmensbereiche oder Fertigungsabläufe an Dritte abzugeben oder den Bereich
an einen günstigeren Standort zu verlagern. Die Nähe zur Tschechei, Polen oder
Ungarn und damit die Chance auf günstigere Arbeitskosten ziehen viele
Unternehmen in die Regionen Osteuropas; eine Möglichkeit, die durch die EU-
Osterweiterung noch vereinfacht wird.
Über die aktuelle Situation in Deutschland, mögliche Ursachen, aber auch
potenzielle Auswege, welche derzeit in den Medien stark diskutiert werden, sollen
die folgenden Absätze einen kleinen Einblick geben. Sie sollen verdeutlichen, warum
der meist doch risikobelastete Wunsch, in den Osten auszulagern, überhaupt besteht.
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
4
Momentan befinden wir uns in der längsten Stagnationsphase der Nachkriegszeit.
Das Bruttoinlandsprodukt ist in 2003 zum dritten Mal um weniger als 1% gestiegen.
Dazu kommt die hohe Arbeitslosigkeit von 4,5 Millionen registrierten
Erwerbssuchenden und die dadurch überlasteten Sozialsysteme, deren Leistung nur
durch weitere Verschuldung des Staates in der Zukunft aufrechterhalten werden
kann. Die Erhöhung von Beitragssätzen, Pflichtversicherungs- und
Beitragsbemessungsgrenzen wirkt sich wiederum zu Lasten der Arbeitskosten und
somit der Arbeitslosigkeit aus ein nicht enden wollender Kreislauf. Die Staatsquote
steigt ebenfalls stetig an und hat heute annähernd 50% erreicht. Die Lage der
öffentlichen Haushalte ist bedenklich und die Neuverschuldung bringt die Gefahr,
mit sich, dass auch die folgenden Generationen darunter leiden müssen. Die
Unternehmensinsolvenzen haben den höchsten Stand der Nachkriegszeit verzeichnet
(37.700 in 2002 und 39.200 in 2003). Dies alles führt dazu, dass Deutschland
gegenüber den Konkurrenznationen immer weiter im internationalen Wettbewerb
zurückfällt. In punkto Wettbewerbsfähigkeit ist die Bundesrepublik nur auf dem 14.
Rang.
1
Durch die EU-Osterweiterung kommen wieder neue Wettbewerber hinzu, die zudem
günstige Arbeitskosten und niedrigere Steuersätze mit sich bringen. Auch flexiblere
Arbeitszeitgestaltung und weniger strenge Umweltvorschriften machen den Standort
Osteuropa für deutsche Unternehmen zu einer interessanten und oft unumgänglichen
Alternative.
Das Themen Arbeitslosigkeit sowie Arbeitskosten inklusive Personalzusatzkosten
bringen momentan einiges an Diskussionsstoff mit sich. Oftmals wird als
Lösungsansatz eine Veränderung der Arbeitszeit vorgeschlagen, doch sowohl die
Arbeitszeitverlängerung als auch -verkürzung wird als Ideallösung belegt, wie die
Argumentationen im weiteren Verlauf zeigen.
1
Vgl. Schauerte, Hartmut MdB, So kommt Deutschland aus der Krise Mehr Arbeit. Mehr
Wettbewerb. Mehr Zukunft, September 2003,
http://www.mit-nrw.de/download/dateien/deutschland_krise.pdf, Stand: 15. März 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
5
Ein Vergleich Deutschlands mit den USA, Frankreich und der Schweiz ergab
diesbezüglich folgendes Ergebnis:
Wochen-
arbeitszeit
(Std.)
Arbeits-
losen-
quote
in %
(Stand
2003)
Arbeits-
kosten
in /Std.
Personal-
zusatzkosten
in /Std.
Urlaub
und
Feiertage
(Tage)
Tarifver-
traglich
organisierte
AN
Schweiz
40,5
3,9
24,96
8,59
24,4 + 9
50 %
USA
40,0
6,0
22,99
6,42
12 + 11
10 %
Frankreich
35,6
9,2
18,93
9,03
25 +11
ca. 8 %
Deutschland
36,0
10,6
25,20
11,20
30 + 11
*
ca. 67 %
Tab. 1 Arbeitslosenquote, Wochenarbeitszeit und Urlaub/Feiertage im Ländervergleich
2
Die Tabelle zeigt, dass Deutschland die höchsten Arbeitskosten, bedingt auch durch
die Personalzusatzkosten, im Vergleich mit Frankreich, den USA und der Schweiz
hat. Gleichzeitig ist Deutschland Spitzenreiter bei der Anzahl der Urlaubstage. Das
führt zusammen mit der durchschnittlich 36-Stundenwoche zu den geringsten
Jahresarbeitsstunden der hier verglichenen Länder.
Die USA und die Schweiz weisen deutlich höhere Wochenarbeitszeiten und weniger
Urlaubstage auf, können aber auch eine geringere Arbeitslosenquote verzeichnen. In
wie weit hier der Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Arbeitslosigkeit liegt,
kann nicht sicher nachgewiesen werden.
2
Vgl. Schauerte, Hartmut MdB, So kommt Deutschland aus der Krise Mehr Arbeit. Mehr
Wettbewerb. Mehr Zukunft, September 2003,
http://www.mit-nrw.de/download/dateien/deutschland_krise.pdf, Stand: 15. März 2004,
*
Korrektur der deutschen Feiertage von 12,5 auf 11 Tage, Wert aus
http://www.feiertage.net/bundeslaender.php, Stand 30.04.2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
6
In Abb. 1 noch einmal der Vergleich der Situation mit Hilfe einer Grafik:
0
10
20
30
40
50
Schweiz
USA
Frankreich
Deutschland
Arbeitslosenquote in %
Wochenarbeitszeit in Std.
Urlaub und Feiertage in Tagen
Abb. 1 Arbeitslosenquote, Wochenarbeitszeit und Urlaub/Feiertage im Ländervergleich
3
Der internationale Vergleich ergibt, dass die Bundesrepublik Deutschland mit 35,7
Stunden in West- bzw. 35,5 Stunden in Ostdeutschland eine der niedrigsten
Wochenarbeitszeiten hat. In den USA sind es beispielsweise 40 Stunden pro Woche.
Der Jahresarbeitszeitvergleich führt zu gleichem Ergebnis. In Deutschland werden
jährlich durchschnittlich 1.467 Stunden (Wert vom Jahr 2001) gearbeitet in
Großbritannien waren es 1.711 Stunden und in den USA sogar 1.821 Stunden.
Außerdem hat kaum ein Land so viele bezahlte Urlaubs- und Feiertage wie
Deutschland. Mit durchschnittlich 11 bezahlten Feiertagen und 30 Tagen
Jahresurlaub liegt Deutschland klar vor Großbritannien mit 24,5 Tagen Urlaub und 9
Feiertagen oder den USA mit 12 Urlaubs- und 11 Feiertagen. Die Analyse ergab
weiterhin, dass die Ausbildungszeiten zu lang sind und das Renten- und
Pensionsalter zu früh beginnt. Das gesetzliche Rentenalter liegt zwar bei 65 Jahren,
doch gehen schon die meisten Arbeitnehmer mit 60 Jahren in Rente. Hieraus ergibt
sich, dass die durchschnittliche Lebensarbeitszeit zu kurz ist (37 Jahre bei
Arbeitnehmern ohne akademischen Abschluss, bei Akademikern nur 32 Jahre) und
3
Vgl. Schauerte, Hartmut MdB, So kommt Deutschland aus der Krise Mehr Arbeit. Mehr
Wettbewerb. Mehr Zukunft, September 2003,
http://www.mit-nrw.de/download/dateien/deutschland_krise.pdf, Stand: 15. März 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
7
somit das Verhältnis von Einzahlung in die Versicherungen und Anspruch auf
Leistungen nicht mehr stimmt.
4
Die Lohnnebenkosten und die Beitragssätze sind im internationalen Vergleich am
Standort Deutschland am zweithöchsten und somit sind Investitionen und die
Produktion an diesem Standort am wenigsten attraktiv.
Die Arbeitskosten von 26,36 Euro pro Stunde in Westdeutschland liegen um 5,78
Euro über dem Durchschnitt der übrigen Industrieländer (Werte von 2002).
5
Das
einzige Land aus der EU mit höheren Arbeitskosten ist Norwegen mit 28,52 Euro pro
Stunde.
6
In Abb. 2 ist ein internationaler Vergleich der Arbeitskosten verschiedener
Industrieländer dargestellt:
Abb. 2 Arbeitskosten im internationalen Vergleich von Industrieländern
7
4
Vgl. Schauerte, Hartmut MdB, So kommt Deutschland aus der Krise Mehr Arbeit. Mehr
Wettbewerb. Mehr Zukunft, September 2003, http://www.mit-
nrw.de/download/dateien/deutschland_krise.pdf, Stand: 15. März 2004
5
Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Argumente zu Unternehmensfragen Nr. 9/September
2003, ,,Arbeitskosten: Deutschland jetzt Vize-Weltmeister",
http://www.iwkoeln.de/default.aspx?=contenthigh&i=16948, Stand: 15. März 2004
6
Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Argumente zu Unternehmensfragen Nr. 34 vom 21
August 2003, ,,Arbeitskosten international Endlich nur Vize-Weltmeister",
http://www.iwkoeln.de/default.aspx?=contenthigh&i=16915, Stand: 15. März 2004
7
Vgl. ebenda
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
8
Ausschlaggebend für die Höhe der Arbeitskosten sind auch, wie bereits erwähnt, die
Lohnnebenkosten, die auf die Erhöhung der Beitragssätze durch die
Sozialversicherung zurückzuführen sind. So sind z.B. seit 1970 die Beitragssätze für
die gesetzliche Krankenversicherung von 8,2% auf 14,4% gestiegen, die gesetzliche
Rentenversicherung von 17% auf 19,5% und die Arbeitslosenversicherung von 1,3%
auf 6,5%. Hinzu kommt seit 1995 die Pflegeversicherung mit 1,7%. Insgesamt
haben sich die Beitragssätze um 15,6 Prozentpunkte erhöht. (Werte von 2003) Für
Arbeitgeber bedeutet dies eine enorme Erhöhung der Kosten des Produktionsfaktors
Arbeit man kann sagen, dass der Lohn aus Sicht des Arbeitgebers das 1,9fache ist,
verglichen mit dem Nettolohn des Arbeitnehmers.
8
Die Auslagerung von Produktionen oder die Abwanderung von Unternehmen ist eine
naheliegende Folge dieser Situation. Doch dadurch werden die Beschäftigungszahlen
in Deutschland zurückgehen und die Arbeitslosenzahlen noch weiter in die Höhe
getrieben, die Kaufkraft des Landes geschwächt und der Ausweg aus dem
beschriebenen Kreislauf erschwert.
Es liegt auf der Hand, dass Unternehmensabwanderungen stets mit einem
Arbeitsplatzabbau zusammenhängen. Zwar können Unternehmen durch die
Auslagerung und die damit verbundene Kosteneinsparung dem internationalen
Wettbewerb besser standhalten und durch Mischkalkulationen Unternehmensteile im
Inland erhalten, jedoch nicht ohne national Arbeitsplätze zu verlieren.
Die hohen Arbeitskosten in Deutschland hängen sicherlich nicht allein von der
Arbeitszeit ab, sondern haben auch mit der Eingliederung der neuen Bundesländer
vor knapp 15 Jahren und den daraus resultierenden hohen Arbeitslosenzahlen zu tun.
Diese höhere Belastung der Kassen wurde auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
umgelegt und führte zu höheren Kosten der Sozialversicherung. Eine Veränderung
8
Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Forum Nr. 36 vom 2. September 2003, Bert Rürup:
,,Lohnnebenkosten Schwachstelle des deutschen Arbeitsmarktes",
http://www.iwkoeln.de/default.aspx?=contenthigh&i=16936, Stand: 18. März 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
9
der Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich könnte jedoch Unternehmen helfen ihre
Kostenstrukturen zu verbessern.
Das demographische Problem, dass wenige Beitragszahler aus den
geburtenschwachen Jahrgängen vielen Empfängern aus den geburtenstarken
Jahrgängen gegenüberstehen, ist ein weiterer Grund, der zu einer Erhöhung der
Beitragssätze für Sozialleistungen führt.
Die Diskussionen über die Veränderungen der Arbeitszeit führten zu sehr
gegensätzlichen Lösungsansätzen, die jedoch beide mit guten Argumenten oder
Beweisen belegt sind:
1.
Arbeitzeitverlängerung:
Studien der CDU haben ermittelt, dass mit 20 Minuten Mehrarbeit täglich und
einem Urlaubstag pro Jahr weniger, die Wettbewerbsfähigkeit verbessert und
somit kurzfristig das Wachstum der Wirtschaft auf 4,5% verdreifacht werden
könnte. Nach Aussage dieser Studien wären ca. 90 Mrd. Euro zusätzliches BIP,
225.000 Arbeitsplätze, über 20 Mrd. mehr Steuereinnahmen und etwa 2 Mrd.
Entlastung der Sozialversicherungshaushalte im Jahr 2004 möglich.
9
2.
Arbeitszeitverkürzung:
Ein Gegenbeispiel zur Arbeitszeitverlängerung bietet der VW-Konzern. Nach
Meinung des Vorsitzenden der IG-Metall, Jürgen Peters, ist die
Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverlängerung absurd. Er sagt: ,,Die
Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverkürzung war und ist der Kern der
Erfolgsstory ,Vier-Tage-Woche' bei VW". Als Bestätigung weist er auf die
Überwindung der tiefen Rezession vor zehn Jahren hin, in der VW in einer
schweren Krise gesteckt hatte und 30.000 Arbeitsplätze in Gefahr waren. Die von
9
Vgl. Schauerte, Hartmut MdB, So kommt Deutschland aus der Krise Mehr Arbeit. Mehr
Wettbewerb. Mehr Zukunft, September 2003, http://www.mit-
nrw.de/download/dateien/deutschland_krise.pdf, Stand: 15. März 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
10
der Regierung geforderte Rückkehr zur 40-Stunden-Woche erachtete VW nicht
als die richtige Lösung, da dies 20.000 bis 30.000 Jobs gekostet hätte. Anstelle
der Arbeitszeitverlängerung wurde am 1. Januar 1994 die Vier-Tage-Woche mit
28,8 Wochenstunden eingeführt, welche auch heute noch besteht. Dieser Schritt
war jedoch mit finanziellen Einbußen aller VW-Beschäftigten verbunden
gewesen, die auf 10,5% des jährlichen Bruttogehalts verzichten mussten. VW
garantierte dafür, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Nur durch
diesen Tarifvertragsabschluss konnten 30.000 Arbeitsplätze gerettet werden, und
das Motto wurde bewahrt: ,,Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht". Die
Beschäftigungszahlen sind bis heute annähernd konstant geblieben
10
Die beiden Argumentationen spiegeln extrem gegensätzliche Strategien wieder,
beide führen bzw. führten angeblich jedoch zu einer Verbesserung der
Arbeitslosigkeit und somit der Wirtschaftlichkeit der Bundesrepublik. Welcher Weg
der richtigere ist, ist schwer zu sagen. In welche Richtung sich die Arbeitszeiten in
Deutschland bewegen werden, wird sich im Laufe der kommenden Jahre entscheiden
ein Stück weit auch abhängig von den Entwicklungen in den neuen
Beitrittsländern.
Unabhängig davon, ob der Trend zur Kürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit
führt, reizt viele Unternehmen auch die höhere Flexibilität in der Nutzung der
Arbeitszeit in den Ländern Osteuropas. So berichtet z.B. Audi, dass die
Produktionsanlagen Györ in Nordungarn 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr
laufen. Für diese Auslastung muss dort keine Zustimmung der Gewerkschaften oder
Behörden eingeholt werden, genauso wenig wie bei Kurzarbeit. Durch diese
10
Vgl. IG Metall: 4-Tage-Woche bei VW ein Erfolg, Peters: Aktuelle Forderungen nach
Arbeitszeitverlängerung sind absurd, http://www.igmetall.de/pressedienst/2003/112.html, Stand:
07.04.2004, IG Metall: Tarifverträge Arbeitszeitverkürzung bei VW,
http://www.igmetall.de/tarife/vw_28_8_stundenwoche.html, Stand 07.04.2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
11
optimale Nutzung der Anlagen können diese kleiner ausgelegt werden als z.B. in
Deutschland und somit werden ca. 10% Kapitalkosten eingespart.
11
Eine Umfrage des Fraunhofer Instituts über die Motive für den Aufbau von
Produktionsstätten im Ausland ergab folgendes Ergebnis:
6%
8%
9%
12%
15%
16%
16%
17%
21%
34%
60%
65%
Währungsausgleich
Technologieerschließung
Infrastruktur
Kapazitätsengpässe
lokale Auflagen
Koordinations-, Kommunikations-, Transportkosten
Präsenz der Konkurrenz
Verfügbarkeit v. qualif. Personal
Steuern, Abgabe, Subventionen
Nähe zu Großkunden
Markterschließung
Kosten der Produktionsfaktoren
Abb. 3 Motive für den Aufbau von Produktionsstätten im Ausland
12
Die Kostengründe werden hier am häufigsten genannt, doch oft sind sie nicht
alleiniger Beweggrund. Das Motiv Markterschließung folgt mit knappem Abstand,
genauso die Nähe zum Großkunden. Bei steigendem Einkommensniveau in den
Ländern Osteuropas nehmen die Markt- und Absatzaspekte eine immer größere
Wichtigkeit ein.
13
Auslagerungen nach Osteuropa oder in andere Billiglohnländer sind seit ein paar
Jahren der Trend. Es stellt sich allerdings die Frage, wie lange in diesen Regionen
11
Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 23.03.2004, S. 15: Deutsche Unternehmen suchen
in Osteuropa Flexibilität
12
Vgl. IG Metall, Wirtschaft, Technologie, Umwelt: ,,EU-Osterweiterung", Januar 2004,
http://www.igmetall.de/download/europa/eu_osterweiterung_0401.pdf, Stand 01. Juni 2004
13
Vgl. ebenda
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
12
vor allem in den neuen Beitrittsländern der EU der Faktor Arbeit noch so günstig
ist und wie sich dies in den nächsten Jahren entwickelt.
2 Die Wahl zwischen Eigenfertigung und
Fremdbezug
Unternehmen haben sich schon immer Ressourcen von Dritten beschafft, ein
typisches Beispiel hierfür sind die Energieversorgung oder externe
Nachrichtenquellen. Ende der 60er Jahre wurde diese Entwicklung immer stärker
ausgeprägt und man begann auch den Dienstleistungssektor von außen zu beziehen.
Bereiche wie Reinigung oder Kantine wurden an Fremdfirmen vergeben, die sich auf
diese Gebiete spezialisiert haben. In den letzten Jahren wurden die ausgelagerten
Bereiche immer komplexer, oftmals sind auch mehrere Dienste gebündelt fremd
vergeben.
14
Aus diesem Grund wird es immer schwieriger, die richtige Entscheidung
zu treffen und die damit verbundenen Chancen und Risiken gründlich abzuwägen.
Die folgenden Kapitel sollen einen kurzen Überblick über das Entscheidungsgebiet
und die Entscheidungskriterien geben.
2.1 Begriffe
Die beiden wichtigsten Bezeichnungen, die das Thema Eigenfertigung oder
Fremdbezug mit sich bringen sind ,,Make-or-Buy" oder ,,Outsourcing". Sie
kursieren, bedingt durch ihre steigende Bedeutung, in aller Munde und werden oft
fälschlicherweise als Synonyme angesehen. Jedoch gibt es Unterschiede hinsichtlich
14
Vgl. Kienbaum Consultants International GmbH, Outsourcing Chancen und Risiken aus betriebs-
und personalwirtschaftlicher Sicht
http://www.enbw.com/nord/pdf/fachbeitraege/outsourcing.pdf, Stand: 14. April 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
13
Zeitpunkt und Komplexitätsgrad der Beschaffung von Gütern oder Dienstleistungen
von Dritten.
Ganz allgemein bedeutet Outsourcing bzw. Make-or-Buy soviel wie: ,,Längerfristig
angelegte Ausgliederung bestimmter Ressourcen aus dem Unternehmen und deren
Übertragung an Dritte"
15
2.1.1 Outsourcing
Das Wort ist zusammengesetzt aus den angelsächsischen Begriffen "Outside",
"Resources" und ,,using" und bedeutet ,,Verlagerung schwer abgrenzbar integrierter
Dienste, einschließlich deren Management".
16
Wörtlich übersetzt: ,,Inanspruchnahme (using) von außerhalb einer Unternehmung
liegenden (outside) Versorgungs- bzw. Beschaffungsquellen".
17
Nach dieser Definition ist Outsourcing mehr eine unternehmenspolitische Aufgabe
zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen mit strategischer Ausrichtung. Ein Beispiel
für Outsourcing ist die Auslagerung der Datenverarbeitung.
18
Wichtig dabei ist, dass es sich um eine gezielt langfristige Auslagerung mit
Übernahme der Verantwortung durch Externe handelt.
19
15
Vgl
.
Kienbaum Consultants International GmbH, Outsourcing Chancen und Risiken aus betriebs-
und personalwirtschaftlicher Sicht
http://www.enbw.com/nord/pdf/fachbeitraege/outsourcing.pdf, Stand: 14. April 2004
16
Vgl. ebenda
17
Vgl. Kang, A.: ,,Beitrag zur Unterstützung von rationellen Entscheidungen zum Outsourcing von
Geschäftsprozessen", Shaker Verlag, Aachen, 2003, Seite 18
18
Vgl. ebenda
19
Vgl. Kohler, Ralf: ,,Organisation des Supply Chain Managements",
http://home.nikocity.de/kohler/scm/scm.html, Stand 16. April 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
14
Zeitlich gesehen werden Outsourcing-Überlegungen, im Gegensatz zu Make-or-Buy
Entscheidungen, meist auf im Unternehmen bereits durchgeführte Leistungen
bezogen. Das heißt, es werden bekannte Bereiche oder Abläufe an Dienstleister
vergeben.
20
2.1.2 Make-or-Buy
Make-or-Buy, d.h. Eigenerstellung (,,make") oder Fremdbezug (,,buy"), ist im
Gegensatz zu Outsourcing eher der ,,Zukauf abgegrenzter einfacher Dienste".
Gemeint sind hier Routineaufgaben des Einkaufs zur kurzfristigen
Kostenminimierung, also eher ein operatives Instrument.
21
Make-or-Buy bezieht sich auf die Optimierung der Fertigungstiefe im
Produktionsbereich, diese Entscheidungen fallen also hauptsächlich in den Bereich
Sachleistungen.
22
In zeitlicher Hinsicht kann man sagen, dass M-o-B Alternativen in
sehr frühem Stadium abgewogen werden, oft schon vor Beginn der Entwicklung des
Produktes.
23
20
Vgl. Lindner, V.: Kriterien für Make-or-Buy-Entscheidungen,
http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/download/bwu/11738.html, Stand 14. April 2004
21
Vgl. Kienbaum Consultans International GmbH, Outsourcing Chancen und Risiken aus betriebs-
und personalwirtschaftlicher Sicht
http://www.enbw.com/nord/pdf/fachbeitraege/outsourcing.pdf, Stand: 14. April 2004
22
Vgl. Kohler, Ralf: ,,Organisation des Supply Chain Managements",
http://home.nikocity.de/kohler/scm/scm.html, Stand 16. April 2004
23
Vgl. Lindner, V.: Kriterien für Make-or-Buy-Entscheidungen,
http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/download/bwu/11738.html, Stand 14. April 2004
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
15
2.2 Relevanz der Entscheidungsfindung
Die Globalisierung der Märkte sowie die veränderte Dynamik von Absatz- und
Beschaffungsmärkten zwingen die Unternehmen dazu, immer schneller zu reagieren,
um dem internationalen Wettbewerb standhalten zu können. Dies führt zu einer
Überarbeitung der Unternehmensstrukturen und überdies oft zu einer Verringerung
der Fertigungstiefe, denn mit dem Auslagern ist meist ein Abbau von gebundenem
Kapital in Form von Anlagevermögen verbunden.
Bedingt sind diese Veränderungen durch die Verkürzung der Lebenszyklen, d.h.
durch ständig wechselnde Trends und rasante Entwicklung der Technologie. Es ist
für Unternehmen extrem wichtig, immer wieder schnell neue Produkte auf den Markt
zu bringen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies führt zu hohen
Entwicklungskosten, denen Produkte mit nur sehr kurzer Lebensdauer
gegenüberstehen. Eine exakte Überarbeitung der Kalkulation führt oft zu Make-or-
Buy-Überlegungen
24
Auch das zunehmende Niveau der Kundenansprüche sorgt für eine stetige
Anpassung der Produktpalette und der Qualität. Dies führt zu einer Steigerung der
Produktkomplexität, was steigende Kosten und höhere Bestände verursachen kann.
25
Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind komplexere
Produktionsverfahren notwendig, die jedoch durch die schnelle Entwicklung der
Technologien zu immer höheren Investitionen führen. Mit neuen Investitionen ist
stets das Risiko der Auslastung verbunden. Durch die Fremdvergabe kann dieses
Risiko umgangen bzw, auf Dritte verlagert werden.
26
Um dem zunehmenden Kosten- und Wettbewerbsdruck stand zu halten, ist eine
kostengünstige und flexible Produktion unumgänglich. Eine erhöhte
24
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Shaker Verlag, Aachen 2002, Seite 7
25
Vg. ebenda
26
Vgl. ebenda
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
16
Investitionsintensität führt zu steigenden Fixkosten und damit zu einer hohen
Empfindlichkeit gegenüber Nachfrageschwankungen.
27
Durch bessere
Anlagenauslastung können Dritte, die eine bestimmte Leistung, evtl. sogar die
Kernkompetenz, auch für andere Unternehmen erbringen, kostengünstiger und
vielleicht sogar besser erbringen.
2.3 Schwierigkeit der Entscheidungsfindung
Die Entscheidung zur Eigenfertigung oder Fremdvergabe darf aufgrund der immer
komplexer werdenden Leistungen nicht unterschätzt werden, da sie auf
unternehmensstrategische, äußerst wichtige Bereiche Einfluss nimmt.
Dazu gehören z.B.:
28
die Kostenstruktur, denn hohe Eigenfertigungs- und niedrige Fremdvergabe-
umfänge führen zu hohen fixen Kosten und geringen variablen Kosten oder
umgegehrt. Dies wirkt sich auf die Kapitalbindung aus.
das Leerkostenrisiko, denn ein hoher Fixkostenanteil führt automatisch zu
einem erhöhten Leerkostenrisiko.
das Versorgungsrisiko, denn bei einem hohen Anteil an Fremdvergabe erhöht
sich auch die Abhängigkeit von den Lieferanten.
die Qualifikation, die Mitarbeiterzahl sowie das Know-how des
Unternehmens.
die interne Machtverteilung, denn durch Outsourcing wird z.B. die Position
des Einkaufs gestärkt, bei Eigenfertigung steigt die Bedeutung des
entsprechenden Fertigungsbereichs.
27
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Shaker Verlag, Aachen 2002, Seite 7
28
Vgl. Prof. Dr. Schneider, D.: Stategisches Incoucing-Outsourcing-Controlling mit Make-or-buy-
Portfolios, Teil 1: Konzeptionelle Grundlagen, Controller Magazin 4/96, S. 207f
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
17
Aus diesen Gründen ist es besonders wichtig, die Entscheidung unter verschiedenen
Gesichtspunkten gut abzuwägen. Einige der wichtigsten Entscheidungskriterien
werden in den nachfolgenden Kapiteln erörtert.
Zuvor werden in Kapitel 2.3.1 noch einige Chancen und Risiken zur Verdeutlichung
des Entscheidungsproblems dargestellt.
2.3.1 Motive zur Verringerung der Fertigungstiefe
29
Die Verringerung der Fertigungstiefe bringt für das Unternehmen einige Vorteile mit
sich. Dazu gehören z.B.:
Die Flexibilität des Kostenmanagements wird erhöht, so kann im Falle eines
Beschäftigungsrückgangs einfacher reagiert werden.
Bei Fremdvergabe kann die Leistungserstellung in den meisten Fällen zu
günstigeren Stückkosten erfolgen. Dies ist jedoch nur zu erreichen, wenn der
Zulieferer einen größeren Kundenkreis oder einen Großkunden beliefert und
somit durch das größere Absatzvolumen geringere Stückkosten erzielt.
Die einzelnen Wirtschaftszweige haben unterschiedliche Tarifniveaus mit
teilweise großen Abweichungen. Dies spiegelt sich insbesondere bei der
Fremdvergabe von Dienstleistungen wie Kantine und Reinigung an
Unternehmen, die anderen Tarifgruppen angehören, wider.
Das Finanzierungsvolumen wird verringert, weil die anstehenden Ersatz-,
Erweiterungs- oder Rationalisierungsinvestitionen entfallen.
Durch Verringerung des Anlagevermögens verbessern sich, bei gleichem
Gewinn, die Kapitalrentabilitäten.
29
Vgl. Prof. Dr. Warschburger, V. und Hans, L.: Strategische und operative Outsourcing-
Entscheidungen, Controller Magazin 5/98, S. 334f
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
18
Die organisatorische Komplexität des Unternehmens wird verringert, da die
Aufbau- und Ablauforganisation vereinfacht und der Aufwand für
Personalschulung und -betreuung verringert wird.
2.3.2 Risiken der Verringerung der Fertigungstiefe
30
Neben den Vorteilen ist eine Verringerung der Fertigungstiefe stets mit Risiken
verbunden. Mögliche Gefahren sind z.B.:
Die Fremdbezugskosten können, zumindest anfangs, über den variablen Kosten
der Eigenfertigung liegen. Dies kann so lange der Fall sein, bis die Fixkosten des
ausgelagerten Bereichs abgebaut sind.
Durch die Fremdvergabe steigt die Abhängigkeit von externen Zulieferern. Der
Aufwand in der Einkaufs- und Logistikabteilung zur Sicherstellung der
Liefertermine und Qualitätstreue wird sicherlich ansteigen.
Durch die Auslagerung von Produktionsbereichen wird technisches Wissen nach
außen gegeben, was die Wettbewerbssituation des Unternehmens schwächen
kann.
Durch Personalabbau oder -verlagerung ist das Betriebsklima gefährdet.
Nachdem das Outsourcing erst einmal erfolgt ist, die Kapazitäten abgebaut sind,
kann die Entscheidung nur unter großem Aufwand wieder rückgängig gemacht
werden.
Durch die Reduzierung der Fertigungstiefe gehen Identitätspotentiale verloren.
30
Vgl. Prof. Dr. Warschburger, V. und Hans, L.: Strategische und operative Outsourcing-
Entscheidungen, Controller Magazin 5/98, S. 334f
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
19
2.4 Entscheidungskriterien
Um eine hinreichende Entscheidung bezüglich Eigenfertigung oder Fremdbezug zu
treffen, müssen eine Vielfalt von Kriterien abgewogen werden. Die Gewichtung der
Kriterien hängt stark von der Art des Unternehmens, der Branche und den
Anforderungen ab. Eine kleine Auswahl an Faktoren werden in den folgenden
Kapiteln kurz beschrieben.
2.4.1 Kernkompetenz
Bei der Wahl zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug müssen Kernkompetenzen
herausgefiltert werden.
31
Der Begriff ,,Kernkompetenz" wird von Hinterhuber wie folgt definiert:
,,Kernkompetenzen sind integrierte und durch organisationale Lernprozesse
koordinierte Gesamtheiten von Technologien, Know-how, Prozessen und
Einstellungen, die für den Kunden erkennbar wertvoll sind, gegenüber der
Konkurrenz einmalig sind, schwer imitierbar sind und den Zugang zu einer Vielzahl
von Märkten öffnen."
32
Es ist dringend empfehlenswert die Kernkompetenzen und somit die strategisch
wichtigen Aktivitäten selbst auszuführen. Zur Fremdvergabe eignen sich dann alle
anderen Aktivitäten, die in anderen Unternehmen wiederum zur Kernkompetenz
zählen können und man so am Know-how dieses Anbieters teilhaben kann.
33
31
Vgl. Mikus, B.: Make-or-buy- Entscheidungen in der Produktion, Führungsprozesse
Risikomanagement Modellananlysen, Gabler Edition Wissenschaft, Deutscher Universitäts-Verlag,
Wiesbaden 1998, S. 67
32
Vgl. ebenda, seinerseits Hinterhuber, HH.: Strategische Unternehmensführung, Bd. 1: Strategisches
Denken: Vision, Unternehmenspolitik, Strategie, 6. Auflage, Berlin, New York 1996
33
Vgl. Mikus, B.: Make-or-buy, S. 67f
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
20
Diese Entscheidungshilfe führt jedoch meist nicht zum optimalen Ergebnis, weil sich
die Kernkompetenzen nicht immer so einfach erkennen und isolieren lassen. Eine
Kernkompetenz setzt voraus, dass diese Aktivität eine große Wettbewerbsstärke
darstellt und für den Kunden von enormer Wichtigkeit ist.
34
Die im Unternehmen vorhandenen Kernkompetenzen bilden die Grundlage für die
Entwicklung zukünftiger Potenziale. Deshalb ist es unbedingt wichtig, diese
Kenntnisse und Erfahrungen im Unternehmen zu erhalten, um auch in Zukunft
wettbewerbsfähig zu bleiben.
35
2.4.2 Qualität
Qualität kann definiert werden als ,,Güte des Produkts im Hinblick auf seine Eignung
für den Verwender".
36
Sind bestimmte Qualitätsanforderungen verbindlich festgelegt, spielen Unterschiede
in der Güte der bereitzustellenden Einsatzfaktoren eine große Rolle. Oftmals ist es
bei Spezialprodukten schwierig Lieferanten zu finden, welche bereit sind
Sonderfertigungen zu tätigen. Häufig liegt der Vorteil in der Eigenfertigung, wenn
z.B. ein Bauteil einen entscheidenden Einfluss auf das Endprodukt hat und somit die
Qualität besser überwacht werden kann. Auch gibt es eine unmittelbare
organisatorische Verbindung von Konstruktion und Entwicklung mit dem
Fertigungsprozess. So können diese Güter ständig verbessert und durch die Nähe zur
Qualitätssicherung Mängel schnell beseitigt werden. Bei sehr speziellen
34
Vgl. Mikus, B.: Make-or-buy, S. 68
35
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Shaker Verlag, Aachen 2002, Seite 37
36
Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Qualität
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
21
Bedürfnissen des Unternehmens ist die Eigenfertigung auch insofern sinnvoller, als
dafür geschultes Personal bereits vorhanden ist.
37
Auf der anderen Seite kann es sein, dass spezialisierte Hersteller Qualitätsvorteile
bieten, da sie einen darauf ausgelegten Maschinenpark haben, einen höheren
Aufwand für Forschung und Entwicklung betreiben und über umfassende
Erfahrungen verfügen. Des Weiteren kann man Lieferanten auf gewünschte
Qualitätsstandards festlegen und dies auch durch Stichproben kontrollieren.
38
Es ist jedoch nicht immer notwendig, sich für die beste Qualität zu entscheiden.
Besonders wichtig ist die Qualität jedoch bei allen Gütern, die eine lange
Lebensdauer haben. Das gleiche gilt für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten;
werden diese mit hoher Qualität ausgeführt, müssen sie nur in großen Zeitspannen
wiederholt werden.
39
Für viele Unternehmen bestehen für die Endprodukte strenge Qualitätsnormen, so
z.B. für die Pharmaindustrie, die Lebensmittelbranche oder für feinmechanische
Erzeugnisse und für alle Unternehmen, dessen Kunden gehobene Qualitätsansprüche
haben.
40
Liegen hohe Qualitätsanforderungen vor, ist die M.o.B.- bzw. Outsourcing-
Entscheidung abhängig davon, ob ein geeigneter Lieferant gefunden wird. Das heißt,
es können keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden. Welche
Entscheidung die richtige ist, hängt ab von der Marktstruktur, der Branche und der
Unternehmenszielsetzung.
41
37
Vgl. Berlien, O.: Controlling von Make-or-Buy, Verlag Wissenschaft & Praxis, Ludwigsburg-
Berlin, Band 1, 1993, S. 82f
38
Vgl. ebenda
39
Vgl. ebenda
40
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Shaker Verlag, Aachen 2002, Seite 27
41
Vgl. ebenda
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
22
2.4.3 Wirtschaftlichkeit
Da die Alternativen, Eigen- oder Fremdfertigung, die Höhe und Zusammensetzung
der Kosten stark beeinflussen, stellt dieses Entscheidungskriterium eine bedeutende
Zielgröße dar.
Bei vielen Unternehmen stellt der Kostenvergleich sicherlich das wichtigste
Kriterium dar, weil Outsourcing-Entscheidungen oft auf dem Ziel der
Kostenreduzierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beruhen. Auch in dem
vorliegenden Fall bei DaimlerChrysler ist die Kostenminimierung oberstes Ziel.
Welche Kosten bei der Kostenvergleichsrechnung berücksichtigt werden, wird im
folgenden Kapitel veranschaulicht. Die Theorie der Transaktionskosten wird im
anschließenden Abschnitt erläutert.
2.4.3.1
Kostenvergleichsrechnung
Die Kostenvergleichsrechnung ist wohl das in der Praxis am häufigsten verwendete
Instrument zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf Kostenbasis. Sie soll
unter Berücksichtigung aller relevanten Kosten dazu beitragen die
Handlungsalternative zu bestimmen, die für das Unternehmen den größtmöglichen
wirtschaftlichen Vorteil bringt. Es werden also Kosten der Eigenfertigung den
Kosten der Fremdvergabe (Marktpreis) gegenübergestellt.
42
Die Entscheidungsrelevanz der Kosten hängt stark von der Kurz- oder
Langfristigkeit und der Auslastung der Kapazitäten ab. Bei längerfristigen
Entscheidungen gilt grundsätzlich, dass mit zunehmender Länge des
Betrachtungszeitraums die Fixkosten in ihrer Veränderlichkeit steigen. Das heißt
42
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Band 1, Shaker Verlag ,Aachen, 2002, S. 51
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
23
über einen langen Zeitverlauf kann von einem stärkeren Abbau von
Fixkostenpotenzialen gesprochen werden.
In Tabelle 2 sind die wichtigsten Kosten aufgelistet, die beim Vergleich
gegenübergestellt werden:
Fremdbezug
Eigenfertigung
-
+
+
+
+
+
+
+
Marktpreis
Rabatte/Skonti
Transport
Zoll
Verpackung
Versicherung
höherer Aufwand in Einkauf und
Materialwirtschaft
evtl. höhere Lagerkosten
Vorlaufskosten für Verhandlungen,
Schulungen, ...
+
+
+
+
+
Variable Kosten
langfristig variable bzw.
kurzfristig fixe Kosten
Stilllegungskosten
Liquiditätserlös aus Verkauf von
Anlagen
Evtl. Neu- bzw. Ersatz-
investitionen
Opportunitätskosten
Tab. 2 Kostenvergleich Eigenfertigung und Fremdbezug
43
Die aufgezählten Kosten sind nur ein Auszug und können je nach Unternehmen,
Branche und Anlass variieren. Durch die möglicherweise höhere
Kapazitätsauslastung des Lieferanten können starke Kostenvorteile durch
Fremdvergabe entstehen, man spricht dann von economies of scale.
44
Die Definition der economies of scale:
,,In der klassischen Volkswirtschaftslehre gilt das Gesetz der steigenden
Skalenerträge (economies of scale). Demzufolge fallen die durchschnittlichen
43
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Band 1, Shaker Verlag ,Aachen, 2002, S. 51ff
44
Vgl. ebenda
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
24
Produktionskosten bei steigender Menge eines produzierten Gutes bis zu einem
Minimum, um allerdings danach wieder anzusteigen."
45
2.4.3.2
Transaktionskostentheorie
Transaktionskosten sind die Kosten, die entstehen, um Kontakt zu einem Lieferanten
aufzunehmen, Vereinbarungen zu treffen, deren Kontrolle und Anpassungen. Diese
Kosten für Kommunikation und Koordination können aufgeteilt werden in:
46
Anbahnungskosten
= Informationssuche und -beschaffung
Vereinbarungskosten
= Verhandlungskosten, Kosen für Vertragsschluss
Abwicklungskosten
= Kosten für Prozesssteuerung
Kontrollkosten
= Kosten für die Sicherstellung von Qualität, Terminen, Preisen und Mengen
Anpassungskosten
= Kosten für Änderungen während der Laufzeit der Vereinbarung
Diese Kosten entstehen im Regelfall beim Fremdbezug. In Ausnahmen entstehen sie
jedoch auch bei Eigenfertigung durch den Aufbau von internen Informations- und
Beschaffungswegen.
47
Die Transaktionskosten fallen sicherlich bei langfristigen Verträgen höher aus als bei
kurzfristigen Vereinbarungen, da dies eine intensivere Informationsbeschaffung und
45
Vgl. www.4managers.de/ 01-Themen/..%5C10-
Inhalte%5Casp%5CEconomiesofscale.asp?hm=1&um=E, Stand: 30. April 2004
46
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Band 1, Shaker Verlag ,Aachen, 2002, S. 72f
47
Vgl. ebenda
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
25
längere Verhandlungen mit sich bringt. Jedoch verteilen sich die höheren Kosten am
Anfang auf eine längere Zeit als bei kurzfristigen Verbindungen.
48
3 Basisdaten der Tschechischen Republik, Polen,
Rumänien und Ungarn
1992 wurde mit dem Maastricher Vertrag zugleich das Ziel der Europäischen Union
beschlossen und im April 2003 wurde in Athen der Vertrag zur Erweiterung der
Union unterzeichnet. Seit dem 01. Mai 2004 gehören zehn weitere Länder der
Europäischen Union an und erhöhen die Zahl der Mitgliedsländer auf 25 mit
insgesamt 450 Millionen Einwohnern. Unter ihnen Polen, Ungarn und die
Tschechische Republik, welche in den nachfolgenden Kapiteln näher unter die Lupe
genommen werden. Rumänien, das vierte Land das in dieser Arbeit untersucht wird,
wird voraussichtlich erst 2007 beitreten, der NATO-Beitritt am 01. Mai 2004 ist ein
Schritt der Annäherung. Alle vier Nationen, besonders Rumänien, liegen noch weit
hinter dem durchschnittlichen EU-Standard und bis zur Anpassung des Niveaus
werden noch einige Jahre verstreichen. Doch sind Vorteile sowohl für die ,,alten"
EU-Länder als auch für die Beitrittsländer eindeutig. Die neuen Mitgliedsstaaten sind
sowohl Absatzmärkte als auch Exportländer und somit gewinnt der europäische
Binnenmarkt stark an Gewicht. Gleichzeitig bedeutet die Vergrößerung der
Europäischen Union um knapp ein Drittel eine größere Zone für Frieden und
Stabilität besonders in den Regionen im Südosten. Durch die Erweiterung der EU
ist es für Unternehmen aus Gegenden mit hohen Arbeitskosten, wie z.B.
Deutschland, einfacher und weniger risikoreich, Standorte in den neuen
Beitrittsländern mit niedrigen Löhnen aufzubauen.
Sicher kommen mit der Erweiterung erhebliche Kosten auf die Union zu, doch
weisen die Beitrittsländer eine wirtschaftliche Entwicklung auf, die über dem
48
Vgl. von Herff, M.: Outsourcing-Entscheidungen, Band 1, Shaker Verlag ,Aachen, 2002, S. 72f
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
26
Wachstum in Deutschland bzw. der EU-15 liegt. Dennoch sind trotz dieser Dynamik
die Unterschiede noch gravierend, sogar innerhalb der EU-10.
Eine Rangliste, die die Wirtschaftsleistung der alten und neuen EU-Staaten
vergleicht, wird in Abb. 4 dargestellt; da Rumänien noch nicht zur Europäischen
Union gehört, fehlt hierfür der Wert in dem Schaubild.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Mankiw wie folgt definiert:
,,Das BIP ist der Marktwert aller für den Endverbrauch bestimmten Waren und
Dienstleistungen, die in einem Land in einem bestimmten Zeitabschnitt hergestellt
werden."
49
Die Berechnung des BIP sieht wie folgt aus:
Konsum/Privater Verbrauch + Investitionen + Staatsausgaben + Nettoexporte
(Y= C+I+G+NX)
Es wird deutlich, dass auch noch einige Staaten der EU-15 recht weit hinten in der
Rangliste angesiedelt sind, wie z.B. Portugal oder Irland. Jedoch sind die Werte
absolute Zahlen und nicht auf die Größe des Landes und die Einwohnerzahl bzw. die
Zahl der Erwerbstätigen bezogen. Polen liegt demnach nur so weit vorne, weil es das
größte der neuen EU-Länder ist, mit der größten Einwohnerzahl und nicht weil es am
produktivsten ist. Das Bruttoinlandsprodukt wird jedoch allgemein als
Hauptindikator des Wirtschaftsstandards verwendet. Betrachtet man die Werte des
BIP über eine Zeitfolge hinweg und nicht als statischen Wert, ist die Zahl sehr
aussagefähig, weil sie dann die wirtschaftliche Entwicklung verdeutlicht.
49
Vgl. Mankiw, N. G.: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart,
1999, S. 520
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
27
4,0
6,9
8,9
10,8
14,6
22,3
23,4
25,1
69,9
73,9
128,2
129,2
139,7
141,1
182,8
200,2
216,8
255,4
260,7
444,0
693,9
1.258,3
1.520,8
1.659,1
2.108,2
Malta
Estland
Lettland
Zypern
Litauen
Luxemburg
Slowenien
Slowakei
Ungarn
Tschechien
Irland
Portugal
Finnland
Griechenland
Dänemark
Polen
Österreich
Schweden
Belgien
Niederlande
Spanien
Italien
Frankreich
Großbritannien
Deutschland
Abb. 4 BIP im EU-Vergleich 2002 in Mrd. Euro
50
Um die Länder besser miteinander vergleichen zu können, ist es sinnvoller das BIP
pro Kopf zu betrachten. Die Abb. 5 zeigt das BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards
(KKS).
Die Ermittlung der Kaufkraftstandards (KKS):
Zur Eliminierung der Preisniveauunterschiede in den einzelnen Ländern wurden
spezielle Umrechnungskurse, so genannte Kaufkraftparitäten (KKP) verwendet. Zur
Umrechnung der Werte von der Landeswährung in eine gemeinsame Währung, den
KKS, wurden in den einzelnen Ländern geltende KKP für die Konsumausgaben der
50
Vgl. Wirtschaftskammer Österreich, Statistik von A-Z, Osteuropa Wirtschaftsdaten,
http://wko.at/statistik/a-bis-z.htm, Stand 30.04.2004
Stand: 2002
Eigenfertigung vs. Fremdfertigung oder Verlagerung
der Fertigung Schwerpunkt Osteuropa
Stefanie Jilg
28
privaten Haushalte herangezogen. Die somit erzielten Beträge spiegeln dadurch die
nationale Kaufkraft des Wertes wieder.
51
Das BIP pro Kopf erhält man, wenn man das Bruttoinlandsprodukt durch die
Bevölkerungszahl teilt. Diese Kennzahl sagt aus, was ein Bürger durchschnittlich
ausgibt.
Die Werte in Abb. 5 verstehen sich in Euro zu Kaufkraftparitäten, das heißt
angepasst an die Kaufkraft des Landes und sind aus dem Jahr 2002.
8400
9400
9600
10000
11300
12800
14900
16600
16600
17000
17000
18400
20700
23600
23900
24400
25100
25100
25600
25800
26600
26800
27000
30100
45300
Let t land
Est land
Slowakei
Tschechien
Slowenien
Griechenland
Spanien
Deut schland
Schweden
Belgien
Öst erreich
Dänemark
Luxemburg
Abb. 5 BIP je Einwohner im EU-Vergleich 2002 in Euro
52
51
Vgl. Eurostat, Statistik kurz gefasst, Bevölkerung und soziale Bedingungen, Thema 3 10/2003:
,,Mindestlöhne EU-Mitgliedstaaten und Kandidatenländer, Januar 2003", S. 7
52
Vgl. Vgl. Statistik von A-Z, Osteuropa Wirtschaftsdaten, http://wko.at/statistik/a-bis-z.htm, Stand
30.04.2004
Stand: 2002
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832482312
- ISBN (Paperback)
- 9783838682310
- DOI
- 10.3239/9783832482312
- Dateigröße
- 986 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Offenburg – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2004 (August)
- Note
- 1,1
- Schlagworte
- outsourcing make-or-buy lohnentwicklung arbeitskosten eu-erweiterung
- Produktsicherheit
- Diplom.de