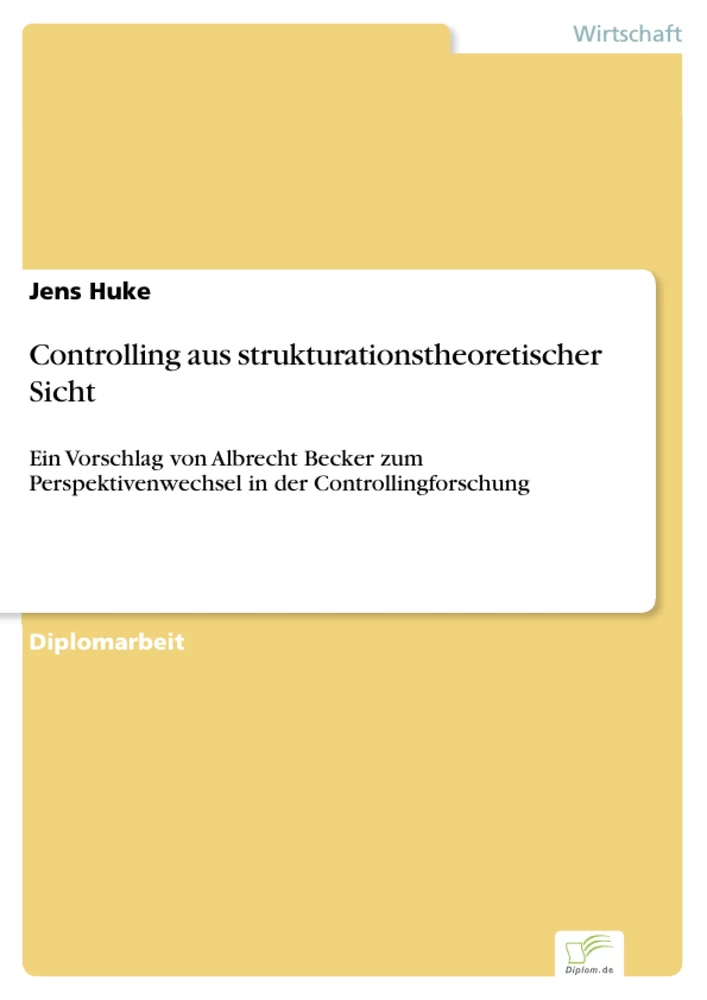Controlling aus strukturationstheoretischer Sicht
Ein Vorschlag von Albrecht Becker zum Perspektivenwechsel in der Controllingforschung
©2003
Diplomarbeit
73 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Eine anfängliche Modeerscheinung hat sich etabliert: Controlling ist heute ein fester Bestandteil der Unternehmensführung. Dies ist das Ergebnis der rasanten Entwicklung, die das Controlling in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat. zunächst waren es vornehmlich große Unternehmen, die Controllingabteilungen einrichteten. Heute ist Controlling auch in kleinen und mittleren Betrieben keine Seltenheit mehr. Sogar nicht erwerbswirtschaftliche Organisationen, wie etwa öffentliche Verwaltungen, Krankenhäuser, Universitäten, die Bundeswehr etc., bedienen sich zunehmend eines Controllings.
Mit der wachsenden Bedeutung des Controllings in der betrieblichen Praxis stieg auch das wissenschaftliche Interesse am Phänomen Controlling. Als Indiz für die wissenschaftliche Relevanz des Controllings seien die vermehrte Einrichtung von Controllinglehrstühlen an Hochschulen sowie die wachsende Anzahl controllingspezifischer Publikationen genannt.
Auch wenn Controlling in der betrieblichen Praxis als etabliert gelten kann, fehlt ein einheitliches Controllingkonzept. Empirische Untersuchungen zeigen sogar, dass die Aufgaben, die Controller in der betrieblichen Praxis übernehmen, stark differieren. Eine eindeutige Schwerpunktbildung ist in der betrieblichen Praxis kaum erkennbar. Ein einheitliches Controllingkonzept zu entwickeln, um die betriebliche Praxis nach diesen Vorstellungen zu gestalten, ist seit langem ein Ziel zahlreicher Wissenschaftler in der Controllingforschung. Der koordinationsorientierte Controllingansatz, der auf Horváth zurückgeht, schien hier lange Zeit den Weg zu weisen. Aufgrund seiner Bedeutung und Verbreitung darf die Forschung, die sich auf den Koordinationsgedanken stützt, als traditionelle Controllingforschung bezeichnet werden. In der jüngsten Vergangenheit wurden neben den traditionellen, koordinationsorientierten Controllingkonzepten neue Ansätze in der Controllingforschung entwickelt (Abschnitt 2.2). Zu diesen neuen Ansätzen gehört auch das strukturationstheoretische Konzept von Albrecht Becker.
Diesen Ansatz von Becker gilt es im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit näher zu beleuchten. Dabei ist zunächst zu verdeutlichen, warum der von Becker vorgeschlagene Perspektivenwechsel in der Controllingforschung überhaupt notwendig ist. Aus diesem Grund werden aus der Gruppe der traditionellen Ansätze zunächst die koordinationsorientierten Controllingkonzepte von Péter Horváth […]
Eine anfängliche Modeerscheinung hat sich etabliert: Controlling ist heute ein fester Bestandteil der Unternehmensführung. Dies ist das Ergebnis der rasanten Entwicklung, die das Controlling in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat. zunächst waren es vornehmlich große Unternehmen, die Controllingabteilungen einrichteten. Heute ist Controlling auch in kleinen und mittleren Betrieben keine Seltenheit mehr. Sogar nicht erwerbswirtschaftliche Organisationen, wie etwa öffentliche Verwaltungen, Krankenhäuser, Universitäten, die Bundeswehr etc., bedienen sich zunehmend eines Controllings.
Mit der wachsenden Bedeutung des Controllings in der betrieblichen Praxis stieg auch das wissenschaftliche Interesse am Phänomen Controlling. Als Indiz für die wissenschaftliche Relevanz des Controllings seien die vermehrte Einrichtung von Controllinglehrstühlen an Hochschulen sowie die wachsende Anzahl controllingspezifischer Publikationen genannt.
Auch wenn Controlling in der betrieblichen Praxis als etabliert gelten kann, fehlt ein einheitliches Controllingkonzept. Empirische Untersuchungen zeigen sogar, dass die Aufgaben, die Controller in der betrieblichen Praxis übernehmen, stark differieren. Eine eindeutige Schwerpunktbildung ist in der betrieblichen Praxis kaum erkennbar. Ein einheitliches Controllingkonzept zu entwickeln, um die betriebliche Praxis nach diesen Vorstellungen zu gestalten, ist seit langem ein Ziel zahlreicher Wissenschaftler in der Controllingforschung. Der koordinationsorientierte Controllingansatz, der auf Horváth zurückgeht, schien hier lange Zeit den Weg zu weisen. Aufgrund seiner Bedeutung und Verbreitung darf die Forschung, die sich auf den Koordinationsgedanken stützt, als traditionelle Controllingforschung bezeichnet werden. In der jüngsten Vergangenheit wurden neben den traditionellen, koordinationsorientierten Controllingkonzepten neue Ansätze in der Controllingforschung entwickelt (Abschnitt 2.2). Zu diesen neuen Ansätzen gehört auch das strukturationstheoretische Konzept von Albrecht Becker.
Diesen Ansatz von Becker gilt es im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit näher zu beleuchten. Dabei ist zunächst zu verdeutlichen, warum der von Becker vorgeschlagene Perspektivenwechsel in der Controllingforschung überhaupt notwendig ist. Aus diesem Grund werden aus der Gruppe der traditionellen Ansätze zunächst die koordinationsorientierten Controllingkonzepte von Péter Horváth […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7807
Huke, Jens: Controlling aus strukturationstheoretischer Sicht - Ein Vorschlag von
Albrecht Becker zum Perspektivenwechsel in der Controllingforschung
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Universität der Bundeswehr Hamburg, Universität der Bundeswehr, Diplomarbeit,
2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
II
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... IV
1 Einleitung ...
1
2 Analyse des gegenwärtigen Controllingverständnisses ...
4
2.1 Zielsetzungen wissenschaftlichen Arbeitens ...
4
2.2 Systematisierung der Controllingkonzepte ...
7
2.2.1 Die koordinationsorientierten Ansätze ...
9
2.2.2 Der rationalitätssicherungsorientierte Ansatz ... 14
2.2.3 Zusammenfassung ... 16
2.3 Kritische Betrachtung der Controllingkonzepte ... 18
2.3.1 Begründung des Controllings ... 18
2.3.2 Controlling im klassischen Managementkonzept ... 21
2.3.3 Kritische Betrachtung des klassischen Managementkonzeptes ... 24
2.3.4 Koordination als Aufgabe des Controllings ? ... 27
2.4 Anforderungen an ein konsistentes Controllingkonzept ... 29
3 Die Theorie der Strukturierung als organisationstheoretische Basis ... 30
3.1 Das Konzept des Handelnden und des Handelns ... 31
3.2 Das Konzept der Dualität von Struktur ... 39
3.3 Die Modalitäten im Konzept der Dualität von Struktur ... 46
III
4 Controlling als reflexive Steuerung ... 48
4.1 Organisationen und Unternehmen als besondere soziale Systeme ... 49
4.2 Der Controllingbegriff aus strukturationstheoretischer Perspektive ... 51
4.3 Das Controllingkonzept von Becker im Modell der Dualität von Struktur ... 55
5 Fazit ... 61
Literaturverzeichnis ... 65
IV
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Hempel-Openheim-Schema (modifiziert) ...
4
Abbildung 2: Die Einbettung des Controllingsystems bei Horváth ... 11
Abbildung 3: Die Einbettung des Controllingsystems bei Küpper ... 12
Abbildung 4: Primat der Planung ... 23
Abbildung 5: Logik der Ergänzung des Zwecks durch das Mittel ... 28
Abbildung 6: Kern des Stratification Model of the Agent ... 37
Abbildung 7: Stratification Model of the Agent ... 39
Abbildung 8: Dualität von Struktur ... 42
Abbildung 9: Rekursivität zwischen den Dimensionen des Sozialen ... 44
Abbildung 10: Die Modalitäten der Strukturation - Der zugleich kontextfreie-
und- kontextabhängige Mechanismus der Dualität von Struktur ... 48
Abbildung 11: Controlling und die Modalitäten der Strukturation ... 56
1
1 Einleitung
Eine anfängliche Modeerscheinung hat sich etabliert: Controlling ist heute ein fester
Bestandteil der Unternehmensführung. Dies ist das Ergebnis der rasanten Entwicklung,
die das Controlling in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat.
Zunächst waren es vornehmlich große Unternehmen, die Controllingabteilungen
einrichteten. Heute ist Controlling auch in kleinen und mittleren Betrieben keine
Seltenheit mehr.
1
Sogar nicht erwerbswirtschaftliche Organisationen, wie etwa
öffentliche Verwaltungen, Krankenhäuser, Universitäten, die Bundeswehr etc.,
bedienen sich zunehmend eines Controllings.
Mit der wachsenden Bedeutung des Controllings in der betrieblichen Praxis stieg auch
das wissenschaftliche Interesse am Phänomen Controlling. Als Indiz für die
wissenschaftliche Relevanz des Controllings seien die vermehrte Einrichtung von
Controllinglehrstühlen an Hochschulen sowie die wachsende Anzahl
controllingspezifischer Publikationen genannt.
2
Auch wenn Controlling in der betrieblichen Praxis als etabliert gelten kann, fehlt ein
einheitliches Controllingkonzept. Empirische Untersuchungen zeigen sogar, dass die
Aufgaben, die Controller in der betrieblichen Praxis übernehmen, stark differieren. Eine
eindeutige Schwerpunktbildung ist in der betrieblichen Praxis kaum erkennbar.
3
Ein
einheitliches Controllingkonzept zu entwickeln, um die betriebliche Praxis nach diesen
Vorstellungen zu gestalten, ist seit langem ein Ziel zahlreicher Wissenschaftler in der
Controllingforschung. Der koordinationsorientierte Controllingansatz, der auf Horváth
zurückgeht, schien hier lange Zeit den Weg zu weisen. Aufgrund seiner Bedeutung und
Verbreitung darf die Forschung, die sich auf den Koordinationsgedanken stützt, als
,,traditionelle" Controllingforschung bezeichnet werden. In der jüngsten Vergangenheit
wurden neben den ,,traditionellen", koordinationsorientierten Controllingkonzepten
,,neue" Ansätze in der Controllingforschung entwickelt (Abschnitt 2.2). Zu diesen
,,neuen" Ansätzen gehört auch das strukturationstheoretische Konzept von Albrecht
Becker.
1
Vgl. Küpper, H.-U., Instrumente, 2001, S. 1f.
2
Vgl. Küpper, H.-U., Instrumente, 2001, S. 3.
3
Vgl. Küpper, H.-U., Instrumente, 2001, S. 2; Horváth, P., Controlling, 2002, S. 17ff; Amshoff, B.,
Realtypen, 1993, S. 344ff.
2
Diesen Ansatz von Becker gilt es im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit näher zu
beleuchten. Dabei ist zunächst zu verdeutlichen, warum der von Becker vorgeschlagene
Perspektivenwechsel in der Controllingforschung überhaupt notwendig ist. Aus diesem
Grund werden aus der Gruppe der ,,traditionellen" Ansätze zunächst die
koordinationsorientierten Controllingkonzepte von Péter Horváth und Hans-Ulrich
Küpper vorgestellt. Aus dem Bereich der ,,neuen" Controllingkonzepte wird die
Argumentation von Jürgen Weber und Utz Schäffer in ihrem
rationalitätssicherungsorientierten Ansatz expliziert, denn auch diese ersten Versuche,
die Controllingforschung neu zu beleben, greifen nach Becker zu kurz.
Seine Kritik beruht darauf, dass diese Controllingansätze auf der
organisationstheoretischen Basis des klassischen Managementkonzeptes basieren.
Demgemäß geht jegliche Koordinationsleistung von der betrieblichen Planung aus.
Gleichzeitig versteht die Controllingwissenschaft die Koordination des
Führungssystems als Kernfunktion des Controllings. Begründet wird die Notwendigkeit
dieser zusätzlichen Koordination durch das Controlling mit der zunehmenden Dynamik
und Komplexität der Unternehmensumwelt. Es wird folglich ein Koordinationsversagen
des klassischen Managementkonzeptes behauptet.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird argumentiert, dass die Controllingwissenschaft
eine Begründung dieses Koordinationsversagens schuldig bleibt und ihre
Begründungsstrategie damit inkonsistent wird (Abschnitt 2.3.1). Auf dem Weg zur
Begründung der Notwendigkeit eines Perspektivenwechsels wird anschließend gezeigt,
dass das klassische Managementverständnis als theoretische Basis für ein
Controllingkonzept ungeeignet ist (Abschnitte 2.3.2; 2.3.3). Darüber hinaus wird die
Koordination als Aufgabe des Controllings in Frage gestellt (Abschnitt 2.3.4).
Anschließend werden Anforderungen an ein konsistentes Controllingverständnis
erarbeitet.
Grundlage der Controllingkonzeption von Becker ist der bereits angesprochene
Perspektivenwechsel. War die Controllingforschung bis dato darum bemüht, die
Realität nach Maßgabe des jeweiligen Controllingverständnisses zu gestalten, strebt
Becker mit seinem Konzept die Erklärung der beobachtbaren Controllingpraxis an.
Damit ist nicht mehr die Vorstellung davon, was Controlling sein soll, also das
Controllingkonzept, sondern die beobachtbare Realität dessen, was Controlling ist, also
die Controllingpraxis, Ausgangspunkt der Argumentation.
3
Zur Erklärung der Controllingpraxis bedient sich Becker der Strukturationstheorie,
deren grundlegende Argumentation im Abschnitt drei dargelegt wird. Anschließend
geht es darum herauszustellen, wie Becker das Controlling aus
strukturationstheoretischer Sicht konzeptualisiert (Abschnitt 4).
Abschließend wird geprüft, in wieweit dieses Controllingverständnis Becker's den
aufgestellten Anforderungen genügt (Abschnitt 5).
4
2 Analyse des gegenwärtigen Controllingverständnisses
Voraussetzung für das Verständnis der nachfolgenden Argumentation ist das Wissen
um die Bedeutung und die Verschiedenartigkeit der Zielsetzungen in der Wissenschaft,
speziell in der Betriebswirtschaftslehre. Aus diesem Grund werden zunächst einige
methodologischen Basisüberlegungen angestellt.
2.1 Zielsetzungen wissenschaftlichen Arbeitens
Wissenschaft als bewusst praktiziertes, soziales Unternehmen erfolgt nicht
selbstzweckhaft. Jeder Wissenschaftler steckt Ziele für seine Arbeit ab und auch die
Gesellschaft hegt Erwartungen darüber, was Wissenschaft zu leisten hat.
1
Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur unterscheidet meist zwischen zwei
Wissenschaftszielen: einem erklärenden und einem pragmatischen.
2
Bevor auf die
Beziehung der Ziele zueinander eingegangen wird, soll zunächst erläutert werden,
welches Verständnis von Wissenschaft sich hinter den Zielen verbirgt.
Das Wissenschaftsziel des Erklärens, Habersam bezeichnet es auch als die
Erklärungsaufgabe der Wissenschaft
3
, besteht darin, einen individuellen Sachverhalt der
Realität zu erklären. Eine Erklärung sucht nach dem ,,Warum" ein fraglicher
Sachverhalt so und nicht anders eingetreten ist. Um den logischen Aufbau einer
wissenschaftlichen Erklärung der Wirklichkeit zu verdeutlichen, wird häufig das
Hempel - Oppenheim - Schema herangezogen (Vgl. Abb. 1).
1. Randbedingung(en)
2. Gesetz
3. Explanandum
Abbildung 1: Hempel-Oppenheim-Schema (modifiziert).
4
Dabei greift der Wissenschaftler auf die vorhandenen Theorien zurück.
1
Der zu
erklärende Sachverhalt (Explanandum) wird demnach dadurch erklärt, dass eine
1
Vgl. Fischer-Winkelmann, W.F., Methodologie, 1971, S. 23ff.
2
Vgl. Fischer-Winkelmann, W.F., Methodologie, 1971, S. 24; Habersam, M., Evaluation, 1997, S. 63f;
Schanz, G., Betriebswirte, 1988, S.56.
3
Vgl. Habersam, M., Evaluation, 1997, S. 64.
4
Vgl. Schauenberg, B., Methoden, 1998, S. 49f.
Explanans
5
Theorie gefunden wird und bestimmte singuläre Anfangs- bzw. Randbedingungen
(Explanans) logisch erfüllt sind, aus denen das Explanandum logisch folgt. Dieses
Ableiten des Besonderen (Explanandum) aus dem Allgemeinen (Explanans,
Randbedingungen) wird als Deduktion bezeichnet.
2
Dabei werden die Gesetze als
allgemeingültige, erklärende ,,Wenn-Dann"-Aussagen verstanden. Die
Randbedingung(en) beziehen sich auf die ,,Wenn-Komponente" eines Gesetzes. Dem
gegenüber steht der zu erklärende Sachverhalt, welcher sich auf die ,,Dann-
Komponente" desselben Gesetzes bezieht. Die Erklärung beginnt folglich stets mit der
Suche nach einem Gesetz / einer Theorie, mit dessen / deren Hilfe das Explanandum
erklärt werden kann.
3
Damit aber die Erklärung eines Sachverhalts befriedigend ist, genügt es nicht, dass das
Explanandum aus dem Explanans logisch folgt. Darüber hinaus darf das Explanandum
nicht der einzig überprüfbare Fall des Explanans sein. Dadurch sind so genannte ad-hoc
Erklärungen ausgeschlossen.
4
Dem gegenüber steht das pragmatische Wissenschaftsziel. Hier geht es darum, die
unternehmensbezogene Realität in der intendierten Weise zu gestalten. Dabei soll der
gegenwärtige Ist-Zustand mit dem angestrebten Soll-Zustand in Übereinstimmung
gebracht werden. Um dieses Ziel zu erreichen werden der Praxis zielgerichtete
Handlungsmöglichkeiten bereitgestellt.
5
Diese erhält man ebenfalls durch Deduktion.
Allerdings geht man jetzt - im Gegensatz zum Erklären - davon aus, dass neben dem
Explanandum auch die Theorie bekannt ist, da sie im vorausgegangenen Erklärungsakt
gefunden wurde. Gesucht werden Handlungsmöglichkeiten, die die
Anfangsbedingungen realisieren, und aus denen zusammen mit der Theorie das
Explanandum logisch folgt. Somit wird deutlich, dass zunächst das Erklären stattfinden
muss, da nur so die Theorie für die Gestaltungsaufgabe als gegeben angenommen
werden kann.
6
Andernfalls wäre die Gestaltungsaufgabe eine Gleichung mit zwei
Unbekannten und damit nicht lösbar. Die beiden Ziele wissenschaftlichen Arbeitens
sind folglich ,,zwei Seiten ein und der derselben Sache"
7
.
1
Vgl. Fischer-Winkelmann, W.F., Methodologie, 1971, S. 23f.
Kann der Wissenschaftler die Erklärung mit Hilfe bekannter Theorien nicht leisten, so muss er zunächst
eine neue Theorie entwickeln. Darauf wird hier nicht näher eingegangen.
2
Vgl. Schanz, G., Einführung, 1975, S. 76.
3
Vgl. Schauenberg, B., Methoden, 1998, S. 49f.
4
Vgl. Popper, K.R., Erkenntnis, 1984, S.364f; Schanz, G., Betriebswirte, 1988, S.59f.
5
Vgl. Chmielewicz, K., Wissenschaftsziele, 1978, S. 438ff; Habersam, M., Evaluation, 1997, S. 64.
6
Vgl. Popper, K.R., Erkenntnis, 1984, S.366f.
7
Vgl. Popper, K.R., Erkenntnis, 1994, S.362.
6
Dennoch sind erklärende Aussagen empirisch anders geartet als pragmatisch-normative
Aussagen. Erklärende Aussagen behaupten etwas über das Sein. Sie sind damit -
berücksichtigt man die wahrnehmungstheoretischen Probleme - unmittelbar empirisch
prüfbar. Hingegen behaupten pragmatisch-normative Aussagen nur etwas über das
Sollen. Hält sich keiner an die Empfehlung, wäre es verfehlt anzunehmen, sie sei falsch.
Pragmatisch-normative Aussagen lassen sich so nicht unmittelbar prüfen. Lediglich die
Folgen, die sich ergeben, wenn sich jemand an die Empfehlungen hält, sind empirisch
prüfbar.
Aus dem Erklärungs- oder Gestaltungsziel wird damit ein Erklärungs- und
Gestaltungsziel, im Rahmen dessen die Praxis in Unternehmen stets der Ausgangspunkt
ist und sein muss.
1
Hier setzt die Kritik Albrecht Beckers bezüglich der traditionellen
Controllingwissenschaft an. Sie beurteilt die Controllingpraxis anhand des
Übereinstimmungsgrades mit der Sollvorstellung und erarbeitet entsprechende
Handlungsempfehlungen zur Erreichung dieses ,,one best way". Es wird, der bisherigen
Argumentation folgend, also der zweite vor dem ersten Schritt gemacht, da die
Erklärung der sozialen Praxis des Controllings in Organisationen vernachlässigt wird.
Nur im Zuge der Erklärung des Sachverhalts kann aber die Theorie gefunden werden,
mit deren Hilfe anschließend die Realität gestaltet werden soll. Die traditionellen
Controllingansätze sind somit nicht in der Lage den realen Sachverhalt des Controllings
ausreichend zu erklären.
2
Ausgehend von diesen Kritikpunkten entwickelt Becker sein Verständnis von
Controlling. Er macht dabei den ersten Schritt vor dem zweiten und zielt zunächst auf
die Erklärung des Controllings aus seiner organisationalen Praxis heraus.
In der Argumentation Poppers bedeutet dies, dass die beobachtbare Controllingpraxis
den zu erklärenden realen Sachverhalt (Explanandum) darstellt. Zur Deduktion des
Explanandums bedient sich Becker der Strukturationstheorie. Aus der ,,Wenn-
Komponente" der Theorie lässt sich schlussfolgern, welche Anfangsbedingungen
vorliegen müssen, damit aus der gewählten Theorie / dem allgemeinen Gesetz die
Beobachtung folgt. In einem zweiten Schritt ist dann zu prüfen, ob mindestens eine
dieser Anfangsbedingungen vorgelegen hat. Ist dies der Fall, so kann der Sachverhalt
erklärt werden. Dieses Vorgehen zur Ermittlung der Anfangsbedingung(en) bezeichnet
man als Abduktion.
1
Vgl. Habersam, M., Evaluation, 1997, S. 64.
2
Vgl. Becker, A., Steuerung, 2003, S. 45, 59f; Habersam, M., Evaluation, 1997, S. 64ff.
7
2.2 Systematisierung der Controllingkonzepte
Bevor näher auf die Darstellung und die Kritik an den traditionellen
Controllingansätzen und die damit verbundene Vorstellung, wie Controlling in die
Organisation und den Managementprozess einzubinden ist, eingegangen wird, soll
zunächst eine Systematisierung der verschiedenen bestehenden Konzepte erfolgen. Ein
Controllingkonzept wird hier verstanden als ,,Aussagen über die funktionale
Abgrenzung, die institutionelle Gestaltung sowie die instrumentelle Unterstützung des
Controlling vor dem Hintergrund controllingrelevanter Unternehmensziele"
1
.
In Anlehnung an die Systematik von Gotthard Pietsch und Ewald Scherm wird hier
zunächst zwischen ,,traditionellen" und ,,neuen" Controllingkonzepten differenziert.
2
Diese Unterscheidung zielt nicht auf eine Wertung der Konzepte, sondern kennzeichnet
die neu entfachte Diskussion um das Controllingverständnis.
In der Gruppe der traditionellen Controllingkonzepte ist zwischen drei verschiedenen
Ansätzen zu unterscheiden.
Dies sind zunächst die rechnungswesenorientierten Konzepte. Dem Controlling kommt
hier die Aufgabe der Informationsversorgung, zum Zweck der Erreichung monetärer
Ziele (z.B. Gewinnziel) zu. Der Name dieser Konzepte resultiert daraus, dass das
Controlling seine Aufgabe hauptsächlich mit Daten aus dem Rechnungswesen erfüllt.
Kritisiert wird an diesen Konzepten vor allem, dass das Controlling seine Aufgabe nur
erfüllen kann, wenn der zu berücksichtigende Sachverhalt auch quantifizierbar ist. Eine
Vielzahl der für eine Unternehmung relevanten Einflussfaktoren genügt dieser
Anforderung jedoch nicht. Der Aufgabenbereich des Controllings ist folglich nicht weit
genug gefasst. Er deckt sich weitgehend mit dem des betrieblichen Rechnungswesens.
Küpper sieht aus diesem Grund die Notwendigkeit einer Controllingfunktion, zusätzlich
zu der des Rechnungswesens als nicht gegeben.
3
Einen solchen eigenständigen Problembereich, der die betriebliche Teildisziplin des
Controllings rechtfertigen würde, sieht Becker auch bei den
informationssystemorientierten Controllingkonzepten - der zweiten Gruppe
traditioneller Ansätze - als nicht gegeben.
4
Grund für diese Einschätzung ist, dass trotz
der Ausweitung des Aufgabenbereichs des Controllings auf die Bereitstellung von
1
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Präzisierung, 2000, S. 395.
2
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Konzeptionen, 2001, S. 206f.
3
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Präzisierung, 2000, S. 396f.
4
Anders lautende Einschätzung: Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Präzisierung, 2000, S. 397.
8
Informationen zur Erreichung nichtmonetärer Ziele, die Tätigkeitsfelder von
Controlling und Rechnungswesen einander weitgehend entsprechen.
1
Am weitesten verbreitet sind die koordinationsorientierten Konzeptionen des
Controllings. Ausgangspunkt der Betrachtungen dieser dritten Art von Ansätzen ist die
Auffassung der Vertreter dieses Ansatzes, dass auf Grund der zunehmenden
Komplexität des betrieblichen Geschehens und der Umwelt das Führungssystem immer
stärker in Teilsysteme ausdifferenziert wird. Dem Controlling kommt deshalb die
Aufgabe der Koordination dieser Teilsysteme zu. In Abhängigkeit vom
Koordinationsumfang wird bei diesem dritten Ansatz zwischen zwei Varianten
unterschieden. Ist die Aufgabe des Controllings auf die Koordination der
Führungssubsysteme Planung und Kontrolle beschränkt, wird von planungs- und
kontrollorientierten Konzepten gesprochen. Demgegenüber spricht man von
führungsgesamtsystembezogenen Konzeptionen, wenn das Controlling alle Teilsysteme
des Führungssystems miteinander koordinieren soll.
2
Die Abgrenzungsproblematik zur
Unternehmensführung sowie weitere Kritikpunkte an diesem Ansatz werden im Kapitel
2.3 expliziert.
Zur Gruppe der neuen Controllingkonzepte, zählen ebenfalls drei Ansätze.
Dies ist zum Ersten das von Weber und Schäffer erarbeitete Konzept, in welchem dem
Controlling die Aufgabe der Sicherstellung von Führungsrationalität zugeordnet wird.
Je nachdem, wo ein Rationalitätsengpass vorliegt, kommt entweder die
Koordinationsfunktion oder die Informationsfunktion zum tragen. Hier werden folglich
traditionelle Konzepte integriert.
3
Der zweite Ansatz ist von Pietsch und Scherm, die die Aufgabe des Controllings in der
Wahrnehmung einer Führungs- und Führungsunterstützungsfunktion sehen. Dabei
werden die Gedanken zum Reflexionsbegriff, zur Koordinationsfunktion und zur
Informationsaufgabe des Controllings aufgegriffen und weiterentwickelt.
Ausgangspunkt der Argumentation ist die Unterteilung des Unternehmens in eine
Führungs-, eine Führungsunterstützungs- und eine Ausführungsebene. Darüber hinaus
wird das Controlling als vierte Führungsfunktion neben Planung, Organisation und
Personalführung verstanden. Die Führungsaufgabe des Controllings wird darin gesehen,
dass die von den anderen Führungsfunktionen getroffenen Entscheidungen sowie die
1
Vgl. Becker, A., Steuerung, 2003, S. 9.
2
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Konzeptionen, 2001, S. 207.
3
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Präzisierung, 2000, S. 399ff.
9
Abstimmung zwischen diesen reflektiert, also aus einer gewissen Distanz kritisch
betrachtet werden. Controlling geht damit über die auf die Planung ausgerichtete
Kontrolle hinaus. Zu beachten ist ebenfalls, dass das Controlling im hier verstandenen
Sinn nicht selbst koordiniert, sondern nur zu einer effektiven Koordination auf der
Führungsebene beiträgt. Die Führungsunterstützungsfunktion des Controllings besteht
darin, die zur Reflexion notwendigen Informationen bereitzustellen. Die
Führungsfunktion bedingt damit die Führungsunterstützungsfunktion des Controllings.
1
Im Rahmen dieser Arbeit wird auch der von Albrecht Becker vor kurzem erarbeitete
Ansatz den neuen Controllingkonzepten zugeordnet, wenngleich mit diesem
Verständnis von Controlling - als der reflexiven Steuerung von Organisationen - eine
neue Richtung in der Controllingforschung eingeschlagen wird. Becker setzt zur
Entwicklung seines Konzeptes bei der Erklärung der Controllingpraxis an und vollzieht
damit einen Perspektivenwechsel.
2
Dazu bedient er sich der von dem englischen
Soziologen, Anthony Giddens, erarbeiteten Theorie der Strukturierung / der
Strukturationstheorie. Der Ansatz Albrecht Beckers steht im Mittelpunkt dieser Arbeit
und wird in den Abschnitten drei und vier eingehend beleuchtet.
2.2.1 Die koordinationsorientierten Ansätze
Die koordinationsorientierten Ansätze sind in der Betriebswirtschaftslehre am weitesten
verbreitet. Sie wurden besonders durch die Arbeiten von Péter Horváth und Hans-Ulrich
Küpper geprägt.
3
Horváth begründet die Notwendigkeit des Controllings in Unternehmen mit der
zunehmenden Komplexität. Dies betrifft zunächst die Unternehmensumwelt, die
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Anzahl relevanter Einflussfaktoren stark zunimmt
und gleichzeitig die Stabilität dieser Größen immer mehr schwindet. Infolgedessen
steigt die Ausdifferenzierung der Führungsstruktur in den Unternehmen. Ebenfalls zu
beobachten ist, dass die Größe der Unternehmen immer mehr zunimmt. Um die
Erreichbarkeit der vielfältigen Unternehmensziele unter diesen Gegebenheiten dennoch
zu gewährleisten, sieht Horváth die Notwendigkeit einer zusätzlich
Koordinationsinstanz innerhalb der Unternehmensführung als gegeben an. Als solche
1
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Präzisierung, 2000, S. 402ff.
2
Vgl. Becker, A., Steuerung, 2003, S. 4ff.
3
Vgl. Pietsch, G. / Scherm, E., Konzeptionen, 2001, S. 207.
10
versteht er das Controlling.
1
Horváth geht also bei seinen Überlegungen davon aus, dass
die sonst üblichen Koordinationsinstrumente, wie etwa Planung und Hierarchie, diese
komplexer gewordenen Koordinationsaufgabe nicht erfüllen können.
Als organisationstheoretische Basis für seine Controllingkonzeption wählt Horváth die
Systemtheorie, da ihm diese die Möglichkeit bietet, die Komplexität in einer
realitätsnahen Art und Weise darzustellen. Ein weiterer Vorzug besteht für ihn darin,
dass es dieser Ansatz erlaubt die Beziehungen zwischen austauschbaren Elementen zu
untersuchen. Der Definition von Ulrich folgend, bildet die geordnete Gesamtheit von
Elementen (kleinste Einheit des Systems) ein System.
2
Die Systemelemente sind durch
verschiedenartige Beziehungen miteinander verbunden. Organisationen sind aus Sicht
der Systemtheorie eine spezielle Klasse von Systemen.
3
Organisationen /
Unternehmungen zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass sie komplexe Systeme sind,
da die große Anzahl der verschiedenen Beziehungen zwischen den Elementen, zu denen
auch der Mensch gehört, nicht lückenlos erfasst werden kann. Als weiteres Kennzeichen
der Unternehmung ist zu nennen, dass es sich um ein offenes System handelt, welches
über vielseitige Beziehungen seine Umwelt beeinflusst und entsprechend auch von
dieser beeinflusst wird. Infolgedessen ist die Organisation auch ein dynamisches
System, da es sich bei Einwirken einer Störung zielorientiert selbst reguliert.
4
Der
Systemansatz beschreibt dabei die Anpassung des Systems an bereits eingetretene
Änderungen mit Hilfe des Regelkreismodells bzw. an bevorstehende Änderungen durch
das Modell vom Steuerkreis.
5
Horváth unterscheidet im System der Unternehmung zwischen einem Führungs- und
einem Ausführungssystem (Vgl. Abb. 2). Aufgabe des Führungssystems ist es, das
Ausführungssystem so zu koordinieren, dass die gegebenen Ziele erreicht werden
(Primärkoordination). Horváth differenziert das Führungssystem in die drei Subsysteme
Planung und Kontrolle, Informationsversorgung und Koordination (also Controlling).
Voraussetzung für die erfolgreiche Primärkoordination ist die Abstimmung im
Führungssystem selbst. Diese Aufgabe der Sekundärkoordination obliegt dem
Controlling. Sie besteht darin, das Planungs- und Kontrollsystem
(Informationsverwendung) mit dem Informationsversorgungssystem
1
Vgl. Horváth, P., Controlling, 2002, S. 3ff.
2
Vgl. Ulrich, H., System, 1970, S.105ff, 134ff.
3
Vgl. Horváth, P., Controlling, 2002, S. 97f.
4
Vgl. Ulrich, H., System, 1970, S.111ff, 158ff; Horváth, P., Controlling, 2002, S. 100.
5
Vgl. Becker, A., Steuerung, 2003, S. 18.
11
(Informationsbeschaffung) abzustimmen.
1
Die Koordination durch das Controlling soll
dabei stets auf die Ergebnisziele des Unternehmens ausgerichtet sein, wodurch indirekt
auch die Erreichung der Sachziele gefördert wird.
2
Abbildung 2: Die Einbettung des Controllingsystems bei Horváth.
3
Bei der Koordination ist grundsätzlich zwischen systembildender und systemkoppelnder
Koordination zu unterscheiden. Die systembildende Koordinationsaufgabe des
Controllings beinhaltet zunächst die Erarbeitung und organisationale Ausgestaltung
eines Planungs- und Kontrollsystems sowie eines Informationsversorgungssystems, um
den Einfluss zukünftiger Störungen auf das Unternehmen zu minimieren. Der Controller
nimmt somit Aufgaben der Organisation wahr. Anschließend sind die Handlungen in
den einzelnen Subsystemen aufeinander abzustimmen. Dazu kanalisiert der Controller
die Informationsnachfrage der Subsysteme in Richtung des
Informationsversorgungssystems.
Die systemkoppelnde Koordination wird hingegen auf Grundlage einer vorhandenen
Systemstruktur praktiziert. Hier werden die Störungen beseitigt, die trotz der
systembildenden Koordination auftreten. Dazu passt der Controller die
Informatiosverbindungen zwischen den Subsystemen an die eingetretenen Änderungen
an und ermöglicht damit den permanenten Informationsfluss.
4
1
Vgl. Horváth, P., Controlling, 2002, S. 116, 129.
2
Vgl. Becker, A., Steuerung, 2003, S. 12f.
3
Vgl. Horváth, P., Controlling, 2002, S. 117.
4
Vgl. Sjurts, I., Kontrolle, 1995, S. 191f.
12
Eine alternative, ebenfalls koordinationsorientierte Controllingkonzeption wurde von
Hans - Ulrich Küpper erarbeitet. Den Ausgangspunkt der Betrachtungen bei Küpper
bilden die von ihm erarbeiteten Anforderungen an das Controlling, deren Erfüllung er
als Voraussetzung dafür versteht, dass das Controlling als eigenständige Teildisziplin
der Betriebswirtschaftslehre anerkannt werden kann. So muss das zu erarbeitende
Controllingkonzept neben einer theoretischen Fundierung und der Bewährung in der
Praxis vor allem eine eigenständige, einheitliche und klar abgrenzbare Problemstellung
aufweisen.
1
Als solche identifiziert Küpper die Koordination des gesamten Führungssystems, da
dieser Aufgabenbereich erst durch die zunehmende Ausdifferenzierung des
Führungssystems entstanden ist und somit nicht von anderen Teildisziplinen
beansprucht wird.
2
Warum diese Aufspaltung des Führungssystems stattfindet, wird
nicht begründet.
3
Die Koordinationsaufgabe des Controllings nach Küpper geht weiter
als die nach Horváth. Damit wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass zum einen
im Zuge der systembildenden Koordination Strukturen geschaffen werden und damit
eine Interaktion mit der Organisation stattfinden muss. Zum anderen wird die
verhaltensbeeinflussende Wirkung der Koordination berücksichtigt. Infolgedessen
treten im Konzept Küppers die Personalführung und die Organisation als weitere, neben
den von Horváth genannten, Subsysteme des Führungssystems hinzu (Vgl. Abb. 3).
4
Abbildung 3: Die Einbettung des Controllingsystems bei Küpper.
5
1
Vgl. Küpper, H.-U., Instrumente, 1997, S. 4f.
2
Vgl. Küpper, H.-U., Instrumente, 1997, S. 15ff.
3
Vgl. Sjurts, I., Kontrolle, 1995, S. 196.
4
Vgl. Becker, A., Steuerung, 2003, S. 18f.
5
Vgl. Küpper, H.-U., Instrumente, 2001, S. 15.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832478070
- ISBN (Paperback)
- 9783838678078
- DOI
- 10.3239/9783832478070
- Dateigröße
- 717 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg – Wirtschafts- und Organisationswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2004 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- controllingkonzepte dualismus dualität managementkonzept steuerung
- Produktsicherheit
- Diplom.de