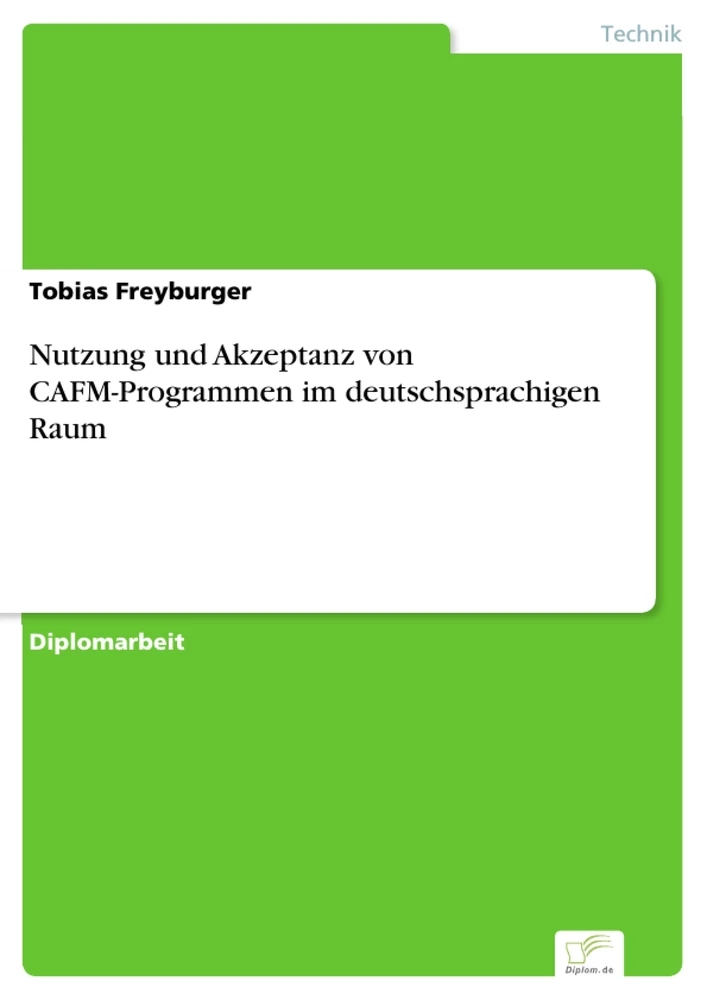Nutzung und Akzeptanz von CAFM-Programmen im deutschsprachigen Raum
©2003
Diplomarbeit
118 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die Ausgangsfrage der Arbeit war die Nutzung und Akzeptanz von CAFM-Systemen im deutschsprachigen Raum.
Es wurde aufgezeigt, dass das Grundverständnis von Facility Management maßgeblich den Einsatz und die Nutzung des CAFM-System beeinflusst, da ein CAFM-System ein Hilfsmittel für das erfolgreiche Facility Management darstellt. Das vorherrschende Grundverständnis von Facility Management im deutschsprachigen Raum orientiert sich an der folgenden Definition der GEFMA:
Facility Management ist die Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude, ein bauliches Objekt oder eine im Unternehmen erbrachte Leistung, die nicht zum Kerngeschäft gehört
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass bei einem CAFM-System vor allem die Schnittstellen zu anderen Informationssystemen zum Einsatz kommen, die das Gebäude und seine Bewirtschaftung betreffen. Mit solchen Schnittstellen zu Informationssystemen sind vor allem ein CAD-Programm, die Gebäudeautomations- und die ERP-Schnittstelle gemeint.
Wenn man nach den Zielen von Facility Management fragt, stehen vor allem drei Ziele im Vordergrund. Einerseits das Erreichen einer kostentransparenter Struktur, andererseits die Aufrechterhaltung der Gebäudefunktionalität und zum dritten die optimale Flächenausnutzung. Diese Ziele finden ihren Widerhall in den eingesetzten CAFM-Anwendungen. So werden vor allem die Flächenmanagement-, Belegungsplan-, Instandsetzungs- und Umzugsmanagementanwendungen als sehr wichtig bewertet und daher auch vorwiegend eingesetzt.
Bei neueren CAFM-Einführungen spielt auch die Helpdeskanwendung im CAFM-System eine immer wichtigere Rolle. Das resultiert daraus, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter auch einen höheren Stellenwert in der Arbeit der Facility Manager erhält und dass das CAFM-System mehr als ein integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette eines Unternehmens begriffen wird.
Zusammenfassend kann aber festgehalten werden, dass sich die Bewertung der einzelnen Anwendungen stark an ihrer Wirtschaftlichkeit, wie sie von Prof. Michael May im ROI-Koordinatensystem dargestellt wurde, orientieren.
Über diese speziellen Anwendungen hinaus schätzen die Nutzer des CAFM-Systems den schnellen Zugriff auf Daten und eine Verbesserung der internen Unternehmens-Kommunikation durch eine einheitliche Datenbasis. Bei diesen allgemeinen Zielen steht nicht unbedingt ein hohes Einsparpotential in Vordergrund, sondern vielmehr ein qualitativer […]
Die Ausgangsfrage der Arbeit war die Nutzung und Akzeptanz von CAFM-Systemen im deutschsprachigen Raum.
Es wurde aufgezeigt, dass das Grundverständnis von Facility Management maßgeblich den Einsatz und die Nutzung des CAFM-System beeinflusst, da ein CAFM-System ein Hilfsmittel für das erfolgreiche Facility Management darstellt. Das vorherrschende Grundverständnis von Facility Management im deutschsprachigen Raum orientiert sich an der folgenden Definition der GEFMA:
Facility Management ist die Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude, ein bauliches Objekt oder eine im Unternehmen erbrachte Leistung, die nicht zum Kerngeschäft gehört
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass bei einem CAFM-System vor allem die Schnittstellen zu anderen Informationssystemen zum Einsatz kommen, die das Gebäude und seine Bewirtschaftung betreffen. Mit solchen Schnittstellen zu Informationssystemen sind vor allem ein CAD-Programm, die Gebäudeautomations- und die ERP-Schnittstelle gemeint.
Wenn man nach den Zielen von Facility Management fragt, stehen vor allem drei Ziele im Vordergrund. Einerseits das Erreichen einer kostentransparenter Struktur, andererseits die Aufrechterhaltung der Gebäudefunktionalität und zum dritten die optimale Flächenausnutzung. Diese Ziele finden ihren Widerhall in den eingesetzten CAFM-Anwendungen. So werden vor allem die Flächenmanagement-, Belegungsplan-, Instandsetzungs- und Umzugsmanagementanwendungen als sehr wichtig bewertet und daher auch vorwiegend eingesetzt.
Bei neueren CAFM-Einführungen spielt auch die Helpdeskanwendung im CAFM-System eine immer wichtigere Rolle. Das resultiert daraus, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter auch einen höheren Stellenwert in der Arbeit der Facility Manager erhält und dass das CAFM-System mehr als ein integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette eines Unternehmens begriffen wird.
Zusammenfassend kann aber festgehalten werden, dass sich die Bewertung der einzelnen Anwendungen stark an ihrer Wirtschaftlichkeit, wie sie von Prof. Michael May im ROI-Koordinatensystem dargestellt wurde, orientieren.
Über diese speziellen Anwendungen hinaus schätzen die Nutzer des CAFM-Systems den schnellen Zugriff auf Daten und eine Verbesserung der internen Unternehmens-Kommunikation durch eine einheitliche Datenbasis. Bei diesen allgemeinen Zielen steht nicht unbedingt ein hohes Einsparpotential in Vordergrund, sondern vielmehr ein qualitativer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7627
Freyburger, Tobias: Nutzung und Akzeptanz von CAFM-Programmen im
deutschsprachigen Raum
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Fachhochschule München, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
-1-
Inhalthaltsverzeichnis
1. Einleitung ... 3
1.1 Vorüberlegung... 3
1.2
Ziel der Diplomarbeit ... 4
1.2.1
Für die Nutzer... 5
1.2.2
Für die Hersteller... 5
1.2.3
Für die Berater... 5
2. Grundlagen ... 6
2.1 Orientierung ... 6
2.2
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Facility Management? ... 6
2.2.1
Definition von Facility Management ... 6
2.2.2
Facility Management als Management Konzept... 8
2.3
Facility Management und Architektur ... 10
2.4 Operatives
Facility
Management ... 11
2.5
Was ist CAFM (Computer Aided Facility Management)? ... 12
2.5.1
Zusammenhang zwischen CAFM und Facility Management ... 12
2.5.2
Definition von CAFM ... 13
2.5.3
Aufbau eines CAFM-Systems... 14
2.5.4
Die Chancen von CAFM-Systemen... 15
2.5.5
Die möglichen Problemfelder eines CAFM-Systems ... 16
3. Vorgehensweise ... 18
3.1
Vorbemerkung zur Durchführung der Trendanalyse ... 18
3.2 Allgemeines
zum
Fragebogen... 18
3.3 Zielgruppe ... 19
3.4 Vorgehensweise ... 21
3.5 Aufbau... 21
4. Ergebnis und Deutung... 25
4.1
Allgemeine Bekanntheit der Begriffe ,,Facility Management" und ,,CAFM" ... 25
4.1.1 Allgemeine
Bekanntheit
von Facility Management... 25
4.1.2
Allgemeine Bekanntheit von CAFM-Systemen... 26
4.2
Zusammenhang von Facility Management und Schnittstellen zum CAFM-System28
4.2.1
Grundverständnis von Facility Management ... 28
4.2.2 Einsatz
von
CAFM-Schnittstellen... 32
4.3
Zugangsweisen zum CAFM-System und Struktur des Facility Managements... 34
4.3.1
Die Struktur der Facility Management Abteilungen ... 37
4.4
Ziele des Facility Management und die verwendeten CAFM-Anwendungen... 40
4.4.1
Ziele des Facility Management ... 40
4.4.2
Aufgabenbereiche für die CAFM-Anwendungen ... 44
4.4.3
Bewertung von CAFM-Anwendungen durch die geplanten Anwender ... 50
4.4.4
Allgemeine Ziele des CAFM-System ... 51
4.5
Potentielle Problemfelder des CAFM-Systems... 53
4.6
Einführung des CAFM-Systems ... 60
4.6.1
Von der Information zur Entscheidung... 60
4.6.2 Die
Systementscheidung ... 65
4.6.3 Einführung... 71
4.7
Rolle der externen Berater... 81
5. Fazit... 85
Inhaltsverzeichnis
-2-
6. Anhang ... 88
6.1 Literaturverzeichnis... 89
6.1.1 Literatur... 89
6.1.2 Internet ... 89
6.1.3 Normen... 89
6.2 Abbildungsverzeichnis ... 90
6.3 Diagrammverzeichnis... 91
6.4 Fragebogen ... 92
6.4.1 Allgemeiner
Fragebogen ... 92
6.4.2 Zusatzfrage ... 109
6.5
Sonstige Diagramme von Interesse ... 110
6.5.1 Häufigkeitsverteilung ... 110
6.5.2 Beratereinsatz ... 114
6.5.3 Pilotprojekt ... 115
Einleitung
-3-
1. Einleitung
1.1 Vorüberlegung
,,1815 begründete Nathan Mayer Rothschild den Ruhm und Reichtum seiner Familie, als er
per Pferdestafette als Erster die Nachricht von der Niederlage Napoleons erhielt. Während
sich die englischen Börsenmakler an Gerüchten orientierten, die ein Fiasko ihres Herzogs
von Wellington und seiner preußischen Verbündeten prophezeiten und panisch verkauften,
kaufte Rothschild an der Londoner Börse alles, was sie zu Schleuderpreisen auf den Markt
warfen. So erlebte Rothschild - im Unterschied zu Napoleon - kein Waterloo, sondern
demonstrierte nachdrücklich, was schnelle Information und entschlossene Bewertung zu
leisten vermögen... ."
1
Obwohl mittlerweile fast 200 Jahre vergangen sind, seitdem Nathan Rothschild dieser
gigantische Börsencoup gelungen ist, hat sich eines in unserer Zeit nicht verändert: Die
Notwendigkeit Informationen zu erhalten und diese auszuwerten. Man könnte sogar sagen,
dass durch die modernen Kommunikationsmittel der Schwerpunkt nicht mehr nur auf der
bloßen Informationsgewinnung liegt, sondern vor allem auch auf deren Auswertung und
Präsentation, also der Umwandlung der Daten und Fakten in ein miteinander verknüpftes
Wissen.
Genau diese Fähigkeiten der schnellen Informationsgewinnung, der präzisen Auswertung und
späteren Präsentation muss ein Facility Manager besitzen, da zu seinen Aufgaben in einem
Unternehmen die Informationsbeschaffung und die Bereitstellung der gewonnen Daten von
allen Facilities
2
eines Unternehmens zählen. Durch dieses verknüpftes Wissen wird er erst in
die Lage versetzt seine Facility Management-Leistungen, wie das Aufrechterhalten der
Gebäudefunktionalitäten, zu erbringen. Als effizientes Hilfsmittel hierfür kann ein CAFM-
System
3
dienen.
1
zitate.de, Homepage: www.zitate.de - Stichwort Informationen, 2003
2
facilities [engl.] = Betriebsmittel eines Unternehmens
3
CAFM = Computer Aided Facility Managment
Einleitung
-4-
1.2 Ziel der Diplomarbeit
Bisher gibt es kaum Studien darüber, was sich CAFM-Nutzer eigentlich von einem solchen
System erwarten. Dazu kommt, dass sich die Anwender uneinig sind, ob sich der Aufwand für
die Einführung eines CAFM-Systems lohnt. So befragte ,,Der Facility Manager" in seiner
Ausgabe 105 vom Juni 2003 auskunftswillige Besucher seiner Homepage, ob sich der
Aufwand für die Einführung eines CAFM-System in einem positiven Verhältnis zu dessen
Nutzen befände
4
.
Das Verhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern hielt sich die Waage. Generell scheint
die Frage interessant, was die Einführung eines im Durchschnitt knapp 100 000 teuren
5
CAFM-Systems denn nun rechtfertigt. Diese Arbeit will daher den Ist-Zustand des CAFM-
Einsatzes im deutschsprachigen Raum untersuchen und dabei auf die Nutzung und Akzeptanz
von Informationstechnologie eingehen. Zu diesem Zwecke wurden in einem aufwändigen
Untersuchungsdesign mehr als 250 Unternehmen kontaktiert, um Interviewpartner zu
gewinnen, von denen schließlich 43 als vollständig befragte in die Untersuchung eingingen.
Leitend für die Befragung waren folgende Fragestellungen:
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Grundverständnis von Facility
Management und dem Einsatz eines CAFM-Systemen?
Wie wird ein CAFM-System in einem Unternehmen eingesetzt und welchen Nutzen
ziehen die Anwender daraus?
Wie gehen die Nutzer mit den Chancen und Problemfeldern eines CAFM-Systems
um?
Wie groß ist die Akzeptanz für ein solches System innerhalb eines Unternehmens?
Welche Rolle spielen unabhängige Berater bei der Einführung eines CAFM-System?
Die sich daraus ergebenden Antworten könnten für Nutzer, Hersteller und Berater interessant
sein, wie im Folgenden aufgezeigt werden wird.
4
vgl. www.facility-manager.de (2002), die DFM-Frage des Monats. In: Der Facility Manager Heft 6 Jahrgang
10, Augsburg, Juni 2003 S.8
5
Ein Ergebnis dieser Trendanalyse
Einleitung
-5-
1.2.1 Für die Nutzer
Die Nutzer können aus der Trendanalyse den aktuellen Status-quo ihrer Systemnutzung
ersehen. Dieser Blick über den Tellerrand hinaus ermöglicht ihnen, eine Vorstellung von den
noch nicht realisierten Möglichkeiten zu entwickeln, da sie ihre Erfahrungen mit dem Ist-
Zustand der befragten Unternehmen zur CAFM-Anwendung vergleichen können. Besonders
aber auch für potenzielle Anwender, die mit dem Gedanken spielen, ein CAFM-System
einzuführen, könnte die folgende Auswertung von großem Interesse sein, da sie aufzeigt, was
sie aus Sicht anderer Nutzer und deren Erfahrungen mit dem CAFM-System bei der eigenen
Einführung und Nutzung beachten sollten.
1.2.2 Für die Hersteller
Für den Hersteller gewinnt die Analyse an Aussagekraft dadurch, dass sie
herstellerunabhängig durchgeführt wurde und somit die Befragten unbefangener antworten
konnten. Anhand der Auswertungen können Hersteller Rückschlüsse darauf ziehen, welche
Spezifikationen ihres Systems überhaupt benutzt werden. Daraus wird deutlich, auf welche
Systemkomponenten und Anforderungen der potenzielle Anwender sein Hauptaugenmerk
legt und welche er vernachlässigt. Somit erhalten die Hersteller konkrete Hinweise darauf,
welche Anforderungen ihr Produkt erfüllen muss, um am Markt bestehen zu können.
1.2.3 Für die Berater
Die Berater erfahren, welche Anforderungen von ihren Kunden an sie und an das
einzuführende CAFM-System gestellt werden. Darüber hinaus wird bestätigt, dass eine
Einbindung von Beratern bei der Implementierung eines CAFM-Systems nötig ist und zwar
nicht nur bei der Einführung selbst, sondern vor allem auch im Vorfeld dieser.
Grundlagen
-6-
2. Grundlagen
2.1 Orientierung
Aufgrund eines inflationären Gebrauchs des Begriffes ,,Facility Managements", droht dieser
zu einem bloßen Modewort zu verkommen. Verstärkt wird die Tatsache dadurch, dass die
Anzahl der Definitionen und Auslegungen nicht nur immens, sondern auch mehrdeutig sind.
Dieser Tatbestand zeigt sich bereits in der unterschiedlichen Schreibweise des Begriffes. In
den USA nennt man es ,,Facility Management" in Großbritannien ,,Facilities Management",
und Deutschland werden je nach Autor beide Schreibweisen verwendet.
6
Anders stellt sich der Sachverhalt bei dem Begriff ,,Computer Aided Facility Management"
dar, kurz CAFM genannt. Zu diesem Begriff lässt sich nur wenig konkretes finden, sodass am
Ende unklar bleibt, was CAFM im Eigentlichen darstellen soll.
Daher soll im Folgenden eine Begriffsbildung für Facility Management und CAFM versucht
werden.
2.2 Was verbirgt sich hinter dem Begriff Facility Management?
2.2.1 Definition von Facility Management
Fragt man nach den Anfängen des Facility Managements, stößt man zwangsläufig auf ein
Symposium zum Thema ,,Facilities Impact on Productivity", welches in den 70 Jahren durch
die Hermann Miller Corporation, einem der größten Möbelhersteller weltweit, veranstaltet
wurde. Auf diesem Symposium wurde ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass räumliche
Ausstattungen und Einrichtungen einen Einfluss auf das Erreichen von Unternehmenszielen
haben
7
. Aus diesem Treffen formierte sich das "Facility Management Institute". Dieses
entwickelte folgende Definition für den Begriff Facility Management:
6
vgl. Prof. Dr. Schulte, K.; Pierschke B.: Begriff und Inhalte des Facilities Managements, in: Prof. Dr. Schulte,
K.; Pierschke (Hrsg.), Facilities Management, Köln, 2000, S.34
7
vgl. Schlitt, M.: Herkunft und Anfänge, in: Harden, H. ;Kahlen, H.(Hrsg.), Planen, Bauen, Nutzen und
Instandhalten von Bauten, Stuttgart, Berlin, Köln 1993, S.13
Grundlagen
-7-
"... as the profession of managing and coordination interrelated `people, process, and place'
issues and functions within the corporation or organisation"
8
Abbildung 1: "people, process and place issues"
9
Bei diesem aus Amerika stammenden Verständnis bedeutet Facility Management somit die
Integration und Koordination von Menschen, Arbeitsumfeld und Arbeitsprozessen.
Nävy, ein häufig zitierter Buchautor zum Thema Facility Management, erstellt eine weniger
unfassende Definition von Facility Management , indem er schreibt:
,,Facility Management ist ein strategisches Konzept zur Bewirtschaftung, Verwaltung und
Organisation aller Sachressourcen innerhalb eines Unternehmens."
10
Mit Sachressourcen sind in der Sprache von Wirtschaftwissenschaftlern Betriebsmittel
gemeint. Vergleicht man nun diese Definition mit der amerikanischen, wird deutlich, dass die
deutsche Version die Komponente Menschen nicht beachtet.
Die GEFMA, der deutsche Verband für Facility Management, und somit das deutsche
Pendant zum "Facility Management Institute", beschreibt Facility Management
folgendermaßen:
8
vgl.Rondeau, E.P.; Brown, K.B.; Lapides, P.D.; a.a.O., S.3
9
vgl. Prof. Dr. Schulte, K.; Pierschke B.: Begriff und Inhalte des Facilities Managements, in: Prof. Dr. Schulte,
K.; Pierschke (Hrsg.), Facilities Management, Köln, 2000, S.35
10
vgl. Nävy, J.(Hrsg.) (2000) Facility Management, 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin, S.3
F a c ility
M a n a g e
m e n t
P ro c e s s
P la c e
P e o p le
F a c ility
M a n a g e
m e n t
P ro c e s s
P la c e
P e o p le
F a c ility
M a n a g e
m e n t
P ro c e s s
P la c e
P e o p le
Grundlagen
-8-
,,Facility Management ist die Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge
rund um ein Gebäude, ein bauliches Objekt oder eine im Unternehmen erbrachte Leistung,
die nicht zum Kerngeschäft gehört"
11
Die Definition der GEFMA scheint noch enger gefasst, denn sie versteht Facility
Management hauptsächlich als Gebäudebewirtschaftung. Ihr Hauptaugenmerk ist also vor
allem auf die ,,Places" gerichtet.
2.2.2 Facility Management als Management Konzept
Hinter dem Begriff Facility Management steckt laut Nävy, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt, ein Management Konzept bestehend aus drei Säulen:
,,Ganzheitlichkeit, Transparenz und Lebenszyklus"
12
Abbildung 2: Tempel des Facility Management-Konzept
Unter dem Begriff Ganzheitlichkeit versteht man, dass die einzelnen Abteilungen eines
Unternehmens ihre Daten über die Betriebsmittel der Facility Management Abteilung zur
Verfügung stellen. Somit wird ermöglicht, dass alle Daten zentral gespeichert und
ausgewertet werden können. Dadurch erhält man einen ganzheitlichen Überblick über die
verwendeten Ressourcen. Der Begriff ,,Ganzheitlichkeit" dann aber noch weiter gefasst
werden, wenn man die verschiedenen Sichtweisen und Erwartungen der Eigentümer,
11
GEFMA 100, Facility Management Begriffe, Struktur und Inhalte (Entwurf), Nürnberg 1996, S.5
12
vgl. Nävy, J.(Hrsg.) (2000) Facility Management, 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin, S.3-6
Facility M anagem ent
Ganzheitlichkeit
T
ransparenz
Lebenszyklus
Facility M anagem ent
Ganzheitlichkeit
T
ransparenz
Lebenszyklus
Grundlagen
-9-
Betreiber und Nutzer gemeinsam betrachten will. In vielen Unternehmen werden alle drei
Sichtweisen auf ein Gebäude vereint. Sie sind einerseits Eigentümer der Immobilie und
möchten daher eine hohe Rendite für ihr Gebäude erwirtschaften. Auf der anderen Seite sind
sie Betreiber und somit ist ihr Fokus vor allem auf Service (z.B. Reinigung, Instandhaltung)
gerichtet, während sie als Nutzer eine optimale Unterstützung für die Geschäftsprozesse
erwarten. Daher sollte auch der Facility Manager alle drei Sichtweisen bei seinen
Entscheidungen berücksichtigen und abwägen.
Der zweite Aspekt ,,Transparenz" wirkt in den ersten hinein. Ziel dieser Herangehensweise ist
es, alle Informationen bezüglich der Betriebsmittel aktuell zu halten und jederzeit zur
Verfügung zu stellen. Dadurch sollen alle Entscheidungen, welche die Facilities betreffen, auf
zeitnahen und korrekten Daten beruhen. Informationsdefizite sollen vermieden werden, da sie
zu Fehlentscheidungen führen können. Ziel dabei ist die Entstehung eines ,,gläsernen"
Unternehmen.
Diese Transparenz ist vor allem dann wichtig, wenn man den dritten Aspekt des Facility
Management-Konzeptes unter die Lupe nimmt, das heißt den Lebenszyklus eines Gebäudes.
Bei der Betrachtung des Lebenszyklus hat vor allem die flexible Anpassung des Gebäudes an
die Wünsche des Gebäudenutzers einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert. Durch diese
ständige Anpassung des Gebäudes wechselt die Verantwortung für die Immobilie ständig
zwischen dem Architekten und dem Facility Manager. Damit bei diesem Wechsel der
Verantwortung kein Informationsdefizit entsteht, müssen sämtliche Daten transparent und
aktuell sein.
Dieses Facility Management Konzept wird an anderer Stelle auch als strategisches Facility
Management bezeichnet. Es entfaltet sein größtes Potential dann, wenn es auf der einen Seite
sehr frühzeitig in einen Entscheidungsprozess eingebunden, und auf der anderen Seite
langfristig angewandt wird.
13
Darüber hinaus soll das Facility Management den gesamten Lebenszyklus aller Betriebsmittel
betrachten, angefangen von der Planung über die Erstellung und Nutzung, einschließlich der
Umbauten, bis hin zur Entsorgung. Man schätzt, dass die Planungs- und Erstellungskosten 15
Prozent und die Folgekosten 85 Prozent der über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes
entstehenden Kosten betragen. Bei Optimierung und Verbesserung der Abläufe im Bereich
13
vgl. Heller, Hans (2001) Der strategische Ansatz im Facility Management. In: Forum Verlag Herkert GmbH
(Hrsg.): Facility Management Messe und Kongress Düsseldorf 20.-22 März 2001, Merching S. 69
Grundlagen
-10-
des Lebenszyklus, würde alleine im Bereich der Folgekosten ein geschätztes Einsparpotential
von ca. 30 Milliarden pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland entstehen.
14
2.3 Facility Management und Architektur
Aufgrund dieses enormen Einsparpotentials ergibt sich ein in der Theorie großer
Zusammenhang zwischen Architektur und Facility Management. Der am Facility
Management orientierte Ansatz versucht, die Verringerung der Lebenszykluskosten eines
Gebäudes in den Vordergrund zu stellen und nicht das Hauptaugenmerk wie bisher vor allem
auf eine Minimierung der Erstellungskosten zu legen. Dies hat zur Folge, dass der Facility
Manager schon während der HOAI Phase 1, das heißt in der Vorplanung die zukünftigen
Betreiberinteressen intern abfragen und ein Betreiberkonzept erstellen muss. Dieses Konzept
berücksichtigt spätere Arbeitsweisen und die damit verbundene Arbeitsplatzgestaltung. Aus
diesem geschilderteren Ansatz heraus entwickelt sich eine Facility Management orientierte
Baudokumentation. Diese Baudokumentation kann wiederum Grundlage für ein CAFM-
System sein. Fachleute schätzen, dass nur 10 Prozent der Baudaten relevant für Facility
Manager sind.
Abbildung 3: Verantwortung für ein Gebäude
15
14
Heller, Hans (2001) Der strategische Ansatz im Facility Management. In: Forum Verlag Herkert GmbH
(Hrsg.): Facility Management Messe und Kongress Düsseldorf 20.-22 März 2001, Merching S. 74
15
vgl. Nävy, J.(Hrsg.) (2000) Facility Management, 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin, S.11 Abb. 1.7
H auptverantw ortlicher
L ebenszyklus eines G ebäudes
A rchitekt
Facility M anager
U nterstützend
B egleitend
K onzeption
Planung
B au
N utzung
E ntsorgun g
H auptverantw ortlicher
L ebenszyklus eines G ebäudes
A rchitekt
Facility M anager
U nterstützend
B egleitend
K onzeption
Planung
B au
N utzung
E ntsorgun g
H auptverantw ortlicher
L ebenszyklus eines G ebäudes
A rchitekt
Facility M anager
U nterstützend
B egleitend
H auptverantw ortlicher
L ebenszyklus eines G ebäudes
A rchitekt
Facility M anager
U nterstützend
B egleitend
K onzeption
Planung
B au
N utzung
E ntsorgun g
K onzeption
Planung
B au
N utzung
E ntsorgun g
Grundlagen
-11-
Leider muss man sagen, dass dieses Zusammenarbeiten zwischen dem Architekten und
Facility Manager in der Praxis nur selten, wie oben beschrieben, umgesetzt wird. Eine solche
Zusammenarbeit wäre aber nicht nur aus Sicht eines CAFM-Einsatzes erstrebenswert.
2.4 Operatives Facility Management
Das operative Facility Management orientiert sich eher kurz- und mittelfristig. Es wird nicht
der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes betrachtet, sondern nur die aktuelle
,,Lebensphase". In der Praxis wird beim operativen Facility Management häufig zwischen den
drei Bereichen technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Facility Management
unterschieden.
Das technische Facility Management beschäftigt sich mit der technischen Betriebsführung,
der Unterhaltung und Wartung, der Instandhaltung, dem Energiemanagement, der Versorgung
und Entsorgung, den technischen Transportmitteln und allen sonstigen technischen Anlagen.
Zu den Aufgabengebieten des infrastrukturellen Facility Management gehören die
Reinigungsdienste, die Pflege der Außenanlagen, die Bewirtschaftung von Gebäuden, das
Umzugsmanagement, die Hausmeisterdienste und der Büroservice. Darüber hinaus werden
ihm noch alle anderen Dienstleistungen, welche sich mit dem Betreiben des Gebäudes
auseinander setzten, zugeordnet.
Das Flächenmanagement, das Controlling, die Kostenabrechnung und das
Beschaffungsmanagement sind Bestandteil des kaufmännischen Facility Managements.
16
16
Heller, Hans (2001) Der strategische Ansatz im Facility Management. In: Forum Verlag Herkert GmbH
(Hrsg.): Facility Management Messe und Kongress Düsseldorf 20.-22 März 2001, Merching S. 72
Grundlagen
-12-
Abbildung 4: Marktvolumen Facility Management Deutschlnd 1998
17
2.5 Was ist CAFM (Computer Aided Facility Management)?
2.5.1 Zusammenhang zwischen CAFM und Facility Management
Um das oben beschriebene Facility Management-Konzept und die damit verbundenen Ziele
wirkungsvoll umzusetzen zu können, benötigt man ein ausgeklügeltes
Informationsmanagement, das die benötigten Daten bereitstellt, speichert und selektiert.
Darüber hinaus sollten Prozesse automatisiert und die Kommunikation zwischen den
einzelnen Abteilungen verbessert werden.
Diese Informationssystem nennt man auch Computer Aided Facility Management oder wie im
Weiteren auch als Abkürzung verwendet CAFM.
18
Den Zusammenhang zwischen CAFM-
System und Facility Management soll die folgende Abbildung 4 nochmals verdeutlichen. Die
in einem Unternehmen ablaufenden Prozesse, welche das Kerngeschäft des Unternehmens
unterstützen, produzieren ein immenses Datenvolumen. Die für das Facility Management
relevanten Daten werden im CAFM-System aufgearbeitet und bereitgestellt. Durch dieses
Informationsmanagement unterstützt das CAFM-System den Facility Manager.
17
vgl. Friedrichs, Kay: Bauen im Informationszeitalter, in: Henzelmann, Thorsten (Hrsg.), Facility Management
Die Service-Revolution in der Gebäudebewirtschaftung, Expert Verlag Renningen, 2001, S.80
18
vgl. Prof. Dr. Schulte, K.; Pierschke B.: Begriff und Inhalte des Facilities Managements, in: Prof. Dr. Schulte,
K.; Pierschke (Hrsg.), Facilities Management, Köln, 2000, S.369
5 0 %
1 0 %
5 %
1 5 %
2 0 %
In frastru k trelles
F acility
M an ag em en t
T ech n isch es
F acility
M an ag em en t
K au fm än n isc h es
F acility
M an ag em en t
B e tre ib e n
E n e rg ie
M o d e rn isie re n /
S a n ie re n
M ark tv o lu m en 4 0 -5 0
M rd .
5 0 %
1 0 %
5 %
1 5 %
2 0 %
In frastru k trelles
F acility
M an ag em en t
T ech n isch es
F acility
M an ag em en t
K au fm än n isc h es
F acility
M an ag em en t
B e tre ib e n
E n e rg ie
M o d e rn isie re n /
S a n ie re n
M ark tv o lu m en 4 0 -5 0
M rd .
5 0 %
1 0 %
5 %
1 5 %
2 0 %
In frastru k trelles
F acility
M an ag em en t
T ech n isch es
F acility
M an ag em en t
K au fm än n isc h es
F acility
M an ag em en t
B e tre ib e n
E n e rg ie
M o d e rn isie re n /
S a n ie re n
M ark tv o lu m en 4 0 -5 0
M rd .
Grundlagen
-13-
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Facility Management und CAFM
19
2.5.2 Definition von CAFM
Obwohl mittlerweile CAFM im Bereich des Facility Management unter den deutschen
Großunternehmen eine weite Verbreitung gefunden hat, muss man leider sagen, dass erste
Ermüdungserscheinungen bei potentiellen Anwendern auftreten, da diese den Versprechen
der Systemanbieter nicht mehr unbedingt Glauben schenken wollen. So scheint es auch nicht
verwunderlich, dass man nur wenig allgemeingültige Literatur zu diesem Thema findet, wenn
man von den Prospekten der Systemhersteller einmal absieht. Daher ist es wichtig, zu klären,
was denn nun genau ein CAFM-System ist und was nicht. Diese Fragestellung scheint umso
schwieriger wenn man bedenkt, dass es keine einheitliche, hinreichende Definition für ein
solches System gibt. Allerdings lassen sich Beschreibungen und Begriffsbestimmungen
ausfindig machen. So beschreibt die GEFMA ein CAFM-System als eine IT-Lösung, deren
,,Schwerpunkt im Informationsmanagement bei klarer Abgrenzung zur Gebäudeautomation
und anderen gängigen EDV-Anwendungen, wie Planungssoftware, Office-Lösungen oder
kaufmännischer Standartsoftware [liegt]. Bei aller Abgrenzung gilt es als ein
Grunderfordernis des CAFM, dass im Rahmen des Aufbaus entsprechender Kunden-Systeme
Schnittstellen zu den im Unternehmen gängigen Parallelsystemen im notwendigen Umfang
entwickelt und unterhalten werden müssen.[...] Die Bearbeitung grafischer und
19
vgl. Nävy, J.(Hrsg.) (2000) Facility Management, 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin, S.73 Abb. 2.3
In f o r m a t io n e n
S t r a t e g ie
F a c ility M a n a g e m e n t
C A F M
D a t e n
P r o z e s s e im U n te r n e h m e n
In f o r m a t io n e n
S t r a t e g ie
F a c ility M a n a g e m e n t
C A F M
D a t e n
D a t e n
P r o z e s s e im U n te r n e h m e n
Grundlagen
-14-
alphanumerischer Daten auf Basis einer oder mehrerer Datenbanken wird als
unverzichtbares Merkmal einer CAFM-Software verstanden."
20
2.5.3 Aufbau eines CAFM-Systems
Die meisten aus Deutschland stammenden CAFM-Systeme haben sich aus dem CAD-System
der Bauplanung entwickelt. Folglich ergibt sich daraus, dass die CAD-Daten die Basis für das
Gesamtsystem bilden. Im CAFM-System werden CAD-Daten mit den alphanumerischen
Daten, auch Sachdaten genannt, verknüpft. Andere Systeme vor allem aus dem
angelsächsischen Raum stammende, benutzen als CAFM-Kern ein
Datenbankmanagementsystem, wobei sie eine CAD-Schnittstelle als
Visualisierungsmöglichkeit verwenden. Mittlerweile gibt es aber auch Systeme, bei denen die
beiden Datenarten gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Alle drei Systemarchitekturen haben bei aller Unterschiedlichkeit eines gemeinsam: Sie
bestehen aus zwei Hauptkomponenten, nämlich einer Datenbank für die Sachdaten und einem
CAD-System für die Grafikdaten. In diesen beiden Komponenten werden die jeweiligen
Daten generiert und miteinander logisch verknüpft und somit schließlich zu Informationen
umgewandelt. Diese Verzahnung von Datenbank und CAD-System sorgt darüber hinaus für
eine redundanzfreie Bearbeitung der Daten.
21
Im Allgemeinen sind diese CAFM-Systeme modular aufgebaut. Dies bedeutet, dass das
System je nach Anwendungsschwerpunkt zusammengesetzt werden kann. So bieten die
Hersteller z.B. ein Flächenmanagement- oder ein Reinigungsmodul als CAFM-Anwendung
an. Diese Baukastenlösungen bieten in einem gewissen Umfang Anpassungsmöglichkeiten
für den späteren Anwender. Den Vorgang der Anpassung nennt man Costumizing. Neben
diesen vorgefertigten Baukastenlösungen kann sich der Anwender aber auch Module für
besondere Anwendungen ,,maßschneidern" lassen. Diese Maßanfertigungen können dann
ebenfalls in das CAFM-System integriert werden. Ein solches Verfahren ist allerdings sehr
zeit- und kostenintensiv.
22
20
GEFMA 400, Computer Aided Facility Management CAFM Begriffbestimmung, Leistungsmerkmale,
Berlin, April 2002, S.1
21
vgl. Nävy, J.(Hrsg.) (2000) Facility Management, 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin, S.69
22
vgl. Prof. Dr. Ing. Peter Richter:
Informationsmanagement als Basis des Facility Management, in: Prof. Dr.
Schulte, K.; Pierschke (Hrsg.), Facilities Management, Köln, 2000, S. 363
Grundlagen
-15-
Darüber hinaus kann man für das CAFM-System Schnittstellen programmieren. Diese dienen
dazu, kaufmännische Software, auch ERP
23
genannt oder auch Gebäudeautomationssysteme
an das CAFM-System anzubinden. Die nachstehende Abbildung zeigt noch einmal
schematisch die Architektur eines CAFM-Systems.
Abbildung 6: Architektur eines CAFM-Systems
24
2.5.4 Die Chancen von CAFM-Systemen
Bevor man sich über die Einführung eines CAFM-Systems Gedanken macht, sollte man den
möglichen Nutzen und die potentiellen Problemfelder analysieren und diese gegeneinander
abwägen. Wie bereits oben erwähnt, stellt ein CAFM-System ein gutes Hilfsmittel für einen
Facility Manager dar. Aber wo genau liegen nun die Stärken dieses Systems? CAFM begleitet
und unterstützt die in einem Betrieb ablaufende Prozesse durch den Einsatz von
Workflowtechnologie. Unter Workflow versteht man Prozesse, die klar in ihrem Ablauf
definiert sind. Durch den Einsatz eines Workflowsystems werden die Durchlaufzeiten der
23
ERP ist die Abkürzung für Enterprise Ressource Planing
24
vgl. Prof. Dr. Ing. Peter Richter:
Informationsmanagement als Basis des Facility Management, in: Prof. Dr.
Schulte, K.; Pierschke (Hrsg.), Facilities Management, Köln, 2000, S. 393 Abb.: 14
Eingabe
Eingabe
Aus-
gabe
Aus-
gabe
CAD
CAD
Benutzeroberfläche
Flächenmanagement
Reinigung
Helpdesk
Datenintegration
FM-Anwendung n
FM-Anwendung xy
Schnittstelle
ERP
Schnittstelle
ERP
Anwendungsintegration
Personal-
wesen
Datenbank
m
CAD-DATEN
Logische Verknüpfung
Alphanumerische
Daten
Datenbank-
Management-System
Grundlagen
-16-
einzelnen Vorgänge reduziert und das bei einem geringeren Arbeitsaufwand der Mitarbeiter.
25
Durch die Einführung des CAFM-Systems kann eine zentrale Datenlandschaft im Bereich
Facility Management entstehen. Dies bewirkt, dass nun alle für den Bereich Facility
Management relevanten Daten zentral gespeichert werden können. Dies hat zwei große
Vorteile: Zum einen Transparenz, die durch die logische Verknüpfung der Daten entsteht. Mit
deren Hilfe kann man zum Beispiel sehr einfach den Bestand von jedem Betriebsmittel
ermitteln und diesen mit seinen Lagerungskosten verknüpfen oder die Ausfallhäufigkeit
bestimmter Maschinen und die damit verbunden Kosten zusammenstellen. Zum anderen kann
jeder, der die Berechtigung besitzt, auf die gesamten Daten in Sekundenbruchteilen zugreifen.
CAFM-Systeme gewähren ein durchgängiges Informationsmanagement über den gesamten
Lebenszyklus der Betriebsmittel. Darüber hinaus müssen die Daten nur einmal im System
erfasst werden, können jedoch von vielen gemeinsam genutzt werden. Dies führt dazu, dass
die interne Kommunikation der Beteiligten verbessert wird, da sie nun zeitgleich auf einen
gemeinsamen Datenpool zugreifen können. Aber auch die Verständigung zwischen den
Ingenieurwesen, dessen Sprache bekanntlich die Zeichnung ist, und der Betriebswirtschaft
wird durch die gleichzeitige Bearbeitungsmöglichkeit von Sachdaten und Grafikdaten
erheblich verbessert. Darüber hinaus ist die Datenhaltung redundanzfrei.
26
2.5.5 Die möglichen Problemfelder eines CAFM-Systems
Bei all den Vorzügen, die ein Computer Aided Facility Management-System wie aufgezeigt
bietet, dürfen aber nicht die Probleme übersehen werden, die es zu lösen gilt. Die Praxis zeigt,
dass häufig die Erwartungen an die Einführung des Systems zu überhöht sind. Viele CAFM-
Nutzer wollen zu viel in zu kurzer Zeit erreichen. Darunter leidet vor allem die Vorbereitung
der Einführung. Da eine CAFM-Lösung ein prozessorientiertes IT-System ist, müssen alle
Prozesse und sämtliche Organisationsformen vor der Einführung organisiert und als
Workflow bestimmt werden. Ist dies nicht der Fall, wird das CAFM-System erheblich in
seiner Effektivität und seinen Möglichkeiten eingeschränkt. Leider fallen diese
Einführungsvoraussetzungen nicht selten dem Termindruck zum Opfer oder werden schlicht
vernachlässigt.
Ein weiteres Problem könnte sein, dass die Daten nicht stimmig sind oder keine aktuellen
Bezüge haben. Häufig besteht die Gefahr, dass sich die florierenden Datenbestände eines
25
vgl. GEFMA 400, Computer Aided Facility Management CAFM Begriffbestimmung, Leistungsmerkmale,
Berlin April 2002, S.7
26
vgl. Nävy, J.(Hrsg.) (2000) Facility Management, 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin, S.68
Grundlagen
-17-
CAFM-Systems in einen riesigen Datenfriedhof verwandeln, weil zu viele Module vorhanden
sind und Daten nicht auf dem neuesten Stand gehalten werden. Bei dem immensen
Datenvolumen, das ein CAFM-System speichern kann, liegt die Versuchung nahe, alles
dokumentieren und speichern zu wollen, auch Daten, die letztendlich keine Relevanz für das
Facility Management besitzen.
Vorgehensweise
-18-
3. Vorgehensweise
3.1 Vorbemerkung zur Durchführung der Trendanalyse
Um Informationen zur Trendanalyse zu erhalten, wurde eine Methode aus der
Marktforschung in Form eines Fragebogens angewendet. Auf diese Art und Weise
gewonnene Daten und Aussagen besitzen immer eine gewisse Unschärfe, da der Befragte
selten unbefangen und unvoreingenommen antwortet. Gebhardt-Seele erklärt diesen
Sachverhalt folgendermaßen:
,,Durch den Akt der Befragung selbst verändern Sie bereits etwas im Kopf des Befragten.
Seine Antwort ist ab da nur noch repräsentativ für die Zielgruppe der ,,Befragten", nicht aber
für die gesamte Zielgruppe. Vielleicht ist die Abweichung nur sehr gering, aber sie ist auf
jeden Fall vorhanden."
27
Obwohl die Marktforschung daher nicht als problemlos gelten kann, stellt sie zweifelsohne
ein wichtiges Instrument zur Informationsgewinnung aus einer bestimmten Zielgruppe dar.
Diese Arbeit kann und will auch nicht den Anspruch erheben Marktforschung zu betreiben, da
dies den Rahmen der Diplomarbeit sprengen würde. Es geht jedoch darum einen Trend in der
Nutzung und Akzeptanz von CAFM-Systemen zu erkennen und diesen zu beschreiben. Je
sorgfältiger die Ansprechpartner ausgewählt werden, umso aussagekräftiger kann eine
Trendanalyse sein. Für die Aussagekraft der vorliegenden Trendanalyse spricht, dass ein
Großteil der befragten Unternehmen DAX100-Unternehmen bilden und fast alle
Interviewpartner Führungskräfte in diesen Unternehmen sind.
3.2 Allgemeines zum Fragebogen
Für die Trendanalyse wurde ein Fragebogen
28
mit insgesamt 53 Fragen erstellt. Die Fragen
wurden zur besseren Auswertung in Form von Multiple Choice-Fragen angeboten oder, bei
Bewertungen in Form von Skalierungsfragen von 1 bis 5 designt, damit die Befragten
gegebenenfalls auch eine neutrale Haltung einnehmen konnten. Die Fragen sind allgemein
gehalten, da der Fragebogen brachenübergreifend eingesetzt werden sollte. So wurde
27
Stephan Gebhardt-Seele (Hrsg.) (2002) Immer gute Auftragslage!. In: Gabler GmbH Wiesbaden,
S. 107
28
der komplette Fragebogen befindet sich im Anhang
Vorgehensweise
-19-
beispielsweise darauf verzichtet, nach branchenspezifischen DIN oder ISO-Normen zu fragen.
Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass die Grundanforderungen an ein CAFM-System für
alle Branchen ähnlich sind und sich nur in Nuancen unterscheiden.
Im Laufe der Auswertung wurde eine Zusatzfrage an alle eruierten CAFM-Nutzer versandt,
welche die Problemfelder der CAFM-Lösung noch detaillierter beleuchten soll.
3.3 Zielgruppe
Wie schon bereits erläutert, konnte in dieser Arbeit nur eine beschränkte Anzahl an
Unternehmen befragt werden. Um trotzdem eine hohe Aussagekraft zu erhalten, wurden
qualifizierte Gesprächspartner, also Führungskräfte befragt. Dabei wurde vor allem Wert auf
Firmen mit großer bewirtschafteter Grundfläche (BGF) gelegt. Die Firmen wurden
brachenübergreifend ausgewählt, wie aus dem folgenden Diagramm ersichtlich wird.
Diagramm 1: Branchenübersicht
Die Auswahl der Zielunternehmen beschränkte sich nicht nur auf Anwender, sondern auch
auf Nichtanwender und Firmen, die eine Einführung planen. Das Hauptaugenmerk lag auf
DAX100-Unternehmen, da sich diese Zielgruppe vermutlich am ehesten mit der CAFM-
Thematik auseinander gesetzt hat. Bei der Befragung wurden insgesamt 252 Unternehmen
angefragt, von denen 43 geantwortet haben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 16
Prozent.
Produktion
30%
Kommunen
5%
Andere
17%
Non Profit
12%
Handel
7%
Finanzdienstleister
29%
Vorgehensweise
-20-
Diagramm 2: Anteil der DAX 100 notierten Unternehmen bei der Befragung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass etwa 1/3 aller befragten Unternehmen
Finanzdienstleister waren, 1/3 aus der Produktion stammten und der Rest anderen Branchen
zugeordnet werden kann. Wichtig ist, dass etwas mehr als 1/3 der Unternehmen DAX100-
Unternehmen sind.
Nicht notiert
64%
DAX 100 Unternehmen
36%
Vorgehensweise
-21-
3.4 Vorgehensweise
Der erste Schritt stellte eine telefonische Vorsondierung dar, um den zuständigen
Ansprechpartner für Facility Management-Fragen oder den jeweiligen CAFM-Beauftragten
herauszufinden. Besonderen Wert wurde dabei darauf gelegt, mit der Person zu sprechen,
welche die Entscheidungskompetenz besitzt. Bis zum Erhalt der Rückantwort wurde diese
Person regelmäßig an den Fragebogen erinnert. Vor allem dadurch ist der große Rücklauf von
Führungskräften zu erklären, der bei etwa 89 Prozent liegt.
Diagramm 3: Position der Interviewpartner innerhalb des Unternehmens
Die ersten Interviews wurden telefonisch durchgeführt, um eventuelle Missverständnisse in
der Fragestellung noch korrigieren zu können. Danach wurden die Fragebogen per Fax
versandt und ebenfalls per Fax oder Post beantwortet. Auftretende Nachfragen wurden
ebenfalls telefonisch geklärt.
3.5 Aufbau
Der Fragebogen gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird das Verständnis von Facility
Management untersucht. Der zweite Teil fragt nach dem Einsatz, den Zielen und der
Einführung eines CAFM-Systems. Da sich der Fragebogen an Anwender, Nichtanwender und
geplante Anwender richtet, ist dieser Teil dreigeteilt. Jede Gruppe beantwortet den auf sie
abgestimmten Fragebogenteil. Der dritte Teil beleuchtet schließlich die speziellen
Facility-
Management-
Verantwortliche
89%
Sachbearbeiter
11%
Vorgehensweise
-22-
Anforderungen an die Berater. Diese Fragen werden nur von den Anwendern und geplanten
Anwendern beantwortet.
Abbildung 7: Aufbau des Fragebogens
Im ersten Teil wurde untersucht, mit welchem Grundverständnis die Unternehmen Facility
Management betreiben, um den bereits in der Einleitung aufgezeigten Zusammenhang
zwischen CAFM und Facility Management zu klären. So ist das Grundverständnis von
Facility Management maßgeblich für den Einsatz und die Nutzung eines CAFM-Systems
verantwortlich. Deshalb wurde zuerst das Grundverständnis analysiert, bevor die Nutzung und
Akzeptanz von Computer Aided Facility Management Systemen untersucht wurde. Dabei
stellte sich hauptsächlich die Frage, ob das Verständnis eher auf der ,,amerikanischen"
(Schwerpunkt Dienstleistungen) oder der ,,deutschen" (Schwerpunkt Gebäude) Sichtweise
basiert und welche Ziele daher für das Facility Management resultieren. Die Ziele können von
Kostentransparenz bis zum Wertschöpfungsbeitrag der Immobilie reichen. Des Weiteren wird
untersucht, welche Prozesse im infrastrukturellen, gebäudetechnischen und kaufmännischen
Bereich
29
in den Unternehmen schon in Workflows umgewandelt sind, da diese die
Einführung eines CAFM-Systems begünstigen. Zuletzt wird nach den organisatorischen
Struktur des Unternehmens, sowie nach der Anzahl der Facility Management-Abteilungen in
der jeweiligen Firma gefragt.
Der zweite Teil des Fragebogens beleuchtet zum einen die Verbreitung und die Bekanntheit
von CAFM-Systemen, zum anderen wird der Einsatz dieser Systeme untersucht. Es werden
die mit CAFM verbundenen Ziele und die Aufgaben dieses Systems im Unternehmen
29
vgl. GEFMA 100, Facility Management Begriffe, Struktur und Inhalte (Entwurf), Nürnberg 1996
C A FM
BERATER
Faci
lity
M
anag
eme
nt
C A FM
BERATER
Faci
lity
M
anag
eme
nt
C A FM
BERATER
Faci
lity
M
anag
eme
nt
Vorgehensweise
-23-
abgefragt. Unter möglichen Zielen versteht man die Verbesserung der internen
Kommunikation oder aber Controlling-Aufgaben, die ein solches System unterstützen kann.
Die Aufgaben des Systems werden maßgeblich durch den Einsatz der verwendeten
Anwendungen, wie Flächenmanagement oder Help-Desk-Funktionen bestimmt. Des Weiteren
wird der Frage nachgegangen, ob als Zugangsweise eine Stand-Alone-Applikation, ein Client-
Server-Zugang oder das Intranet bzw. Internet benutzt wird. Auch ist die Frage nach den
Schnittstellen zu anderen IT-Programmen, die ein CAFM-System besitzen muss war, von
Interesse. IT-Programme, die mit dem CAFM-System verknüpft werden, könnten ein CAD-
Programm, ERP-Software oder gar eine Anbindung an die Personaldatenbank sein. Nachdem
die Ziele und Anwendungen behandelt wurden, widmet sich der Fragebogen dem Thema der
Systemeinführung. Dabei wird großen Wert auf die Entscheidungskriterien zur
Systemauswahl gelegt. Die Budgetierung für die Implementierung eines solchen Systems
wird abgefragt und darüber hinaus eruiert, bei wem die Entscheidungskompetenz zur
Einführung liegt. Als letztes wird in diesem Teil des Fragebogens die Akzeptanz eines
solchen Systems bei den damit arbeitenden Personen analysiert. Diese Themen wurden
vorwiegend von den Nutzern und geplanten Nutzern beantwortet. Die Nichtnutzer eines
CAFM-Systems beantworteten in diesem Teil des Fragebogens lediglich die Frage, warum ihr
Unternehmen kein CAFM-System einführt. Die Gründe einer Nichteinführung reichen von
Aussagen wie ,,zu teuer" bis zu ,,CAFM, was ist das?"
Immer wieder wird auf die Bedeutung der Berater hingewiesen, z.B. von Prof. Dr.-Ing.
Bertzky.
30
Daher widmet sich der dritte Teil des Fragebogens detailliert der Beratertätigkeit
bei der Einführung eines CAFM-Systems. Im Wesentlichen werden zwei Themenfelder näher
betrachtet: Zum einen wird nach den möglichen Dienstleistungen der Berater gefragt. Diese
Dienstleistungen reichen von der Projektsteuerung bis hin zur Systemauswahl. Zum anderen
wird der Nutzen des Beratereinsatzes im retrospektiv von den Anwendern bewertet. Die
Unterteilung des Fragebogens an dieser Stelle nach Anwendern, geplanten Anwendern und
Nichtanwendern erscheinen deshalb als sinnvoll, da die Anwender den Ist-Zustand der
Beratertätigkeit beschreiben und die geplanten Anwender ohne eigene Erfahrungen die
Wünsche an die Berater formulieren können. Leider hat sich im Laufe der Interviews gezeigt,
dass die Nicht-Anwender keine Meinung zu den Beratern haben und daher auch keine
Erwartung formulieren können. Sie wurden daher nicht in die Auswertung einbezogen und
30
vgl. Gärber Martin (2000), CAFM - darauf sollten Käufer achten. In: Der kommunale Facility Manager
Sonderheft Oktober 2000 S. 30-31
Vorgehensweise
-24-
der Fragebogen dahingehend modifiziert, dass Nichtanwender diesen Teil des Fragebogens
nicht beantworten sollten.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832476274
- ISBN (Paperback)
- 9783838676272
- DOI
- 10.3239/9783832476274
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften München – Bauingeneurwesen
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- facility management bauingeneurwesen immobilien wirtschaftsinformatik
- Produktsicherheit
- Diplom.de