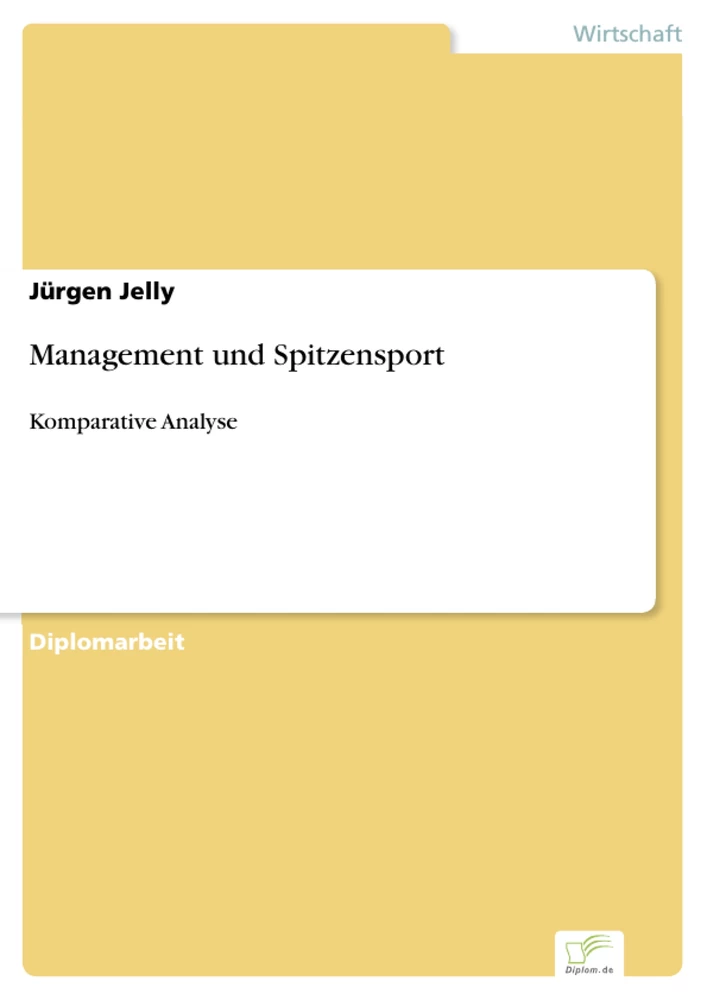Management und Spitzensport
Komparative Analyse
©2003
Diplomarbeit
185 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Wie der Titel bereits angibt, werden in der folgenden Arbeit die Aufgaben von Managern in Unternehmen mit elementaren Lehren und Erkenntnissen aus dem Spitzensport verglichen.
Die gemeinsame Basis, auf der beide Disziplinen aufbauen, ist auch das gemeinsame Ziel: Die Höchstleistung. Sowohl im Management als auch im Spitzensport ist die maximale Ausschöpfung des Leistungspotenzials zur Erreichung von Höchstleistungen eine Notwendigkeit. Diese Argumentation bietet den Grundstock für die These, dass der Zugang zu diesem Leistungspotenzial sowohl von Seiten des Managements als auch von Seiten des Spitzensports sehr oft der gleiche ist.
Die komparative Analyse ermöglicht nicht nur eine ganzheitliche Sicht, sondern zeigt auch Parallelen auf, doch vor allem ermöglicht sie die Schließung von Lücken. Interdisziplinarität als Mittel zur Lückenschließung hat sich bereits in vielen Bereichen bewährt. Einige Consulting-Unternehmen machen sich exakt diesen Ansatz bereits zunutze, indem sie Leute aus den unterschiedlichsten Disziplinen einstellen. Die Wiener Niederlassung der Boston Consulting Group hat zum Beispiel einen Arzt und sogar einen Sinologen im Team. Die auf den ersten Blick als absurd erscheinende Idee, einen Sinologen zur Unternehmensberatung heranzuziehen, ist bei näherer Betrachtung umso logischer.
Es geht um eine andere Betrachtungsweise von Problemen, andere Denkansätze und prozesse, frei von intradisziplinären Schemata, und um kreative Lösungsansätze. Aus denselben Gründen werden japanische Spitzenmanager in militärische Drill-Camps gesteckt und verbringen unsere Ski-Stars in der Sommerpause Tage mit den verschiedensten anderen Sportarten.
Diese Arbeit hat also den Zweck, unter Zuhilfenahme einer zweiten Disziplin dem Spitzensport eventuelle Lücken im Unternehmensmanagement zu schließen und Verbesserungen der behandelten Themen zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNIS3
ABBILDUNGSVERZEICHNIS6
TABELLENVERZEICHNIS8
EINLEITUNG9
1.DER MENSCH ALS KAPITAL10
1.1MENSCHENTYPEN11
1.1.1ALLGEMEIN11
1.1.2TEMPERAMENTSTYPOLOGIE11
1.1.3KONSTITUTIONSTYPOLOGIE12
1.1.4ANTHROPOSOPHISCHES MENSCHENBILD14
1.1.5ANSÄTZE IN DER WIRTSCHAFT18
1.2.1DEFINITION20
1.2.2TALENTSUCHE21
1.2.3TALENTAUSWAHL24
1.2.4TALENTFÖRDERUNG26
1.2.5ÜBERFORDERUNG28
1.2.6ÜBERFORDERUNG IM BERUF30
1.2.6.1Maßnahmen zur Senkung der Überforderung im Beruf32
1.3KÖRPERLICHE FITNESS35
1.3.1SPORTLICHE […]
Wie der Titel bereits angibt, werden in der folgenden Arbeit die Aufgaben von Managern in Unternehmen mit elementaren Lehren und Erkenntnissen aus dem Spitzensport verglichen.
Die gemeinsame Basis, auf der beide Disziplinen aufbauen, ist auch das gemeinsame Ziel: Die Höchstleistung. Sowohl im Management als auch im Spitzensport ist die maximale Ausschöpfung des Leistungspotenzials zur Erreichung von Höchstleistungen eine Notwendigkeit. Diese Argumentation bietet den Grundstock für die These, dass der Zugang zu diesem Leistungspotenzial sowohl von Seiten des Managements als auch von Seiten des Spitzensports sehr oft der gleiche ist.
Die komparative Analyse ermöglicht nicht nur eine ganzheitliche Sicht, sondern zeigt auch Parallelen auf, doch vor allem ermöglicht sie die Schließung von Lücken. Interdisziplinarität als Mittel zur Lückenschließung hat sich bereits in vielen Bereichen bewährt. Einige Consulting-Unternehmen machen sich exakt diesen Ansatz bereits zunutze, indem sie Leute aus den unterschiedlichsten Disziplinen einstellen. Die Wiener Niederlassung der Boston Consulting Group hat zum Beispiel einen Arzt und sogar einen Sinologen im Team. Die auf den ersten Blick als absurd erscheinende Idee, einen Sinologen zur Unternehmensberatung heranzuziehen, ist bei näherer Betrachtung umso logischer.
Es geht um eine andere Betrachtungsweise von Problemen, andere Denkansätze und prozesse, frei von intradisziplinären Schemata, und um kreative Lösungsansätze. Aus denselben Gründen werden japanische Spitzenmanager in militärische Drill-Camps gesteckt und verbringen unsere Ski-Stars in der Sommerpause Tage mit den verschiedensten anderen Sportarten.
Diese Arbeit hat also den Zweck, unter Zuhilfenahme einer zweiten Disziplin dem Spitzensport eventuelle Lücken im Unternehmensmanagement zu schließen und Verbesserungen der behandelten Themen zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNIS3
ABBILDUNGSVERZEICHNIS6
TABELLENVERZEICHNIS8
EINLEITUNG9
1.DER MENSCH ALS KAPITAL10
1.1MENSCHENTYPEN11
1.1.1ALLGEMEIN11
1.1.2TEMPERAMENTSTYPOLOGIE11
1.1.3KONSTITUTIONSTYPOLOGIE12
1.1.4ANTHROPOSOPHISCHES MENSCHENBILD14
1.1.5ANSÄTZE IN DER WIRTSCHAFT18
1.2.1DEFINITION20
1.2.2TALENTSUCHE21
1.2.3TALENTAUSWAHL24
1.2.4TALENTFÖRDERUNG26
1.2.5ÜBERFORDERUNG28
1.2.6ÜBERFORDERUNG IM BERUF30
1.2.6.1Maßnahmen zur Senkung der Überforderung im Beruf32
1.3KÖRPERLICHE FITNESS35
1.3.1SPORTLICHE […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7181
Jelly, Jürgen: Management und Spitzensport - Komparative Analyse
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: bfi-Euroteam Fachhochschul-Studiengangs GmbH, Fachhochschule, Diplomarbeit,
2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
- 3 -
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS 3
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 6
TABELLENVERZEICHNIS 8
EINLEITUNG 9
1. DER MENSCH ALS KAPITAL
10
1.1 M
ENSCHENTYPEN
...11
1.1.1 A
LLGEMEIN
...11
1.1.2 T
EMPERAMENTSTYPOLOGIE
...11
1.1.3 K
ONSTITUTIONSTYPOLOGIE
...12
1.1.4 A
NTHROPOSOPHISCHES
M
ENSCHENBILD
...14
1.1.5 A
NSÄTZE IN DER
W
IRTSCHAFT
...18
1.2.1 D
EFINITION
...20
1.2.2 T
ALENTSUCHE
...21
1.2.3 T
ALENTAUSWAHL
...24
1.2.4 T
ALENTFÖRDERUNG
...26
1.2.5 Ü
BERFORDERUNG
...28
1.2.6 Ü
BERFORDERUNG IM
B
ERUF
...30
1.2.6.1 Maßnahmen zur Senkung der Überforderung im Beruf...32
1.3 K
ÖRPERLICHE
F
ITNESS
...35
1.3.1 S
PORTLICHE
L
EISTUNGSFÄHIGKEIT
...35
1.3.2 P
ERSÖNLICHKEITSSTÄRKUNG DURCH
S
PORT
...41
1.3.3 S
PORT UND
G
ESUNDHEIT
...42
1.3.4 K
ÖRPERLICHE
F
ITNESS IM
B
ERUF
...44
1.4 E
RNÄHRUNG
...47
1.4.1 E
NERGIE
...47
1.4.2 K
ÖRPERGEWICHT
...53
1.4.3 E
RNÄHRUNG DES
S
PITZENSPORTLERS
...56
- 4 -
1.4.4 E
RNÄHRUNG IM
B
ERUF
...60
2. FÜHRUNG 64
2.1 W
AS BEDEUTET
F
ÜHRUNG
...64
2.1.1 D
ER
F
AKTOR
H
UMAN
R
ELATIONS
...64
2.1.2 F
ÜHRUNGSARBEIT FALSCH VERSTANDEN
...65
2.2 F
ÜHRUNGSSTILE
...68
2.2.1 G
RUND
-F
ÜHRUNGSSTILE
...68
2.2.2 D
IE
V
ISION
...69
2.2.3 D
URCH FLEXIBLES
F
ÜHREN MEHR ERREICHEN
...76
2.2.4 F
AIR
P
ROCESS
...77
2.2.4.1 Was bedeutet Fair Process? ...77
2.2.4.2 Mentale Hürden überwinden ...81
2.2.5 I
NFORMELLE
N
ETZWERKE
...82
2.2.5.1 Die mathematische Sicht von Netzwerken ...90
2.2.5.2 Netzwerke in Mannschaften ...92
2.3 E
MOTIONALE
I
NTELLIGENZ
...96
2.3.1 T
RAINING DER
E
MOTIONALEN
I
NTELLIGENZ
...97
2.3.1.1 Sportlicher Handlungsablauf ...98
2.3.2 K
RITISCHE
D
ENKANSTÖßE ZUR EMOTIONALEN
I
NTELLIGENZ
...102
2.4 V
ORBILDWIRKUNG
...103
2.4.1 P
YGMALIONS
G
ESETZ
...103
2.4.1.1 Der negative Effekt...105
2.4.2 R
EALITÄT
...106
2.4.3 S
ELBSTVERTRAUEN
...107
3. MOTIVATION 108
3.1 D
EFINITION
...108
3.2 I
NNERE
K
ÜNDIGUNG
...110
3.3 D
ER
U
RSPRUNG DER
M
OTIVIERUNG
...112
3.4 B
ELOHNUNG
...123
3.5 I
NCENTIVES UND
B
ONUS
S
YSTEME
...125
3.6 B
ETRIEBLICHES
V
ERBESSERUNGSWESEN
(BVW) ...131
3.7 L
OB
...133
- 5 -
3.8 G
EHALTSMANAGEMENT
...135
3.9 P
SYCHOLOGISCHES
T
RAINING
...136
3.9.1 W
ARUM PSYCHOLOGISCHES
T
RAINING
...136
3.9.2 F
ORMEN DES PSYCHOLOGISCHEN
T
RAININGS
...137
Wirkungen ...137
3.9.3 A
UTOGENES
T
RAINING
...140
3.9.4 M
ENTALES
T
RAINING
...142
4. KAPITEL: ERFOLG
147
4.1 M
ESSUNG
/M
ESSBARKEIT DES
E
RFOLGES
...147
4.1.1 R
ETURN ON
M
ANAGEMENT
...147
4.1.1.1 Definition ...147
4.1.1.2 Prüffragen...149
4.1.2 D
IE
W
ISSENSBILANZ
...152
4.1.2.1 Unterschied Finanzbilanz Wissensbilanz ...154
4.1.2.2 Transparenzforderung versus Verlust von Wettbewerbsvorteilen ...156
4.1.3 R
ETURN
O
N
I
NVESTMENT BEI
S
PORTLERN
...157
4.1.3.1 Beruflicher Erfolg von Sportlern...157
4.1.3.2 Persönlicher ROI von Sportlern...163
4.1.3.3 ROI im Sponsoring ...164
4.2.1 M
EDIENÄSTHETIK
...168
4.2.2 Ö
FFENTLICHE
B
EKANNTHEIT IM
S
PORT
...169
4.2.3 E
ITELKEIT IM
M
ANAGEMENT
...170
4.3 L
EISTUNG
...173
4.3.1 L
EISTUNG IN DER
N
ATURWISSENSCHAFT
...173
4.3.2 L
EISTUNG IM
S
PORT
...174
4.3.3 L
EISTUNG IN DER
W
IRTSCHAFT
...174
4.3.4 Z
EIT
-L
EISTUNGS
-M
ODELL
...175
ZUSAMMENFASSUNG 179
LITERATURVERZEICHNIS 180
- 6 -
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Tab. 1:
Die Alterszonen in verschiedenen leichtathletischen Sportarten und disziplinen 2121 ... 8
Tab. 2:
Die altersspezifische Dynamik in der Leistungsentwicklung von Männern über 100 m
Freistil 26 ... 8
Tab. 3:
Symptome und Zeichen der Erscheinungsformen des Übertrainings 28... 8
Tab. 4:
Maßnahmen zur Behandlung des Übertrainings 29... 8
Tab. 5:
Belastungskomponenten und ihre Operationalisierung (Quantifizierung) 36... 8
Tab. 6:
Klassifizierung der körperlichen Aktivitäten in MET Gruppen 42 ... 8
49Tab. 7:
Physikalischer und physiologischer Brennwert sowie Atwater-Faktoren im Überblick 49 . 8
Tab. 8:
Anteil einzelner Organe am Grundenergieumsatz 5050 ... 8
50Tab. 9:
Mittlerer Grundumsatz von Männer und Frauen verschiedenen Alters 50... 8
Tab. 10:
Energieaufwand für verschiedene körperliche Aktivitäten 5151... 8
54Tab. 11:
Normative Bewertung der Körpermasse eines 1,70 m großen Mannes an Hand des BMI
54 8
75Tab. 12:
Die sechs Führungsstile im Überblick 75 ... 8
98Tab. 13:
Schematische Darstellung des Ablaufs einer Bewegungshandlung unter Angabe der
dabei beteiligten anatomischen Strukturen bzw. ihrer Funktion 98... 8
Tab. 14:
Top-Ten der Großverdiener weltweit, 2000 128128... 8
138Tab. 15:
Formen des psychologischen Trainings, Wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten
136 8
158Tab. 16:
Soziale Herkunft und soziale Schicht der Spitzensportler im Vergleich mit der
Gesamtbevölkerung 157... 8
159Tab. 17:
Schichtzugehörigkeit von männlichen Spitzensportlern verschiedener Sportarten 159 8
160Tab. 18:
Relative Werte der Mobilitätsrichtung 160... 8
Abb. 1: Leptosomer Typ ... 12
Abb. 2: Athletischer Typ ... 13
Abb.3: Pyknischer Typ ... 14
Abb. 4: Der Prozess der Auswahl und Ausbildung im Sport... 25
Abb. 5: Vereinfachtes Modell der Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit... 35
Abb. 6: Reduziertes Strukturmodell der Komponenten der Kondition des Sportlers ... 38
Abb. 7: Erweitertes Strukturmodell zur Kondition des Fußballspielers ... 39
Abb. 8: Das System der Superkompensation ... 41
Abb. 9:
Abhängigkeit der relativen Mortalität (Sterblichkeit) vom relativen Körpergewicht. Die Gruppe
der Probanden mit Untergewicht in dieser Studie bestand zu einem großen Teil aus Rauchern,
sodass die ermittelte höhere Sterblichkeit vermutlich eher auf den schädlichen Einfluss des
Rauchens als auf das Untergewicht an sich zurückzuführen ist. [Nach R. Grossklaus,
Ernährungsumschau 7, S.277, 19990] ... 55
Abb. 10: Internationaler Vergleich der verzehrten Fette und der Herzerkrankungen ... 58
Abb. 11: Führungsstile und ihre Einflussbasis ... 69
Abb. 12: Die Unternehmensvision... 70
- 7 -
Abb. 13: Beispiel einer Unternehmensvision ... 75
Abb. 14: Zwei komplementäre Wege zur Leistung ... 80
Abb. 15: Offizielles Organigramm eines Unternehmens... 85
Abb. 16: Das Beratungsnetz eines Unternehmens... 85
Abb. 17: Das Vertrauensnetz eines Unternehmens... 86
Abb. 18: Das Vertrauensnetz des CEO ... 87
Abb. 19: Die Grenzen der Motivation ... 106
Abb. 20: Maslow'sche Bedürfnispyramide ... 113
Abb. 21: Die Beeinflussung der Arbeitseinstellung ... 119
Abb. 22:
Der Einfluss der Hygienefaktoren und Motivatoren auf die Arbeitseinstellung in sechs
Ländern... 120
Abb. 23: Motorisches Üben unter besonderer Berücksichtigung mentaler Übungsformen... 142
Abb. 24: Formen des Mentalen Trainings ... 143
Abb. 25: Zeit-Leistungs-Modell... 176
- 8 -
TABELLENVERZEICHNIS
Tab. 1: Die Alterszonen in verschiedenen leichtathletischen Sportarten und disziplinen... 22
Tab. 3: Symptome und Zeichen der Erscheinungsformen des Übertrainings ... 29
Tab. 4: Maßnahmen zur Behandlung des Übertrainings ... 30
Tab. 5: Belastungskomponenten und ihre Operationalisierung (Quantifizierung) ... 37
Tab. 6:
Klassifizierung der körperlichen Aktivitäten in MET Gruppen ... 43
Tab. 7: Physikalischer und physiologischer Brennwert sowie Atwater-Faktoren im Überblick... 50
Tab. 8: Anteil einzelner Organe am Grundenergieumsatz... 51
Tab. 9: Mittlerer Grundumsatz von Männer und Frauen verschiedenen Alters ... 51
Tab. 10: Energieaufwand für verschiedene körperliche Aktivitäten ... 52
Tab. 11: Normative Bewertung der Körpermasse eines 1,70 m großen Mannes an Hand des BMI... 55
Tab. 12: Die sechs Führungsstile im Überblick... 76
Tab. 13: Schematische Darstellung des Ablaufs einer Bewegungshandlung unter Angabe der dabei
beteiligten anatomischen Strukturen bzw. ihrer Funktion... 99
Tab. 14: Top-Ten der Großverdiener weltweit, 2000 ... 129
Tab. 15: Formen des psychologischen Trainings, Wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten... 139
Tab. 16:
Soziale Herkunft und soziale Schicht der Spitzensportler im Vergleich mit der Gesamt-
bevölkerung ... 159
Tab. 17: Schichtzugehörigkeit von männlichen Spitzensportlern verschiedener Sportarten... 160
Tab. 18: Relative Werte der Mobilitätsrichtung ... 161
- 9 -
EINLEITUNG
Wie der Titel bereits angibt, werden in der folgenden Arbeit die Aufgaben von
Managern in Unternehmen mit elementaren Lehren und Erkenntnissen aus dem
Spitzensport verglichen.
Die gemeinsame Basis, auf der beide Disziplinen aufbauen, ist auch das
gemeinsame Ziel: Die Höchstleistung. Sowohl im Management als auch im
Spitzensport ist die maximale Ausschöpfung des Leistungspotenzials zur Erreichung
von Höchstleistungen eine Notwendigkeit. Diese Argumentation bietet den
Grundstock für die These, dass der Zugang zu diesem Leistungspotenzial sowohl
von Seiten des Managements, als auch von Seiten des Spitzensports sehr oft der
gleiche ist.
Die komparative Analyse ermöglicht nicht nur eine ganzheitliche Sicht, sondern zeigt
auch Parallelen auf, doch vor allem ermöglicht sie die Schließung von Lücken.
Interdisziplinarität als Mittel zur Lückenschließung hat sich bereits in vielen Bereichen
bewährt. Einige Consulting-Unternehmen machen sich exakt diesen Ansatz bereits
zunutze, indem sie Leute aus den unterschiedlichsten Disziplinen einstellen. Die
Wiener Niederlassung der Boston Consulting Group hat zum Beispiel einen Arzt und
sogar einen Sinologen im Team. Die auf den ersten Blick als absurd erscheinende
Idee, einen Sinologen zur Unternehmensberatung heranzuziehen, ist bei näherer
Betrachtung umso logischer.
Es geht um eine andere Betrachtungsweise von Problemen, andere Denkansätze
und prozesse, frei von intradisziplinären Schemata, und um kreative
Lösungsansätze. Aus denselben Gründen, werden japanische Spitzenmanager in
militärische Drill-Camps gesteckt und verbringen unsere Schi-Stars in der
Sommerpause Tage mit den verschiedensten anderen Sportarten.
Diese Arbeit hat also den Zweck, unter Zuhilfenahme einer zweiten Disziplin dem
Spitzensport eventuelle Lücken im Unternehmensmanagement zu schließen und
Verbesserungen der behandelten Themen zu erreichen.
- 10 -
1. DER MENSCH ALS KAPITAL
Die Grundlage jeden Erfolges, sowohl im Sport als auch in Unternehmen, stellt der
Mensch dar. Sei es das Talent eines Sportlers, das Know-how des Mitarbeiters oder
das Führungsgeschick des Managers, es stellt a priori die Basis des Erfolges dar.
Betrachten wir Erfolg auch unter dem Kriterium der Dauerhaftigkeit, also auf
langfristige Sicht, so wird das ,,Kapital Mensch" noch um vieles wertvoller.
Wie bei Finanzkapital kann man auch beim menschlichen Kapital in Eigen- und
Fremdkapital unterscheiden. Es gilt also ebenso, je höher der Eigenkapitalanteil bzw.
überhaupt das Eigenkapital ist, desto mehr wert ist - und besitzt - das Unternehmen.
Das Kapital Mensch stellt in diesem Sinne das höchste Gut dar. Leider wird dies
jedoch noch allzu oft unterschätzt bzw. unterbewertet.
Es ist schwierig, dieses Kapital zu definieren, und es zu bewerten. Vermutlich steht
es auch deshalb in keiner Bilanz. Eine Möglichkeit zur Bewertung wird mit Hilfe einer
sogenannten ,,Wissensbilanz" versucht, welche vor allem in Betrieben mit hohen
immateriellen Vermögenswerten wie Forschungsbetriebe bereits zum Einsatz
gebracht wird. Im Folgenden wird deshalb versucht, die verschiedenen
Menschentypen zu charakterisieren und auf die Leistungsfähigkeit einzugehen. Das
Letztere selbstverständlich vor allem im Hinblick auf Sportler. Jedoch soll auf keinen
Fall nur an körperliche Betätigung gedacht werden, sondern vielmehr ein Bezug
zwischen geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit hergestellt werden.
- 11 -
1.1 Menschentypen
1.1.1 Allgemein
Die Kategorisierung von Menschen in verschiedene Typen ist eine Basis von jeder
Wissenschaft, die in irgendeiner Art und Weise mit Menschen zu tun hat. Diese
nahezu unendlich vielen Menschenbilder, die sich daraus ergeben haben, sind
interdisziplinär meist unbrauchbar, da sie sich nur auf die für das eigene Gebiet
benötigten Kriterien beschränken.
1.1.2 Temperamentstypologie
Viele bekannte Modelle stammen aus der Psychologie. So entwickelte bereits
Hippokrates zwischen 460 und 377 vor Christus eine Art Temperamentstypologie,
indem er die Persönlichkeitsunterschiede nach den vier Körpersäften (Blut, Schleim,
gelbe und schwarze Galle) gruppierte. Daraus ergaben sich folgende vier Typen
1
:
1. Sanguiniker:
Ein Mensch von lebhaftem, heiterem Temperament;
2. Phlegmatiker:
Langsamer, schwer ansprechbarer Mensch, mit oft großem Durchhalte-
vermögen;
3. Choleriker:
Ein leidenschaftlicher, leicht reizbarer, jähzorniger Mensch;
4. Melancholiker:
Er ist geprägt von Traurigkeit, Schmerz oder Nachdenklichkeit mit den
Merkmalen schwacher Spontaneität und tiefer Impressionalität.
1
vgl. Müller, S., 2003, S. 12
- 12 -
1.1.3 Konstitutionstypologie
Eine weitere sehr bekannt Einteilung ist die Konstitutionstypologie nach Kretschmer.
Er beobachtete an psychiatrischen Patienten eine Korrelation zwischen drei
Körperbautypen und der Art der psychischen Erkrankung
2
.
1. Leptosom:
Rumpf und Extremitäten schlank und schmal, schmales, spitzes Gesicht,
hageres, sehniges Oberflächenrelief.
Abb. 1: Leptosomer Typ
2
vgl. Müller, S., 2003, S. 27
- 13 -
2. Athletisch:
Trapezförmiger Rumpf, kräftiges Knochen- und Muskelrelief, große Hände und
Füße, derbes konturenreiches Gesicht.
Abb. 2: Athletischer Typ
- 14 -
3. Pyknisch:
Kurzer und gewölbter Rumpf, Extremitäten relativ kurz, Kopf groß und rund auf
massivem Hals, breites, weiches Gesicht.
Abb.3: Pyknischer Typ
1.1.4 Anthroposophisches Menschenbild
Diese Menschenkunde versucht die naturwissenschaftliche und geisteswissen-
schaftliche Betrachtungsweise miteinander zu kombinieren.
Es gibt zwei Ansätze
3
:
1.
Die Dreigliederung des Menschen
2.
Die vier Wesensglieder des Menschen
3
vgl. http://naturmedizin.qualimedic.de/Anthroposophie_dreigliederung.html
- 15 -
Ad 1.:
,,Die Dreigliederung des Menschen im anthroposophischen Menschenbild beschreibt
drei Bereiche des Menschen:
die Nerven-Sinnes-Organisation, die vornehmlich im Kopf und in übrigen
Nervengebieten beheimatet ist, sodann
die rhythmische Organisation, die vor allem im Brustkorb ihren Hauptsitz hat
und
den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Bereich des Menschen, der in den Bauch-
organen und eben in Armen und Beinen anzutreffen ist.
Diesen drei Wesensgliedern entsprechen drei Seelenqualitäten:
das Denken dem Nerven-Sinnes-Bereich
das Fühlen dem rhythmischen Bereich sowie
das Wollen beziehungsweise Handeln dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-Bereich.
Die drei genannten Bereiche sind nicht isoliert voneinander zu denken, sondern
durchdringen sich gegenseitig. So ist der Nerven-Sinnes-Bereich bis in die kleinsten
Verästelungen überall im Organismus mitwirksam und eben nur konzentriert vor
allem im Kopfe lokalisiert, die rhythmischen Vorgänge finden sich auch nicht nur im
Brustkorb, sondern letztendlich im gesamten übrigen Organismus in vielfacher Art
und Weise, und auch die Stoffwechselvorgänge finden sich im gesamten
Organismus, wenngleich sie ihren Hauptsitz in den Bauchorganen haben.
So wie der Nerven-Sinnes-Bereich wie ein Netzwerk den gesamten Körper auf
vielfältige Art und Weise durchzieht, so kann auch das sich auf den Nerven-Sinnes-
Bereich stützende Denken ein fast unendlich großes Netzwerk sich gegenseitig
stützender und ergänzender Gedanken bilden.
Und so wie Herz und Lunge mit Anspannung und Erschlaffung (Herz)
beziehungsweise mit Einatmung und Ausatmung (Lunge) jeweils entgegengesetzte
Vorgänge ausführen (polare Tätigkeit), so ist das sich daran anlehnende Gefühl
ebenfalls polar angelegt: Liebe-Hass, Antipathie-Sympathie, Freude-Traurigkeit und
so weiter.
- 16 -
Und so wie der Stoffwechsel letztendlich zielgerichtet Stoffwechselprodukte
hervorbringt, so sind die sich daran anlehnenden Handlungsimpulse ebenso eine in
eine Richtung zielgerichtete fortwirkende Kraft, die Veränderungen bewirkt."
Ad 2:
,,Die Viergliederung des Menschen (die vier Wesensglieder) im anthroposophischen
Menschenbild ergibt sich aus folgendem Aspekt der Menschenbetrachtung.
Physischer Körper
So wird zunächst einmal vom physischen Körper gesprochen, ebenso wie es auch
sonst materielle Körper auf der Erde gibt (Steine, Wasser, Holz). Dieser physische
menschliche Körper könnte jedoch aus sich heraus nicht leben, dazu bedarf es eines
weiteren Wesensgliedes, welches alle Lebewesen auf der Erde haben und das am
klarsten bei den Pflanzen zu Tage tritt.
Ätherleib
Dieses Wesensglied, welches Lebensleib oder Ätherleib genannt wird, durchdringt
den physischen Körper und bewirkt die Lebensvorgänge. Während etwa beim Stein
die Form des Steines und seine Zusammensetzung hinreichend erklärt werden
können - ausschließlich durch die Atom- und Molekülkräfte der Mineralien, die den
Stein zusammensetzen, so ist dies bei den Pflanzen nicht mehr der Fall.
Pflanzenform und Pflanzenwachstum kann nach anthroposophischer Anschauung
nicht aus den Molekülkräften beziehungsweise nicht ausschließlich physikalisch-
chemisch erklärt werden, wenngleich der sogenannte Lebensleib oder der Ätherleib
sich auch der physikalischen und chemischen Kräfte bedient. So ist nach
anthroposophischer Auffassung etwa eine Rose nur aus dem Zusammenwirken von
physischem Leib und Ätherleib erklärbar, während ein Edelstein rein aus physischen
Gründen hinreichend beschrieben werden kann. Dass es fast jedem Menschen ohne
besondere Vorkenntnis gelingt, anhand der sichtbaren Formen zwischen Materialien
zu unterscheiden, die niemals gelebt haben und Körpern, die Leben in sich tragen
bzw. die einmal gelebt haben, entspricht diesem Unterschied zwischen Lebewesen
und Nicht-Lebewesen.
- 17 -
Astralleib
Neben dem physischen Leib und dem Ätherleib wird in der Anthroposophie als
nächstem Wesensglied vom sogenannten Astralleib gesprochen, den sowohl
Menschen als auch Tiere haben. Der Astralleib vermittelt die Beseelung der
Lebewesen. Dabei bedeutet Beseelung, dass solche Lebewesen Gefühle wie
Freude, Aggression, Trauer usw. in sich tragen. Diese Beseelung ist überall da
anzutreffen, wo sich innere Hohlräume durch Einstülpung während der embryonalen
Wachstumsphase entwickelt haben, was im Pflanzenreich nicht vorkommt
höchstens angedeutet in der Blütenbildung.
Der Astralleib sorgt also für die Ausbildung von Innenräumen und damit für
Beseelung der Lebewesen. So wie der Ätherleib den physischen Leib durchdringt, so
tut dies auch der Astralleib. Damit hängt zusammen, dass wir unseren Organismus
und uns selbst auch fühlen können.
Das Ich
Als viertes Wesensglied wird von der Anthroposophie das Ich des Menschen als
geistiger Wesenskern beschrieben, welcher bei Tieren so nicht entwickelt ist. Auch
das Ich des Menschen durchzieht alle anderen Wesensglieder und lässt uns eine
eigene Identität in leiblicher, seelischer und geistiger Hinsicht gewahr werden. Das
Ich des Menschen wird in der anthroposophischen Menschenkunde nicht als von
Nervenvorgängen körperlich produziert oder als von körperlichen Vorgängen
abhängig angesehen, sondern es wird ihm eine freie Tätigkeit zugeschrieben, die
sich der anderen Wesensglieder inklusive der körperlichen Vorgänge bedient. So
werden etwa schöpferische Gedanken nicht als Produkt von Gehirnvorgängen
gesehen, sondern eben als Gedankeneinfall, der vom Gehirn in der Gedankenwelt
ebenso wahrgenommen wird wie das Auge Seheindrücke seiner Umgebung erhält.
Ebenso wie ein schadhaftes Auge die Seheindrücke beeinträchtigen kann, so
können Veränderungen der physiologischen Gehirnabläufe durch Krankheit und
Verletzung die Wahrnehmung von Gedanken behindern.
Diese viergliedrige Betrachtungsweise des Menschen spielt in der Anthropo-
sophischen Medizin hinsichtlich der Diagnostik und Therapie ebenso wie die
Dreigliederung eine große Rolle. Neben der Dreigliederung und der Viergliederung
des Menschen gibt es weitere Gliederungsmöglichkeiten in der anthroposophischen
- 18 -
Menschenkunde. Allen gemeinsam ist die Gewissheit, dass der Mensch einmal der
physischen Welt mit all ihrer Vergänglichkeit angehört und zum anderen eben auch
einer geistigen Welt, die auf Dauer angelegt ist und nicht der physischen
Vergänglichkeit zugehörig ist.
4
1.1.5 Ansätze in der Wirtschaft
Auch die Wirtschaft bedient sich verschiedener Menschenbilder und Kategori-
sierungen. Zumeist dienen diese dann als Basis für verschiedene Motivations-
theorien. Diesbezüglich findet man auch immer den gleichen Ausgangspunkt für die
bestehenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb dieser Materie: ist der Mensch
von sich aus bereit etwas zu leisten oder nicht? (siehe hierzu auch Kapitel 3:
Motivation!)
Eines der bekanntesten Menschenbilder hierzu wurde von Douglas McGregor
entwickelt
5
.
McGregor unterschied zwei Typen von Menschen anhand von zwei Theorien:
1. Theorie
X:
Diese Sichtweise beruht auf der Annahme, dass der Mensch im Allgemeinen
nicht gerne arbeitet, und deshalb autoritativ zur Leistung gezwungen und
laufend kontrolliert werden muss.
2. Theorie
Y:
Stellt das optimistischere Menschenbild dar, und geht davon aus, das der
Mensch grundsätzlich durchaus bereit ist, Leistung zu erbringen, sofern die
Arbeit für seine Selbstverwirklichung einen intrinsischen Wert hat, und er
entsprechend motiviert ist.
Diese Unterscheidung entzweit nach wie vor nicht nur die Experten. Zumeist ordnen
Führungskräfte nach Gefühl und überwiegend persönlichen Erfahrungen die
Menschen einer der beiden Theorien zu. Die Verhaltensforscher sind sich zum
4
http://naturmedizin.qualimedic.de/Anthroposophie_viergliederung.html
5
McGregor, D., 1960, S. 25
- 19 -
Großteil einig, dass der Mensch von sich aus zur Leistung bereit ist. Versuche an
Affen haben zum Beispiel gezeigt, dass Tiere es vorziehen, etwas zu tun zum
Beispiel einen Hebel betätigen
6
um an ihre Nahrung zu kommen. Auch die Katze
spielt mit der Maus, bevor sie sie frisst. Natürlich stellt sich die Frage, zu welcher
Leistung man bereit ist.
Sicherlich gibt es Leute, die nicht bereit sind, einer ,,herkömmlichen" Arbeit
nachzugehen, aus welchem Grund auch immer, genauso, wie es Arbeiten gibt, die
anscheinend von niemandem gemacht werden wollen. Gibt es in einer Firma eine
Position, die alle paar Monate von einem neuen Mitarbeiter bekleidet wird, so sollte
man überlegen, ob es nicht an der Position selbst liegt, und diese eventuell verändert
werden kann.
Natürlich ist es nicht so, dass jeder seinen ,,Traumjob" bekommen kann, jedoch
zeigen Befragungen, dass Mitarbeiter ihre Arbeitsmoral mit ca. 90 Prozent
7
einstufen,
also ihre eigene Leistungsbereitschaft sehr hoch einschätzen.
Im Sport scheint sich diese Frage gar nicht zu stellen. Um absolute Höchstleistungen
zu erbringen, wird eine hundertprozentige Leistungsbereitschaft vorausgesetzt.
Dementsprechend wird auf solche Unterscheidungen von Menschentypen auch mehr
oder weniger verzichtet. Allerdings wird sehr wohl auf physisch basierende
Typologien zurückgegriffen, um die körperliche Eignung für gewisse Sportarten
festzustellen.
Allerdings kommt es auch bei Spitzensportlern vor, dass diese die Eigenmotivation
verlieren. Als Beispiel sei hier Andrej Medwedew, ein Tennisstar, erwähnt. Er stammt
aus der Ukraine, und kam bereits in seinen ersten Jahren in der ATP zu großen
Erfolgen, und somit auch viel Geld. Mit kaum 18 Jahren, hatte er bereits genug Geld
für ein ganzes (luxuriöses) Leben verdient. Er verlegte seinen Wohnsitz nach Monte
Carlo, und verschwand für fast zwei Jahre von der Tennisszene. Der extrinsische
Motivationsfaktor Geld, hatte die intrinsische Motivation zerstört (siehe auch Kapitel
3.1, Definition der Motivation).
6
vgl. Sprenger, R., 2002, S. 190
7
vgl. Sprenger, R., 2002, S. 191
- 20 -
1.2. Talente
,,Außergewöhnliche Menschen erbringen außergewöhnliche Leistungen." Dieser
Spruch gilt nicht nur für den Sport, auch im Wirtschaftsleben sind Leute mit
außergewöhnlichen Fähigkeiten gefragt.
In die Suche und Förderung von diesen Talenten, investiert das Management der
Unternehmen und des Sports enorm viel Zeit und Geld. Aus diesem Grund wird auch
im folgenden Kapitel auf diesen Punkt eingegangen und versucht, eine
Argumentationslinie zu wählen, die sowohl im Sport als auch im Personalwesen der
Unternehmen ihre Gültigkeit hat.
1.2.1 Definition
Prinzipiell gibt es zwei unterschiedliche Ansätze zur Klärung des Begriffes ,,Talent".
1. Statischer
Ansatz
8
Dieser versucht den Begriff anhand von folgenden vier Charakteristiken zu
erfassen:
Dispositionen, die das Können betonen
Bereitschaft, die das Wollen hervorheben
Soziales Umfeld, das die Möglichkeiten bestimmt
Resultate, die das wirklich erreichte (Leistungs-) Ergebnis
dokumentieren
2. Dynamischer
Ansatz
9
Hier wird von einem aktiven, zielgerichteten Prozess ausgegangen, welcher
einen die ganze Persönlichkeit einbeziehenden Veränderungsvorgang
beschreibt. Dieser Begriffe beinhaltet drei zentrale Charakteristika:
Den aktiven Veränderungsprozess
Die Steuerung durch Training und Wettkampf
Die pädagogische Begleitung
8
vgl. Joch, W., 1992, S. 83
9
vgl. Mühle, G., 1971, S. 93
- 21 -
Diese zwei Ansätze stellen die Basis für die Definition des Begriffes Talent nach Joch
dar, welchem heute - gegenüber einzelnen statischen oder dynamischen Ansätzen -
der Vorzug gegeben wird:
,,Talent besitzt, oder ein Talent ist, wer auf der Grundlage von Disposition, Leistungs-
bereitschaft und den Möglichkeiten der realen Lebensumwelt über dem Alters-
durchschnitt liegende (möglichst im Wettkampf nachgewiesene) entwicklungsfähige
Leistungsresultate erzielt, die das Ergebnis eines aktiven, pädagogisch begleiteten
und intentional durch Training gesteuerten Veränderungsprozesses darstellen, der
auf ein später zu erreichendes hohes Leistungsniveau zielstrebig ausgerichtet ist."
10
Laut dieser Begriffsdefinition versteht man unter Talent also die Gesamtheit der
Voraussetzungen eines Menschen für Leistung und Leistungsentwicklung. Dabei
werden das Niveau und die Entwicklungsmöglichkeiten der Leistungs-
voraussetzungen von den Anlagen und dem Prozess der Tätigkeit bestimmt.
Eignung ist somit als Ergebnis der aktiven Auseinandersetzung der Persönlichkeit
mit der Umwelt zu verstehen.
Nach einer Studie von Ulbrich
11
haben innerhalb einer normalverteilten Bevölkerung
ungefähr sechs Prozent aller Personen einen überdurchschnittlich hohen Wert eines
Merkmales. Mehrfachtalente kommen noch viel seltener vor. Innerhalb einer bereits
definierten Gruppe von Talenten, sind es nur drei Prozent! Jemand, der also nicht
nur in einer sondern sogar in mehreren Disziplinen eine herausragende Eigenschaft
besitzt, stellt demnach eine extreme Ausnahme dar.
1.2.2 Talentsuche
,,Talentsuche bezeichnet die durch verschiedene Institutionen auf verschiedenen
Ebenen durchgeführte Auswahl sportlicher Talente zur Talentförderung."
12
Der Sport stellt im Gegensatz zur Wirtschaft eine extreme Ausformung der
Talentsuche dar, da es nicht allein um die richtige Auswahl der Talente geht, sondern
auch um die rechtzeitige. Um sportliche Höchstleistungen erbringen zu können,
10
Weineck, J., 2000, S. 119
11
vgl. Ulbrich, J., 1974, S. 285
12
Röthig, P., 1983, S. 314
- 22 -
bedarf es einer langfristigen und systematischen Vorbereitung, welche je nach
Disziplin zwischen sechs und zehn Jahre umfasst.
Im Sport gibt es ein sogenanntes ,,Höchstleistungsalter", zu dem die optimalen
Leistungen erbracht werden können. Das bedeutet, dass vor dieses Alter der
entsprechende Trainingszeitraum - der für die Erreichung einer Höchstleistung
notwendig ist vorgeschaltet werden muss. Die untenstehende Tabelle soll dies
verdeutlichen:
Zone I
Zone II
Zone III
Sportart
Erste Erfolge
Optimale Leistungen
Stabilisierung der
Höchstleistungen
Leichtathletik Männer
Frauen
Männer
Frauen
Männer
Frauen
100 m
19-21
17-19
22-24
20-22
25-26
23-25
200 m
19-21
17-19
22-24
20-22
25-26
23-25
400 m
22-23
20-21
24-26
22-24
27-28
25-26
800 m
23-24
20-21
25-26
22-25
27-28
26-27
1.500
m
23-24 25-27 28-29
5.000
m
24-25 26-28 29-30
10.000
m
24-25 26-28 29-30
Marathon
25-26 27-30 31-35
110 m Hürden
22-23
18-20
24-26
21-24
27-28
25-27
400 m Hürden
22-23
24-26
27-28
3.000 m Hindernis
24-25
26-28
27-28
20 km Gehen
25-26
27-29
30-32
50 km Gehen
26-27
28-30
31-35
Hochsprung 20-21
17-18
22-24
19-22
25-26
23-24
Stabhochsprung 23-24 25-28 29-30
Weitsprung 21-22
17-19
23-25
20-22
26-27
23-24
Dreisprung
22-23 24-27 28-29
Kugelstoßen 22-23
18-20
24-25
21-23
26-27
24-25
Diskuswerfen 23-24
18-21
25-26
22-24
27-28
25-26
Speerwerfen 24-25
20-22
26-27
23-24
28-29
25-26
Hammerwerfen 24-25 26-30 31-32
Zehnkampf
23-24 25-26 27-28
Fünfkampf
21-22 23-25 26-28
Tab. 1: Die Alterszonen in verschiedenen leichtathletischen Sportarten und disziplinen
Quelle: Weineck, J., 2000, S. 123
- 23 -
Da es im Sport primär um die Herausbildung der körperlichen Eigenschaften geht,
um Höchstleistungen zu erbringen, ergeht aus obiger Tabelle unter Einbeziehung
des notwendigen vorzuschaltenden Trainings, also dem Trainingsalter das Alter
einer Person, mit dem diese idealerweise mit dem Sport beginnen sollte. Nehmen wir
als Beispiel den 100 Meter-Sprinter her, dessen Höchstleistungsalter zwischen 22
und 24 Jahren liegt, und rechnen einen Trainingszeitraum von cirka 10 Jahren, der
notwendig ist, um solche Leistungen zu erbringen, so muss das Talent bereits mit
ungefähr 12 14 Jahren entdeckt und professionell gefördert werden.
Diese Trainings- bzw. Vorlaufzeit entfällt im Bereich der Wirtschaft. da lernen
prinzipiell keiner Altersgrenze unterliegt. Geistige Höchstleistungen können somit in
jedem Alter erbracht werden. Einzig der Lernfähigkeit wird in diesem Zusammenhang
ein Alter zugeordnet. In Querschnittsstudien wurde eine Reduktion der maximalen
kognitiven Leistungsgeschwindigkeit von 100 Prozent bei 20-jährigen auf nur noch
40 Prozent bei 70-Jährigen gemessen
13
. Doch ist sich die Wissenschaft
diesbezüglich uneinig, da Faktoren wie Motivation, Bereitschaft sich maximal zu
bemühen, Zeit, Ausdauer, Anstrengung beim Training und vor allem Erfahrung eine
kompensatorische Rolle spielen.
Bei der Suche nach Talenten muss auf bestimmte Faktoren Rücksicht genommen
werden, welche das sportliche Talent beeinflussen
14
.
Anthropometrische Voraussetzung: Körpergröße, Gewicht, Körper-
zusammensetzung, Körperproportionen, Lage des Körperschwerpunktes, ...
Physische Merkmale: aerobe und anaerobe Ausdauer, statische und
dynamische Kraft, Reaktions- und Aktionsschnelligkeit, Beweglichkeit, ...
Techno-motorische Voraussetzungen: Gleichgewichtsfähigkeit, Raum-,
Distanz- und Tempogefühl, Ball-, Wasser-, Schneegefühl, Ausdrucksfähigkeit,
Musikalität und rhythmische Fähigkeit
Lernfähigkeit: Auffassungsgabe, Beobachtungs- und Analysevermögen, ...
13
vgl. Gietmann, A., 1999, S. 2
14
vgl. Hahn, E., 1982, S. 85
- 24 -
Leistungsbereitschaft: Anstrengungsbereitschaft, Beharrlichkeit, Trainingsfleiß,
Frustrationstoleranz, ...
Kognitive Fähigkeiten: Konzentration, motorische Intelligenz, Kreativität,
taktisches Vermögen, ...
Affektive Fähigkeiten: psychische Stabilität, Wettkampfbereitschaft, Wett-
kampfhärte, Stressbewältigungsvermögen, ...
Sozial Faktoren: Rollenübernahme, Teamgeist, ...
Mit Ausnahme der rein körperlichen Faktoren lassen sich alle anderen Kriterien auch
auf die Bereiche außerhalb des Sports übertragen.
1.2.3 Talentauswahl
,,Unter Auswahl wird die Entscheidung über eine Ausbildung bzw. einen
Wettkampfeinsatz eines Sportlers in einer bestimmten Sportart oder Disziplin zu
einem bestimmten Zeitpunkt und für einen bestimmten Zeitraum verstanden."
15
Die Auswahl von talentierten Sportlern bzw. Mitarbeitern mit großem Potenzial ist
einer der wesentlichen Punkte im Hinblick auf den zukünftigen Erfolg. In der
Wirtschaft ist längst ein eigener Dienstleistungssektor entstanden, der sich einzig
und alleine mit dieser Frage beschäftigt die Personal-Consulting-Unternehmen. Es
scheint also, dass das Problem der Suche und Auswahl von Menschen mit
besonderen Fähigkeiten zum Einem sehr umfangreich, zum Anderen aber auch so
komplex ist, dass eine Spezialisierung notwendig ist, wobei zu erwähnen ist, dass die
endgültige Entscheidung bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters immer im
betroffenen Unternehmen selbst liegt. Die Personal-Consulter könnte man also als
eine Art ,,Sieb" bezeichnen, das die Spreu vom Weizen trennt. Doch das ist noch
nicht alles, sogenannte ,,Headhunter" jagen, wie der Name schon sagt, nach den
besten ,,Köpfen", Unternehmen konzipieren tagelange Auswahlverfahren
15
Hofmann, S. / Schneider, G., 1985, S. 45
- 25 -
(assessment centre), denen sich potenzielle Mitarbeiter stellen müssen. Um an der
Militärakademie aufgenommen zu werden, musste ich ein sechs Monate dauerndes
Auswahlverfahren absolvieren, in dem jeden Tag Leute ausgeschieden wurden
was allerdings nichts über die Qualität der Auswahl aussagen soll. Für Jack Welch
war: ,,... jedes Gespräch mit einem Menschen, den man kennenlernt, ein
Bewerbungsgespräch."
16
Die folgende Grafik zeigt den Prozess der Auswahl und Ausbildung im Sport:
Abb. 4: Der Prozess der Auswahl und Ausbildung im Sport
Quelle: Hofmann, S. / Schneider, G., 1985, S. 46
16
vgl. Welch, J., 2002, S. 171
- 26 -
1.2.4 Talentförderung
,,Als Talentförderung werden gezielte Maßnahmen zur Entwicklung sportart-
spezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten vor allem bei jungen talentierten Sportlern
bezeichnet."
17
Diese Definition gilt natürlich auch für den nichtsportlichen Bereich, indem man
spezifische Fähigkeiten an Schulen und Universitäten erlernt. Die Probleme der
Talentsuche und förderung gehen fließend ineinander über. Ein Beispiel hierfür
wäre das Konzept des Höchstleistungsalters, wie es oben vorgestellt wurde. Es
verlangt eine Förderung des Talents zum richtigen Zeitpunkt, um dann im richtigen
Alter die Höchstleistung erbringen zu können - also das ideale Trainingsalter zu
erreichen. Vergleichen könnte man dies mit einer Karriereplanung, die bereits im
Kindesalter beginnt. In beiden Fällen lauert die Gefahr einer frühen Spezialisierung
18
,
wie sie im Sport folgendermaßen erkannt wurde:
Das Training und die damit verbundenen Belastungen sind oft zu einseitig und
berücksichtigt nicht die polysportiven Grundausbildungen, die als Basis für die
späteren Belastungen dienen.
Daraus ergibt sich auch die Gefahr einer Überlastung betroffener Systeme, wie
zum Beispiel des Stütz- und Halteapparates oder eine Überbeanspruchung von
Knochen, Knorpeln, Sehnen und Bändern. Eine sogenannte ,,arthromuskuläre
Dysbalance" kann die Folge von einseitiger muskulärer Beanspruchung sein.
Werden verschiedene Muskelgruppen funktionsbedingt nicht beansprucht, kann
es außerdem zu einer Reduzierung der Gelenkamplitude mit einer punktuellen
Überlastung entsprechender Gelenksabschnitte kommen. Alle diese
Auswirkungen haben natürlich langfristige Folgen, und Einfluss auf das weitere
Training und somit auch auf die Leistung.
Monotones Training kann vor allem in jungen Jahren rasch zu einer
psychischen Übersättigung führen. Die Gefahr eines ,,drop-outs" (Aussteigen)
besteht.
17
Röthig, P., 1983, S. 313
18
Weineck, J., 2000, S. 133
- 27 -
Der zweite Punkt findet natürlich keine Anwendung außerhalb des Sports, was
jedoch nicht für die anderen beiden Argumentationen gilt.
Gerade im Hinblick auf unsere Zukunft als Wissensgesellschaft scheint es
notwendiger denn je, eine breite Wissensbasis zu haben. Eine zu frühe disziplinäre
Spezialisierung geht oft auf Kosten einer guten Allgemeinbildung, die als Basis für
ein späteres interdisziplinäres Denken benötigt wird. Die Gefahr des ,,drop-outs"
besteht selbstverständlich überall - nicht nur im Sport. An jeder Universität gibt es
unzählige Studenten, die ihr Studium abbrechen.
Die nachstehende Tabelle aus dem Sport zeigt, dass eine frühzeitige Spezialisierung
gar nicht sinnvoll ist.
54 57,5 Sekunden
170 Sportler
Unter 54 Sek.
43 Sportler
Leistung von
Mark Spitz*
Alter in
Jahren
Leistung Verbesserung Leistung Verbesserung Leistung Verbesserung
10
1:11,6
11
1:07,0
4,6
12
1:04,3
2,7
13
1:01,6
2,7
14 59,6 2,7
1:05,5
15 58,0 1,6
1:01,0 59,3 5,7
16 57,0 2,0 57,5 3,5 55,2 4,1
17 56,4 0,6 56,0 1,5 53,6 0,6
18 55,9 0,5 55,5 0,5 53,0 0,6
19 55,6 0,3 55,0 0,5 52,6 0,4
20 55,4 0,2 54,4 0,4 51,9 0,7
21 55,2 0,2 54,0 0,6 51,4 0,5
22 55,0 0,2 53,8 0,2 51,2 0,2
23
54,9
0,1
Tab. 2: Die altersspezifische Dynamik in der Leistungsentwicklung von Männern über 100 m Freistil
(Mittelwerte)
Quelle: Weineck, J., 2000 S. 134
* ,,Der amerikanische Sportler Mark Spitz gehört zu den erfolgreichsten
Schwimmern der Welt. Er hat allein an der Sommer-Olympiade im Jahr 1972 in
- 28 -
München sieben Goldmedaillen gewonnen. Damit war er erfolgreichster
Teilnehmer dieser Spiele und verdiente sich die Bezeichnung ,,Mark, the shark".
Mark Spitz stellte insgesamt 34 Weltrekorde auf."
19
1.2.5 Überforderung
Das Problem einer Überforderung wird besonders im Sport sehr deutlich sichtbar,
wobei hier der Terminus ,,Übertraining" benützt wird. Jedoch wird im Folgenden
sichtbar, dass die Symptome einer solchen Überforderung durchaus auch im
Arbeitsalltag auftreten können, vor allem, da die Ursache einer Überforderung
sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich liegen kann.
Im Grunde basiert eine Überforderung auf mangelnder Erholung und stellt die
Summe übermäßiger Reize dar, welche sogar zu chronischen
Überforderungssyndromen führen können. Beispiele für solche Reize wären:
berufliche und/oder private Überlastung, zu hartes Training, Schlafmangel, falsche
Ernährung, usw.
Im speziellen Bereich des Sportes können folgende Ursachen gegeben sein:
,,Zu schnelle Steigerung der Trainingsquantität bzw. intensität;
Übermäßig forcierte technische Schulung schwieriger Bewegungsabläufe;
Zu starke Einseitigkeit der Trainingsmethoden und inhalte;
Wettkampfmassierung mit unzureichenden Erholungsintervallen"
20
.
Grundsätzlich gibt es zwei Formen des Übertrainings. Das basedowoide
(sympathikotone) und das addisonoide (parasympathikotone) Übertraining
21
.
Ersteres kennzeichnet vor allem, dass die Erholung nach der Belastung nur
verzögert oder ungenügend erfolgt, die Antriebsfunktion und Erregungsprozesse sind
verstärkt. Eine Diagnose ist relativ leicht zu erstellen, da es eine Vielzahl an
Indikatorsymptomen gibt und sich der Sportler krank fühlt.
19
http://www.rasscass.com/templ/te_bio.php?PID=1375&RID=1
20
Weineck, J., 2000, S. 662
21
Weineck, J., 2000, S. 664
- 29 -
Die zweite Form ist jedoch schwieriger zu erkennen, da sie eher schleichend ist und
unter Ruhebedingungen nicht immer Störungen auftreten. Der Sportler fühlt sich
körperlich schwach und antriebslos. Die erforderliche Energie für Wettkämpfe kann
nicht mobilisiert werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Symptome der zwei Formen des Übertrainings
Basedowoides Übertraining
Addisonoides Übertraining
Leichte Ermüdbarkeit
Erregung
Schlaf gestört
Appetit herabgesetzt
Körpergewichtsabnahme
Neigung zum Schwitzen,
Nachtschweiß, feuchte Hände
Halonierte Augen, Blässe
Neigung zu Kopfschmerzen
Herzklopfen, Herzdruck, Herzstiche
Ruhepuls beschleunigt
Grundumsatz gesteigert
Körpertemperatur leicht erhöht
Ausgeprägter roter Dermographismus
Verzögerte Einstellung der
Herzfrequenz auf Ruhewerte nach
Belastung
Blutdruck uncharakteristisch
Abnorme Hyperpnoe unter Belastung
Überempfindlichkeit gegenüber
Sinnesreizen (besonders akustischer
Art)
Bewegungsablauf wenig koordiniert,
oft überschießend
Reaktionszeit verkürzt, allerdings viele
Fehlreaktionen
Tremor
Erholung verzögert
Innere Unruhe, leichte Erregbarkeit,
Gereiztheit, Depression
Leichte (abnorme) Ermüdbarkeit
Hemmung
Schlaf nicht gestört
Normaler Appetit
Körpergewicht gleichbleibend
Thermoregulation normal
-
klarer Kopf
-
Bradykardie
Grundumsatz normal
Körpertemperatur normal
-
Schnelle Kreislaufberuhigung nach
Belastung
Unter und nach Belastung oft
Erhöhung des diastolischen
Blutdrucks auf > 100 Torr
Keine Atemschwierigkeiten
-
Bewegungsablauf eckig und
ungenügend koordiniert (nur bei
höherer Belastungsintensität)
Reaktionszeit normal oder verlängert
-
Gute bis sehr gute Erholungsfähigkeit
Phlegma, normale Stimmungslage
Tab. 3: Symptome und Zeichen der Erscheinungsformen des Übertrainings
Quelle: Israel, S., 1976, S. 2
- 30 -
Maßnahmen zur Behandlung des Übertrainings
Basedowoides Übertraining
Addisonoides Übertraining
Erhebliche Reduktion des Spezial-
trainings: Grundlagenausdauer, keine
Intensität
In schweren Fällen, Übergang auf
aktive Erholung: Schwimmen,
lustbetonte Spiele, leichte
entspannende Gymnastik
Milieuwechsel (Mittelgebirge)
Leichte Ultraviolettbestrahlung
Leichte Massage, Bäder mit
indifferenten Temperaturen und
Zusätzen
Milde Saunaanwendung
Vollwertige, reichhaltige Ernährung
Basische Kost, eventuell zusätzliche
Polyvitaminpräparate (A,B,C)
Psychotherapie: dämpfend,
entspannend
Reduktion des Trainingsumfanges
Wechseltraining
Intervalltraining mit (wenigen)
hochintensiven Einlagen
Spiele, Gymnastik (Lockerungs-, auch
Schnellkraftübungen)
Eventuell Milieuwechsel (Reizklima,
See)
Licht-, Wetterreize
Durchgreifende Massage
Drastische Wasseranwendung
(Reizguss, CO2-Bäder)
Kurze drastische Saunaanwendung
mit zwischengeschalteten
Kaltwasserapplikationen
Vollwertige Ernährung, säuernd,
vitaminreich, proteinreich
Psychotherapie: aktivierend
Tab. 4: Maßnahmen zur Behandlung des Übertrainings
Quelle: Israel, S., 1976, S. 8
1.2.6 Überforderung im Beruf
Im Berufsleben werden die Symptome der Überforderung auch oft als ,,Burnout", also
Ausgebranntsein, bezeichnet. Es bezieht sich, ebenfalls wie im Sport, sowohl auf
psychische, als auch auf physische Probleme und auch die Symptome können
dementsprechend dieselben sein.
Menschen, die von diesem Problem betroffen sind, haben oft einiges gemeinsam.
Sie alle gehen zu Beginn mit viel Enthusiasmus, Engagement, und Begeisterung an
die Arbeit. Der Job ist das Zentrum des Lebens und der Gedanke, etwas bewegen zu
wollen, ist leitend. Wird jedoch keine Vorsorge getroffen, stellen sich nach einigen
Jahren Symptome ein, wie sie schon oben angeführt wurden. Alle zur Verfügung
stehenden Energien fließen in die Arbeit. An Sport oder gesunde und sinnvolle
Ernährung, welche über lange Zeiträume Leistung erhalten und fördern können, wird
- 31 -
nicht gedacht. Dies führt zwangsläufig zum Zusammenbruch. Anders als im rein
sportlichen Bereich verbergen sich auch noch andere Gefahren im Berufsleben. Das
Privatleben, sprich die Familie, leidet. Psychische Probleme wie Depressionen, Panik
und Angst können auftreten, was Betroffene oftmals auch zu Alkoholkonsum oder
anderen Suchtmitteln verleitet. Häufig ist das Ende ein wohlbekanntes - der
Herzinfarkt!
Fliegl nennt vor allem folgende Faktoren, welche die Überforderung im Berufsleben
beeinflussen:
,,Die raren Arbeitsplätze. Die Konkurrenz um neue Arbeitsplätze oder
Beförderungen im Betrieb ist groß. Daher entsteht für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der Druck, die Leistungsfähigkeit ständig unter Beweis stellen zu
müssen.
Zeitlich befristete Arbeitsverträge führen ebenfalls zu einem Druck, sich dem
Betrieb als effektiver, wertvoller und engagierter Mitarbeiter zu präsentieren.
Zudem belasten Zukunftssorgen, "was wird, wenn mein Vertrag nicht verlängert
wird?"
Geringe Bezahlung, zu hohe Anforderungen, mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten,
wenig Unterstützung bei anfallenden Problemen, schlechte Betriebsorganisation,
mangelnde Anerkennung durch Vorgesetzte oder durch Kollegen, wenig
Möglichkeiten zur Einflussnahme und zu viele organisatorische Tätigkeiten neben
der "eigentlichen" Arbeit tragen ebenfalls zur Belastung am Arbeitsplatz bei.
Durch neue Kommunikationsmöglichkeiten beschleunigen sich berufliche Abläufe
enorm, ohne dass Entspannungs- und Ausgleichmöglichkeiten eingeplant
werden. Man sieht sich gezwungen (ob es wirklich so sein muss, sei
dahingestellt), immer schneller zu reagieren. Hat es früher drei bis vier Tage
gedauert, bis Informationen über die Post ausgetauscht waren, wechseln Emails
und Faxe in Sekundenschnelle von Sender zu Empfänger und zurück. Durch das
Handy ist man immer und überall erreichbar, "natürliche" Pausen, die es früher
auf dem Weg von einem Termin zum nächsten gab, oder die ungestörte
Mittagspause, verbunden mit einem entspannenden und ablenkenden
Spaziergang, sind kaum mehr vorhanden.
Neue Aufgaben und neue berufliche Herausforderungen, für die nicht genügend
Ausbildung und Kompetenzen vorhanden sind, führen ebenfalls zu hohem
- 32 -
beruflichem Stress. Hier seien Lehrerinnen und Lehrer stellvertretend genannt,
die sich durch manche schulische Herausforderungen (z.B. Gewalt, Drogen,
Mobbing, Lehrermangel) überfordert fühlen.
Schichtarbeit, Nachtdienste, Vertretungen, zu wenig Fachkräfte für die
Anforderungen des Arbeitsplatzes erhöhen die Belastungen für den Einzelnen.
Herausgehoben werden soll beispielhaft ein Bereich, in dem sich dies besonders
gravierend zeigt: In der medizinischen Versorgung, vor allem im Krankenhaus.
Ärzten und Pflegepersonal werden unter Ausnutzung ihrer abhängigen Position
immer mehr Dienste auferlegt, die Pausen- und Erholungszeiten sind viel zu kurz,
der Job ist fast nur noch Belastung, das Gefühl: Überlastung. Dies gilt natürlich
gleichermaßen für viele Arbeitsfelder, in denen Schicht- und Nachtarbeit sowie
ungenügende Vertretungspläne zum beruflichen Alltag gehören, wo die
Anordnung von Überstunden (noch nie gab es so viele wie zur Zeit) der
Einstellung neuer Kräfte vorgezogen werden.
22
Mobbing.
Eines der sichersten Warnsignale der Überforderung ist, sich ständig im Stress zu
fühlen. Man hat für nichts mehr Zeit, schon gar nicht für Dinge, die man selber gern
machen möchte. Um die Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum aufrecht zu
erhalten, ist es also notwendig, Ausgleiche zu schaffen siehe Zeit-Leistungs-
Modell.
1.2.6.1 Maßnahmen zur Senkung der Überforderung im Beruf
Die Interventionen, welche das Risiko eines ,,Burnouts" am Arbeitsplatz verringern
sollen, sind prinzipiell auf zwei Ebenen anzusetzen. Auf der Individual- und auf der
Organisationsebene. Dies bedeutet, dass sowohl die gefährdete oder betroffene
Person selbst, als auch die Unternehmen Maßnahmen zur Senkung einer
Überforderung im Berufsleben treffen sollen.
Im Rahmen der individuellen Maßnahmen unterscheidet man zwischen folgenden
Techniken:
22
http://www.wdr.de/radio/wdr2/westzeit/psychologie010314.html
- 33 -
Pädagogische Techniken:
Durch die Aneignung von Wissen und Informationen über die Gefahr eines
Burnouts wird versucht, sich besser auf diese mögliche Situation vorzubereiten,
und mit ihr richtig umzugehen.
Körperorientierte Techniken:
Dies betrifft alle Maßnahmen, die der Reduzierung des körperlich empfundenen
Stresszustandes dienen. Prinzipiell sind hier alle Sportarten einsetzbar. Eine
besondere Bedeutung kommt Sportarten wie Laufen oder Schwimmen zu, da
diese eine ganzheitliche Verbesserung des allgemeinen physischen und
psychischen Zustandes herbeiführen.
Kognitiv-Behaviorale Techniken:
Mit Hilfe von psychologischen Therapieformen wird versucht, falsche Gedanken
und Gefühle zu beeinflussen bzw. diese zu verändern. Zu solchen Maßnahmen
zählen das Erlernen richtiger Zielsetzung, Prioritätenplanung, positive
Selbstverstärkung usw.
Gruppenbezogene Techniken:
Diese zielen auf die soziale Unterstützung aller Gruppenmitglieder ab.
Gegenseitige Hilfe und Anteilnahme, sollen die Gefahr eines Burnouts verringern.
Ebenso wichtig wie die individuellen Maßnahmen sind auch die Maßnahmen auf
unternehmerischer Seite.
Von den Burnout-Forschern werden diesbezüglich vielfältige Interventionsvorschläge
unterbreitet, hier einige Beispiele:
Schaffung der Möglichkeit eines Sabbatjahres bzw. Sabbatmonate (unbezahlter
Urlaub);
Teambesprechungen: Zeit für gegenseitigen Austausch sollte gegeben sein,
sodass sich Teammitglieder gegenseitig unterstützen können;
Abbau von Zeitdruck;
Verlagerung der Verantwortung in Teams;
- 34 -
Vermeidung von Verantwortungsdiffusion durch Festlegung von Arbeitsinhalten,
Zielen und Verantwortlichen;
Festlegung von realistischen und konkreten Zielen, die eine Effizienzkontrolle,
Feedback und die damit verbunden Erfolgserlebnisse erst möglich machen;
Erweiterung der Handlungsspielräume.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der burnout-Syndrome von der unternehmerischen
Seite sind ebenso wichtig wie die Maßnahmen der betroffenen Personen selbst.
Diese sollten im Rahmen der Arbeitszeit und auf Kosten des Unternehmens
abgehalten werden, um eine zusätzliche Belastung der Mitarbeiter zu vermeiden.
Zudem sind Maßnahmen zur Förderung der Gruppendynamik und zur Unterstützung
des Kollektivs wie gemeinsame Veranstaltungen aller Art (Firmenausflüge, kulturelle
Veranstaltungen usw.) empfehlenswert.
- 35 -
1.3 Körperliche Fitness
Im Spitzensport ist die körperliche Fitness das Kapital des Sportlers. Doch auch für
alle anderen Menschen ist körperliche Betätigung als Gesundheitsprävention absolut
essenziell. Die Grundvoraussetzung, um dauerhaft leistungsfähig zu sein, ist somit
die körperliche Fitness.
1.3.1 Sportliche Leistungsfähigkeit
Der Begriff der sportlichen Leistungsfähigkeit ist mit dem der körperlichen Fitness,
wie sie für den Normalverbraucher notwendig ist, nicht zu vergleichen, da er in seiner
Charakteristik wesentlich komplexer aufgebaut ist. Die sportliche Leistungsfähigkeit
setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen, die alle in ein komplexes,
harmonisches Training implementiert werden müssen, da nur die Entwicklung aller
Komponenten die Erreichung einer individuellen Höchstleistung bewirken kann.
Abb. 5: Vereinfachtes Modell der Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit
Quelle: Weineck, J., 2000, S. 21
- 36 -
Das Ziel der Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit wird mit Hilfe von
Trainingszielen, Trainingsinhalten, Trainingsmitteln und Trainingsmethoden verwirk-
licht.
Trainingsziele, werden in drei Gruppen unterteilt
23
:
Psychomotorische Lernziele: diese bestehen aus den konditionellen
Leistungsfaktoren wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit usw., und den koordinativen
Fähigkeiten und Techniken des motorischen Lernprozesses.
Kognitive Lernziele: haben die Entwicklung der technischen und taktischen
Fähigkeiten zum Ziel sowie allgemeines Basiswissen über die Optimierung des
Trainings.
Affektive Lernziele: sind Ziele, die in einer Wechselbeziehung zu den physischen
Leistungsfaktoren stehen, zum Beispiel: Willensstärke, Selbstüberwindung,
Selbstbeherrschung, Durchsetzungsvermögen usw.
Trainingsinhalte sind die konkreten Übungen, welche zum Erreichen des Zieles
durchgeführt werden. Es wird zwischen allgemeinentwickelnde Übungen, Spezial-
übungen und Wettkampfübungen unterschieden. Diese drei Formen bauen
aufeinander auf, so sind die allgemeinentwickelnden Übungen die Basis für die
Spezialübungen und dienen der Verbesserung der psychophysischen Leistungs-
faktoren und der technisch-taktischen Fähigkeiten. Die Spezialübungen sind auf die
jeweilige Disziplin abgestimmt und in den Wettkampfübungen wird die Gesamtheit
der Leistungskomponenten unter wettkampfnahen Bedingungen trainiert.
Trainingsmittel umfassen alle Mittel und Maßnahmen, die den Ablauf des
Trainingsprozesses unterstützen. Dies sind sowohl Sportgeräte als auch alle
organisatorischen und informativen Mittel.
Trainingsmethoden sind in der Sportpraxis entwickelte planmäßige Verfahren zur
Verwirklichung gesetzter Trainingsziele.
Um die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern, müssen verschiedene Reize ge-
setzt werden. Man unterscheidet folgende qualitative und quantitative Belastungen:
23
vg. Weineck, J., 2000, S 22
- 37 -
Reizintensität: Stärke des einzelnen Reizes
Reizdichte: zeitliches Verhältnis von Belastungs- und Erholungsphasen
Reizdauer: Einwirkungsdauer eines einzelnen Reizes bzw. einer Reizserie
Reizumfang: Dauer und Zahl der Reize pro Trainingseinheit
Trainingshäufigkeit: Zahl der Trainingseinheiten pro Tag bzw. Woche
Kraftbelastung
Schnelligkeitsbelastung Ausdauerbelastung
Belastungsumfang
Last [kg] in einer
Trainingseinheit mit
einer bestimmten
Übungsform
Häufigkeiten
(Wiederholungen)
bestimmter
Übungsformen
Streckenlänge [m],
deren Wiederholungen
und Serien in einer
Trainingseinheit mit
einer bestimmten
Übungsform
Häufigkeit bestimmter
Übungsformen
Streckenlänge [m],
deren Wieder-
holungen und Serien
in einer Trainings-
einheit mit einer be-
stimmten Übungs-
form
Trainingsdauer
Belastungsintensi-
tät, wird bestimmt
durch
Größe des Impulses
[N/s] einer Übungs-
form
Die Last [kg]
Prozent der konzen-
trischen Maximalkraft
Prozent der isome-
trischen Maximalkraft
Impulsqualität einer
Übungsform
Prozent, bezogen auf
die höchsten Schnel-
ligkeitswerte bei einer
best. Übungsform
Bewegungsgeschwin-
digkeit [m/s]
Impulsqualität einer
bestimmten Übungs-
form (maximal, sub-
maximal, mittel)
Bewegungsfrequenz
innerhalb einer
vorgegebenen Zeit
Die Bewegungs-
geschwindigkeit
[m/s; km/h]
Die Herzfrequenz,
die auf einer Strecke
eingehalten wird
Prozent von einer
bestimmten Leistung
auf einer Strecke
oder von einem
anderen Wert
Leistung bei einer
Übungsform [Watt]
Art der Energie-
bereitstellung
[maximal / Laktat]
Prozent der maxi-
malen O
2
-Aufnahme
Belastungsdauer,
wird bestimmt
durch
Dauer [s, min] einer
Übungsfolge mit oder
ohne festgelegter
Übungsfrequenz
Zeit [s] für das Absol-
vieren einer Strecke
Die Zeit [s] für eine
Anzahl von Bewe-
gungswiederholungen
Zeit [s; min; h] für
das Absolvieren
einer Strecke
Belastungsdichte,
wird bestimmt
durch
Pausenzeit [s; min]
zwischen Wieder-
holungen, Serien
Pausenzeit [s; min]
zwischen Teilstrecken,
Wiederholungen,
Serien
Bestimmtes Verhältnis
zwischen Belastungs-
dauer und Pausenzeit
(z.B. 1:3)
Pausenzeit [s; min]
zwischen Teil-
strecken, Wieder-
holungen, Serien
Bestimmtes Verhält-
nis zwischen Be-
lastungsdauer und
Pausenzeit (z.B. 1:3)
Tab. 5: Belastungskomponenten und ihre Operationalisierung (Quantifizierung)
Quelle: Steinhöfer, D., 1993, S. 45
- 38 -
Die Grundfähigkeiten, welche für die Ausübung eines Sports notwendig sind, werden
grob in konditionelle und koordinative Fähigkeiten unterteilt.
Der Begriff Kondition hat im Spitzensport eine umfangreichere, und komplexere
Bedeutung, als er dies im täglichen Sprachgebrauch hat, wo wir meist, wenn wir von
Kondition sprechen, ,,Ausdauer" meinen. Der Begriff ,,Ausdauer" wird im Sport jedoch
für den allgemeinen psycho-physischen Ermüdungswiderstand des Sportlers
verwendet.
So setzt sich die physische Kondition eines Sportlers im Groben aus folgenden
Komponenten zusammen:
Abb. 6: Reduziertes Strukturmodell der Komponenten der Kondition des Sportlers
Quelle: Weineck, J., 2000, S. 139
- 39 -
Wie komplex dieser Begriff jedoch tatsächlich ist, zeigt dieses Modell am Beispiel der
Kondition eines Fußballspielers:
Abb. 7: Erweitertes Strukturmodell zur Kondition des Fußballspielers
Quelle: Weineck, J., 2000, S. 138
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832471811
- ISBN (Paperback)
- 9783838671819
- DOI
- 10.3239/9783832471811
- Dateigröße
- 3.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule des bfi Wien GmbH – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- management sport führung motivation erfolg
- Produktsicherheit
- Diplom.de