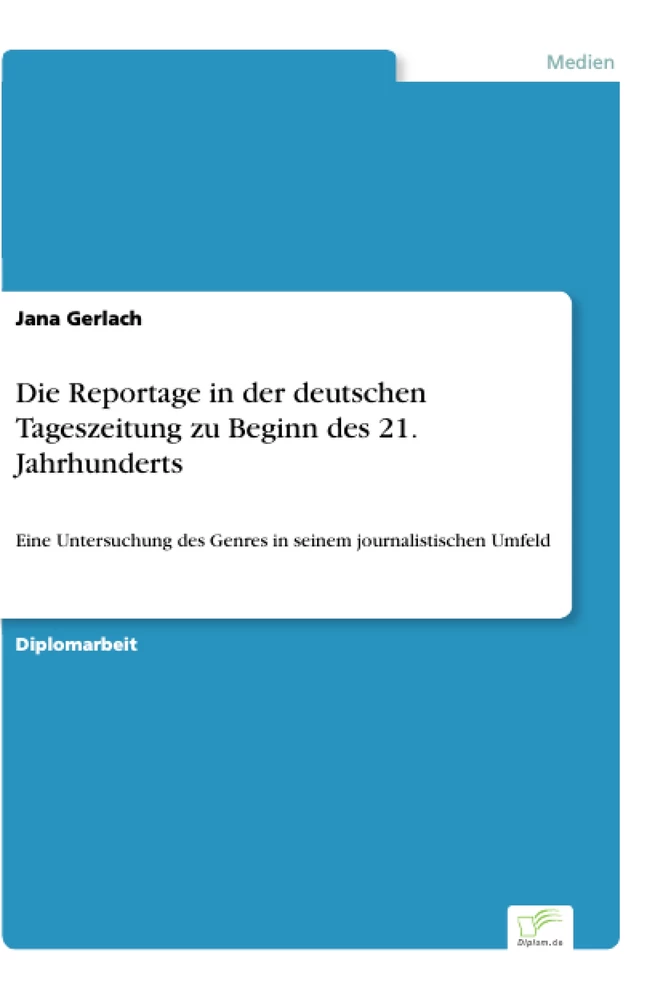Die Reportage in der deutschen Tageszeitung zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Eine Untersuchung des Genres in seinem journalistischen Umfeld
©2003
Diplomarbeit
134 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die Reportage wird als Königsform des Journalismus bezeichnet. Ihr zu Ehren werden Preise verliehen, besondere Agenturdienste angeboten und ganze Zeitungsseiten eingerichtet. Trotzdem hat es den Anschein, als werde das Genre stiefmütterlich behandelt. Der Anlass dieser Arbeit war der Eindruck der Verfasserin, dass aus Rezipientenperspektive die Reportage in Zeitungen immer seltener zu finden ist. Selbst wo Reportage drauf steht, ist nicht immer Reportage drin. Auch Experten auf dem Gebiet der Medien haben die Vernachlässigung der Darstellungsform moniert. Dieser Eindruck wird zudem durch die praktische Perspektive gestärkt: Im Sommersemester 2000 stand für das damalige vierte Semester des Studienganges Fachjournalistik an der Hochschule Bremen die Reportage auf dem Lehrplan. Die Lehrbeauftragte hatte Mühe, für die in der Theorie erklärte Form praktische Beispiele zu finden. So wurde eine Reportage auf Grund ihres Aufbaus als Beispiel ausgewählt, eine andere auf Grund ihres Einstiegs. Ein Beispiel für eine durchgehend im Aufbau und Einstieg - gelungene Reportage gab es nicht. Dazu bemerkt Schreiber (1997: 245): So gut wie jeder Journalist geht um mit der Reportage, so gut wie keiner aber kann sagen, was das ist. Solche Praxis ruiniert auf die Dauer jede verbindliche Form. Die Relevanz des Themas liegt also in der berufsbezogenen Perspektive (vgl. Pätzold 1999: 145).
Die Ursache für einen möglichen Formverlust allerdings in der Kompetenz von Journalisten zu suchen, reduziert den Untersuchungsbereich auf nur einen Aspekt des Kontextes der Reportage (vgl. 6.5). Ebenso müssen veränderte Gewohnheiten, Interessen und Fähigkeiten der Rezipienten berücksichtigt werden (vgl. 6.4).
Gegenstand der Arbeit ist die Reportage in der deutschen Tageszeitung. Im Bereich des Interesses stehen Reportagen aus Rubriken wie beispielsweise Politik, Lokales, Wirtschaft oder Reise. Auch Tageszeitungen aus dem Boulevardjournalismus fallen im Gegensatz zu Abonnementtageszeitungen, die lokal, regional oder national verbreitet sind, nicht in den Untersuchungsbereich dieser Arbeit.
Eine weitere Ursache für einen möglichen Formverlust kann die schwierige wirtschaftliche Lage auf dem Tageszeitungsmarkt sein (vgl. 6.3). Sie hatte und hat Einsparungen sowie Umstrukturierungen in den Redaktionen zur Folge (vgl. 6.6). Demgegenüber stehen die verhältnismäßig hohen Produktionskosten der Reportage. Nicht zuletzt wandeln sich die Aufgabenfelder des […]
Die Reportage wird als Königsform des Journalismus bezeichnet. Ihr zu Ehren werden Preise verliehen, besondere Agenturdienste angeboten und ganze Zeitungsseiten eingerichtet. Trotzdem hat es den Anschein, als werde das Genre stiefmütterlich behandelt. Der Anlass dieser Arbeit war der Eindruck der Verfasserin, dass aus Rezipientenperspektive die Reportage in Zeitungen immer seltener zu finden ist. Selbst wo Reportage drauf steht, ist nicht immer Reportage drin. Auch Experten auf dem Gebiet der Medien haben die Vernachlässigung der Darstellungsform moniert. Dieser Eindruck wird zudem durch die praktische Perspektive gestärkt: Im Sommersemester 2000 stand für das damalige vierte Semester des Studienganges Fachjournalistik an der Hochschule Bremen die Reportage auf dem Lehrplan. Die Lehrbeauftragte hatte Mühe, für die in der Theorie erklärte Form praktische Beispiele zu finden. So wurde eine Reportage auf Grund ihres Aufbaus als Beispiel ausgewählt, eine andere auf Grund ihres Einstiegs. Ein Beispiel für eine durchgehend im Aufbau und Einstieg - gelungene Reportage gab es nicht. Dazu bemerkt Schreiber (1997: 245): So gut wie jeder Journalist geht um mit der Reportage, so gut wie keiner aber kann sagen, was das ist. Solche Praxis ruiniert auf die Dauer jede verbindliche Form. Die Relevanz des Themas liegt also in der berufsbezogenen Perspektive (vgl. Pätzold 1999: 145).
Die Ursache für einen möglichen Formverlust allerdings in der Kompetenz von Journalisten zu suchen, reduziert den Untersuchungsbereich auf nur einen Aspekt des Kontextes der Reportage (vgl. 6.5). Ebenso müssen veränderte Gewohnheiten, Interessen und Fähigkeiten der Rezipienten berücksichtigt werden (vgl. 6.4).
Gegenstand der Arbeit ist die Reportage in der deutschen Tageszeitung. Im Bereich des Interesses stehen Reportagen aus Rubriken wie beispielsweise Politik, Lokales, Wirtschaft oder Reise. Auch Tageszeitungen aus dem Boulevardjournalismus fallen im Gegensatz zu Abonnementtageszeitungen, die lokal, regional oder national verbreitet sind, nicht in den Untersuchungsbereich dieser Arbeit.
Eine weitere Ursache für einen möglichen Formverlust kann die schwierige wirtschaftliche Lage auf dem Tageszeitungsmarkt sein (vgl. 6.3). Sie hatte und hat Einsparungen sowie Umstrukturierungen in den Redaktionen zur Folge (vgl. 6.6). Demgegenüber stehen die verhältnismäßig hohen Produktionskosten der Reportage. Nicht zuletzt wandeln sich die Aufgabenfelder des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6968
Gerlach, Jana: Die Reportage in der deutschen Tageszeitung zu Beginn des 21.
Jahrhunderts - Eine Untersuchung des Genres in seinem journalistischen Umfeld
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Fachhochschule Südwestfalen, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1
EINLEITUNG
1
2
HISTORISCHER HINTERGRUND DER REPORTAGE
3
2.1
Wurzeln der Reportage
4
2.2
Entwicklungen der Reportage
7
3
BESTIMMUNG DER REPORTAGE IN DER LITERATUR
9
4
BESTIMMUNG DER REPORTAGE IN DIESER ARBEIT
13
4.1
Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlage
13
4.2
Wahl des funktionalen Ansatzes
17
4.3
Funktion und Leistung der journalistischen Darstellungsformen
19
4.4
Funktion und Leistung der Reportage
22
4.5
Form der Reportage
25
4.5.1
Inhaltliche Merkmale
26
4.5.2
Formale Merkmale
28
4.5.3
Merkmale des Aufbaus
30
4.5.4
Thematische Merkmale
33
4.5.5
Sprachliche Merkmale
34
4.5.6
Merkmale der Arbeitsweise
38
5
ABGRENZUNG DER REPORTAGE GEGENÜBER DEM FEATURE
39
5.1
Unterschiede in Funktion und Leistung
40
5.2
Inhaltliche Unterschiede
40
5.3
Formale Unterschiede
42
5.4
Unterschiede des Aufbaus
43
5.5
Thematische Unterschiede
43
5.6
Sprachliche Unterschiede
44
5.7
Unterschiede der Arbeitsweise
44
6
BEDINGUNGEN DER REPORTAGE IN DER DEUTSCHEN TAGESZEITUNG
45
6.1
Normenbasis der Tageszeitung
46
6.2
Tageszeitung als Medium
51
6.3
Markt der Tageszeitung
54
6.4
Leser von Tageszeitung
63
6.5
Journalisten der Tageszeitung
69
6.6
Redaktionsorganisation von Tageszeitung
72
6.7
Fazit
74
7
INHALTSANALYTISCHE UNTERSUCHUNG DER REPORTAGE IN DEUTSCHEN
TAGESZEITUNGEN
82
7.1
Inhaltsanalyse als Untersuchungsmethode
82
7.2
Grundlagen der Untersuchung
84
7.2.1
Vorgehen der Untersuchung
85
7.2.2
Untersuchungsmaterial und Analysezeitraum
86
7.3
Kategoriensystem
88
7.3.1
Kategorien als Erhebungsinstrument
88
7.3.2
Kategorienschema 89
7.4
Ergebnis der inhaltsanalytischen Untersuchung der Reportage in Tageszeitungen
90
7.4.1
Ausschlusskriterien der als Reportage gekennzeichneten Artikel
91
7.4.2
Die Seite drei der nationalen Zeitungen
95
7.4.3
Merkmale der Formen in regionalen und lokalen Tageszeitungen
96
7.4.4
Zusammenfassende Betrachtung
98
8
AUSBLICK
99
LITERATUR:
103
ANHANG
115
Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1... 91
Tabelle 2... 126
Die Reportahsche
Einmal hieß alles, was da kreucht und fleucht, ,,nervös", dann ,,fin de siècle", dann ,,Ü-
bermensch", dann hatten sie es mit den ,,Hemmungen" und heute haben sie es mit der
Reportahsche, als welches Wort man es immer so schreiben sollte. Lieber Egon Erwin
Kisch, was haben Sie da angerichtet! Sie sind wenigstens ein Reporter und ein sehr gu-
ter dazu aber was nennt sich nur heute alles ,,Reportage". Es ist völlig lächerlich.
Es gibt von allen Arten.
Es gibt ,,soziale Reportagen" und einer trägt eine ,,Reportage" vor, und Paul Fechter,
der Klopf-Fechter der ,,Deutschen Allgemeinen" macht ,,Versuche einer Rollen-
Reportage", die denn auch so ausgefallen sind, daß man sich verwundert fragt, wie einer
das schreiben kann, ohne dabei einzuschlafen. Dafür tuts denn der Leser. Und dann gibt
es ,,Reportagen-Romane", und das sind die allerschlimmsten.
Der richtige ,,Reportage-Roman" ist im Präsens geschrieben und so lang wie ein mittel-
kräftiger Bandwurm. Der romancierende Reporter nimmt sin ein Milljöh vor, und das
bearbeitet er. Das kann man nun endlos variieren, aber es ist immer dasselbe Buch.
Nicht die Spur einer Vertiefung, nichts, was man nicht schon wüßte, bevor man das
Buch angeblättert hat, keine Bewegung, keine Farbe nichts. Aber Reportage. Was
einen höchst mäßigen Essay abgäbe, das gibt noch lange keinen Roman. Wie überhaupt
bei uns jede Geschichte einen ,,Roman" genannt wird die Kerle sind ja größen-
wahnsinnig. ,,Krieg und Frieden" ist ein Roman. Das da sind keine.
Sie kommen sich so wirklichkeitsnah vor, die Affen und dabei haben sie nichts repor-
tiert, wenn sie nach Hause kommen. Nur ein paar Notizen, die sie auswalzen. Reportah-
sche ... Reportahsche ...
Auf dieses Wort gibt es einen Reim: Deshalb schreibe ich es so. Vor dem Kriege hat
einmal die Kaffee-Firma Tengelmann ein Preisausschreiben in die Zeitung gesetzt; sie
wollte ein kurzes Gedicht für ihre Reklame haben: die Firma sollte darin genannt sein,
die Vorzüglichkeit ihrer Produkte, ihre Tee- und Kaffeeplantagen, und das alles in ge-
fälliger, gereimter Form.
Der große Schauspieler Victor Arnold gewann zwar den Preis nicht aber er hatte einen
der schönsten Verse gefunden. Und der hieß so:
Mein lieber guter Tengelmann!
Was geht denn mich Dein Kaffee an
Und Deine Teeplantage Ach ...!
Na, dann reportiert man.
(Kurt Tucholsky 1931: 122)
Seite - 1 -
1 Einleitung
Die Reportage wird als ,,Königsform" des Journalismus bezeichnet. Ihr zu Ehren wer-
den Preise verliehen, besondere Agenturdienste
1
angeboten und ganze Zeitungsseiten
eingerichtet. Trotzdem hat es den Anschein, als werde das Genre stiefmütterlich behan-
delt. Der Anlass dieser Arbeit war der Eindruck der Verfasserin, dass aus Rezipienten-
perspektive die Reportage in Zeitungen immer seltener zu finden ist. Selbst wo Repor-
tage drauf steht, ist nicht immer Reportage drin. Auch Experten
2
auf dem Gebiet der
Medien haben die Vernachlässigung der Darstellungsform moniert. Dieser Eindruck
wird zudem durch die praktische Perspektive gestärkt: Im Sommersemester 2000 stand
für das damalige vierte Semester des Studienganges Fachjournalistik an der Hochschule
Bremen die Reportage auf dem Lehrplan. Die Lehrbeauftragte hatte Mühe, für die in der
Theorie erklärte Form praktische Beispiele zu finden. So wurde eine Reportage auf
Grund ihres Aufbaus als Beispiel ausgewählt, eine andere auf Grund ihres Einstiegs.
Ein Beispiel für eine durchgehend im Aufbau und Einstieg - gelungene Reportage gab
es nicht. Im Praktikum bei der ,,Frankfurter Rundschau" wurde die Verfasserin dieser
Arbeit mit einem halben Tag Zeit für eine Reportage beauftragt. Da die Arbeitsanwei-
sung unklar war, holte die Verfasserin die Meinung von drei Redakteuren ein sie ga-
ben drei verschiedene Antworten zur Anforderung an eine Reportage. Dazu bemerkt
Schreiber (1997: 245): ,,So gut wie jeder Journalist geht um mit der Reportage, so gut
wie keiner aber kann sagen, was das ist. Solche Praxis ruiniert auf die Dauer jede ver-
bindliche Form." Die Relevanz des Themas liegt also in der berufsbezogenen Perspek-
tive (vgl. Pätzold 1999: 145).
Die Ursache für einen möglichen Formverlust allerdings in der Kompetenz von Journa-
listen zu suchen, reduziert den Untersuchungsbereich auf nur einen Aspekt des Kontex-
tes der Reportage (vgl. 6.5). Ebenso müssen veränderte Gewohnheiten, Interessen und
Fähigkeiten der Rezipienten berücksichtigt werden (vgl. 6.4).
Gegenstand der Arbeit ist die Reportage in der deutschen Tageszeitung. Reportagen in
anderen Medien, wie beispielsweise Radio oder Fernsehen werden außen vor gelassen.
Sowohl die Rubrik ,,Sport" als auch die des ,,Feuilletons" haben eine eigene Praxis in
der Anwendung und sprachlichen Umsetzung der Darstellungsformen. Sie bieten eben-
1
Die Deutsche Presseagentur (dpa) mit Zentrale in Hamburg unterhält einen eigenen Reportagedienst.
Angeboten werden Reportagen von Korrespondenten in Deutschland und aller Welt.
2
Wie etwa Rühl (1980), Riehl-Heyse (1980), Weischenberg (2002) und Schreiber (1997), um nur einige
zu nennen.
Seite - 2 -
so wie die Gerichtsreportagen Material für jeweils eigene Untersuchungen und werden
aus diesem Grund im Folgenden nicht behandelt. Statt dessen sind Reportagen aus Rub-
riken wie beispielsweise Politik, Lokales, Wirtschaft, Reise oder Wissenschaft im Be-
reich des Interesses. Aus dem genannten Grund fallen auch Tageszeitungen aus dem
Boulevardjournalismus
3
im Gegensatz zu Abonnementtageszeitungen, die lokal, regio-
nal oder national verbreitet sind, nicht in den Untersuchungsbereich dieser Arbeit.
Eine weitere Ursache für einen möglichen Formverlust kann die schwierige wirtschaft-
liche Lage auf dem Tageszeitungsmarkt sein (vgl. 6.3). Sie hatte und hat Einsparungen
sowie Umstrukturierungen in den Redaktionen zur Folge (vgl. 6.6). Demgegenüber ste-
hen die verhältnismäßig hohen Produktionskosten der Reportage. Nicht zuletzt wandeln
sich die Aufgabenfelder des Mediums Zeitung (vgl. 6.2). Dies wirkt sich auf den Ein-
satz der Reportage aus.
Diese Bereiche und ihre Veränderungen stehen vor dem Hintergrund einer sich wan-
delnden normativen Basis von Medien in Deutschland (vgl. 6.1). Vor allem gesell-
schaftliche Entwicklungen tragen zu diesen Veränderungen bei.
Das Umfeld der Reportage entspricht dem der journalistischen Kommunikation in Ta-
geszeitungen insgesamt. Denn das Genre ist Teil dieser Kommunikation, indem es als
Darstellungsform eine Vermittlungsfunktion übernimmt.
In dieser Arbeit wird angenommen, dass die Funktion der Reportage ihre Form be-
stimmt. Die These des vorliegenden Beitrages lautet: Die journalistische Darstellungs-
form der Reportage hat in der deutschen Tageszeitung zu Beginn des 21. Jahrhunderts
ihre Vermittlungsfunktion verloren. Der Funktionsverlust führt desweiteren zur Auflö-
sung der Form.
Ziel der Arbeit ist es zunächst, die Hypothese zu belegen, dass die Funktion der Repor-
tage ihre Form bestimmt. Auf diese Annahme bezogen zeigt ein Überblick über den
historischen Hintergrund des Genres Wurzeln und Entwicklungen auf (vgl. 2). Denn die
Darstellungsform ist durch ihre Tradition geprägt. In einem zweiten Schritt werden we-
sentliche Wege, sich in der Literatur der Reportage zu nähern, dargestellt (vgl. 3). Im
Folgenden wird die Wahl des funktionalen Ansatzes in dieser Arbeit, der sich von den
vorgestellten Methoden zur Bestimmung der Reportage unterscheidet, erläutert und be-
gründet (vgl. 4.1, 4.2). Die Bestimmung von Funktion, Leistung und Form der Reporta-
ge erfolgt innerhalb der journalistischen Kommunikation. Aus diesem Grund werden
erst Funktion und Leistung der Darstellungsformen insgesamt (vgl. 4.3) und dann die
3
Der Meinung Burgers (1990: 346) zufolge ist Boulevardjournalismus für Reportagen nicht geeignet.
Seite - 3 -
speziellen der Reportage dargelegt (vgl. 4.4). Im Anschluss wird ein idealtypisches Mo-
dell der Reportage erläutert (vgl. 4.5). Hierbei werden die Bereiche Inhalt, formale
Merkmale, Aufbau, Thema, Sprache und Arbeitsweise unterschieden (vgl. Haller 1997).
Zur Abgrenzung wird der Reportage das Feature gegenübergestellt (vgl. 5). Die Form
wurde ausgewählt, da sie der Reportage verwandt ist. In der Praxis wird teilweise zwi-
schen den beiden Formen nicht unterschieden (vgl. Reumann 1999: 105).
Das Vorgehen ist hier ebenso wie die Prüfung eines möglichen Funktionsverlustes der
Darstellungsform theoriegeleitet. Nachdem ein idealtypisches Modell der Reportage
innerhalb der journalistischen Kommunikation bestimmt wurde, wird die These des
Funktionsverlustes anhand der einzelnen Bereiche ihres Umfeldes untersucht (vgl. 6).
Dadurch soll ein Funktionsverlust entweder bestätigt oder widerlegt werden (vgl. 6.7).
Ein möglicher Formverlust soll durch eine Inhaltsanalyse geprüft werden (vgl. 7). Zu
diesem Zweck werden jeweils zwei Ausgaben von 15 deutschen Tageszeitungen auf die
Form der Reportage hin untersucht. Das erläuterte idealtypische Modell der Reportage
dient hierbei als Maßstab. Zu prüfen ist zunächst generell der Formverlust. Desweiteren
werden mögliche Tendenzen der Veränderung der Form untersucht. Eine Annahme ist,
dass das Feature als verwandte Form der Reportage öfter in Zeitungen zu lesen ist. Eine
andere Möglichkeit ist, dass nur noch einzelne Elemente der Reportage verwendet wer-
den, jedoch nicht mehr die ganze Form des Genres. In diesem Fall hätte sich die Repor-
tage von der ,,Königsform" zu einem ,,Kessel Buntes"
4
gewandelt. Auf der Summe der
Ergebnisse dieser Arbeit basierend, wird schließlich ein Ausblick auf die Zukunft der
Reportage gegeben (vgl.8).
2 Historischer Hintergrund der Reportage
Im folgenden Kapitel wird ein kurzer Überblick des historischen Hintergrunds der Re-
portage dargestellt. Denn sowohl die Wurzeln der Darstellungsform, ihre Vorläufer und
ihre Entwicklungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts prägen die Funktion und somit
auch die Form der Reportage in diesem Jahrhundert.
4
Der Ausdruck ,,Kessel Buntes" ist aus der jüngeren Vergangenheit als Titel einer Unterhaltungssendung
des ehemaligen DDR-Fernsehens bekannt. Ursprünglich stammt der Begriff aus einer Zeit, wo die Wä-
sche noch per Hand gewaschen wurde: In einem Kessel wurde weiße Wäsche gesammelt und der Rest
kam in den ,,Kessel Buntes" , wo alle Farben zusammen gewaschen wurden.
Seite - 4 -
2.1 Wurzeln der Reportage
Die Reportage steht in der Tradition der alten literarischen Kommunikationsform des
Erzählens (vgl. Haller 1997: 17).
Sowohl Augenzeugenberichte, beispielsweise die von Plinius des Jüngeren
5
, als auch
Reiseberichte, etwa die des griechischen Historikers Herodot
6
, werden in dieser Arbeit
als Wurzeln der Reportage betrachtet (vgl. Haller 1997: 18). Augenzeuge ist in diesem
Zusammenhang derjenige, der mit seinen eigenen Augen etwas gesehen und somit er-
fahren hat. Zu dem erfahrenen Ereignis gehören Geräusche, Gerüche oder andere sinn-
lich wahrnehmbare Geschehnisse, mit denen er seine Aussagen über das Ereignis stüt-
zen kann. Diese Eindrücke hat der Augenzeuge für gewöhnlich wahrgenommen, weil er
(zufällig) in Sichtweite stand. Damit teilen Augenzeugen anderen Menschen Geschehen
mit, die diese nicht erlebt haben. Sie schildern die Ereignisse aus ihrer subjektiven
Sicht.
Eine große Rolle spielen Augenzeugen seit jeher in der Justiz (vgl. Koehnher/Spoer
1990). Im juristischen Sinne müssen sie das Ereignis so detailliert wie möglich schil-
dern. Sie sollen sozusagen die Richter, mitnehmen an den Ort des Geschehens und sie
somit an dem Ereignis teilhaben lassen. Bis heute werden Augenzeugenberichte als ver-
lässlich eingeschätzt.
Im Journalismus sind die Berichterstatter Augenzeugen. Die Ereignisse, über die sie
berichten, sind jedoch meist nicht zufälliger Art, sondern inszenierte Veranstaltungen
(vgl. Haller 1997: 28).
In seiner Art der Vermittlung ist der Augenzeugenbericht ebenso wie der Reisebericht
unmittelbar.
Im Unterschied zum Augenzeugen wählt der von einer Reise Berichtende sein Thema
selbst. Er entscheidet, wo er hinfährt, und bestimmt vor Ort seine Reiseroute. Ein Rei-
sebericht bringt fremde und ferne Welten nahe. Der Berichtende erreicht dies, indem er
durch spannende, detaillierte Schilderungen seinem Publikum Informationen über
Landschaft, Menschen, Sitten und Ereignisse mitteilt. Der Erzählende lässt sein Publi-
kum an seiner Reise im Nachhinein teilhaben. Er überwindet räumliche, aber auch kul-
turelle Distanzen. Zu diesem Zweck ist der Reisebericht nicht unbedingt chronologisch
7
geordnet. Der Handlungsstrang wird vom Erzählenden festgelegt.
5
,,Bericht über das Erdbeben von Pompeji" an Tacitus (79 n.Chr.) abgedruckt bei Kisch (1979: 299ff.).
6
Herodot, 490 v. Chr. geboren, berichtet auch unter geografischer und völkerkundlicher Perspektive über
seine Zeit (vgl. Zirbs 1998 : 296).
7
Die Ereignisse sind in ihrer zeitlichen Abfolge wiedergegeben.
Seite - 5 -
Eines der frühsten Bespiele für Reiseberichte liefert Herodot. Während dieser in seinen
Berichten detailreich schildert, klingen die Berichte der von Expeditionen Heimgekehr-
ten Anfang der Neuzeit wesentlich nüchterner
8
. Ihre Reisen haben oftmals den Zweck,
Gebiete zur potentiellen Besetzung oder Ausbeutung zu entdecken. Die Erkundungsbe-
richte der Reisenden werden für ihre Auftraggeber mit dem Ziel verfasst, weitere Mittel
für Reisen zu erhalten.
Wenn Herodot seinem Publikum von fernen Welten erzählt, dann hat dies gewisserma-
ßen den Zweck der Aufklärung
9
. Das Verlangen nach Aufklärung
10
ist auch im 16. und
18. Jahrhundert Motor der Entwicklung und Verbreitung der Reportage (vgl. Haas
1999: 228). Mit Veränderungen zum Besseren werden das Aufdecken von Missständen
sowie von Ungleichheiten verbunden. Ohne diese, so die Denkweise der Aufklärung,
gebe es keinen Fortschritt. Gefördert wird die Form der Reportage auch durch die zeit-
gleiche Entwicklung der Rhetorik
11
(vgl. ebd.).
Ein Beispiel für die Reportage in der Zeit der Aufklärung findet sich in der englischen
Berichterstattung des 18. Jahrhunderts. Durch die Reportage aus dem Parlament ist das
Teilhabenlassen der Bevölkerung am politischen Geschehen beabsichtigt (vgl. Haller
1997: 30). Indem der Reporter durch seine Reportagen die Bevölkerung über die politi-
schen Abläufe informiert, sind die Menschen in der Lage, sich eine Meinung zu bilden
und zu wählen. In diesem Sinne trägt die Reportage zur Demokratisierung der Gesell-
schaft bei.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts wird in den USA auf Grund großer gesellschaftlicher
Probleme das Interesse des Lesers an Sozialreportagen geweckt (vgl. Haas 1999: 287f.).
Die Arbeiten sind leicht lesbar, spannend geschrieben und stellen einen Zusammenhang
auf mikrosozialer Ebene her statt vordergründig anzuklagen. In der Folge gewinnen die
Zeitungen Leser und ihre Berichterstattung bringt wirtschaftliche Veränderungen in
Gang. Die Reporter fungieren hier als Augenzeugen, die im Dienste der Aufklärung der
Bevölkerung Bericht erstatten
12
.
8
Die Berichte waren von neuer Technik und wissenschaftlichem Denken geprägt. Als Beispiel kann das
Bordbuch (1492) von Christoph Kolumbus gelten (vgl. Zirbs 1998 : 297).
9
Europäische Bewegung, die einen Wechsel in politischen und gesellschaftlichen Bereichen bewirkte.
Ein zentrales Ergebnis war die Gewaltenteilung (Harenberg 2000: 34 ff.). Die grundlegende Forderung
der Epoche war, ,,nur die Erfahrung als Quelle der Erkenntnis" gelten zu lassen. Als ,,Kriterien der
menschlichen Vernunft" galten Sinneseindrücke.
10
Ulrich Pätzold (1999: 156f.) sieht eine Wurzel der Reportage in der Aufklärung. Die andere Wurzel sei
,,in dem Erfolgsrezept medialer Massenkommunikation selbst begründet" (ebd.).
11
Zur Geschichte der Rhetorik und Verknüpfung mit der Literatur im 18. und 19. Jahrhundert Gert Ue-
ding (1976).
12
Die Reporter betrieben investigativen Journalismus und wurden ,,muck rakers" genannt (Renger 2000:
98 ff.).
Seite - 6 -
In Deutschland steht vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts der Reise-
bericht im Vordergrund, welcher allerdings eher dichterisch geprägt ist (vgl. Haller
1997: 23ff.). Mit dem Übergang zur Frühromantik am Ende des 18. Jahrhunderts wer-
den Alltagserfahrung sowie der Bezug zur Realität von der Literatur außen vor gelas-
sen
13
. (Selbst-) Reflexion und Raum für eigene Vorstellungskraft erhalten mehr Bedeu-
tung. Losgelöst von dem mit der Aufklärung einhergehenden Realismus, will man
sprachlich und geistig das Wesen und Sein des Menschen vollkommener erfassen
14
.
Realismus wird als ,,unterhalb des literarischen Niveaus" (ebd.: 24) empfunden. Damit
wird Literatur erstmals von Journalismus getrennt behandelt. In Deutschland entbrennt
der Realismus-Streit
15
. Hand in Hand mit der einsetzenden Professionalisierung des
Journalismus setzt sich dieser Streit um Fakten oder Selbstreflexion fort. Kern der Aus-
einandersetzung sind die unterschiedlichen Positionen der Berufe der Literaten und der
Journalisten (vgl. Pätzold 1999:153). Der Vorwurf lautet: Der Journalist sei abhängig
und besitze deshalb keine geistige Souveränität. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kristal-
lisiert sich dann eine Unterscheidung der journalistischen von der literarischen Reporta-
ge
16
heraus, welche insgesamt stärker vom Reisebericht geprägt ist (ebd.). Zudem wird
für die Literatur eine Gebrauchsform gefordert, welche die Grenzen zwischen Literatur
und Wissenschaft aufweicht (vgl. Haas 1999: 278) - ein Postulat, das den Journalismus
bekräftigt.
Die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts schwankt das Selbstverständnis der Journalisten
noch zwischen den Bezeichnungen ,,publizistische Literaten" und ,,literarische Publizis-
ten" (vgl. Haller 1997: 40). An diesem Zeitpunkt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit
Bekanntwerden der Reporter Egon Erwin Kisch
17
(1855-1948) und dem Österreicher
Max Winter (1870-1937) wird in dieser Arbeit der zeitliche Schnitt zwischen ,,Wur-
zeln" und ,,Entwicklungen" der Reportage gesetzt. Zwar ist die moderne Zeitungsrepor-
tage mit der Massenpresse um 1850
18
aufgekommen, doch erst nach der Professionali-
13
Die Romantik wollte alle künstlerischen Gattungen in einem ,,Gesamtkunstwerk" vereinen. ,,Die be-
stimmenden weltanschaulichen und ästhetischen Prinzipien (...) waren Universalität und Subjektivität."
Die Frühromantiker begeisterten sich vor allem für die Epoche des Mittelalters (Zirbs 1998: 310f.).
14
Zentral im Realismus war das ,,Streben nach Wahrheit", ,,(...) die Nachahmung der Natur (...) wurde als
Möglichkeit einer höheren Wirklichkeitserkenntnis gedacht" (Zirbs 1998: 295).
15
Verfechter des Realismus war beispielsweise Johann Gottfried Seume, er verfasste 1802 den ,,Spazier-
gang nach Syrakus" (Seume 1839). Die Positionen des Realismus haben zur Entwicklung der Reisebe-
richte beigetragen und beispielsweise die von Ludwig Börne (1786-1837) und Heinrich Heine (1797-
1856) sowie von Joseph Roth (1894-1939) beeinflusst. Börne und Heine begründeten in diesem Zeitraum
auch das Feuilleton.
16
Mit der literarischen Reportage haben sich in der Literaturwissenschaft Michael Geisler (1982) und
Christian Ernst Siegel (1978) eingehender beschäftigt.
17
Er erhob die Reportage ,,zur Kunstform" (Zirbs 1998: 578).
18
Freigabe des Telegrafennetzes für private Depeschen 1849 (vgl. Haller 1997:37).
Seite - 7 -
sierung des Journalismus grenzt sich die journalistische Reportage von der literarischen
ab (vgl. Blöbaum 1994: 226).
2.2 Entwicklungen der Reportage
In den 20er Jahren wird die journalistische Form im deutschsprachigen Raum vor allem
durch Max Winter und Egon Erwin Kisch mit ihren Methoden des verdeckten Rollen-
spiels
19
bekannt: Statt nur beobachtender Augenzeuge zu sein, wird der Reporter dabei
Handelnder, mischt sich unter die am Ereignis beteiligten Menschen, ohne sich jedoch
als Reporter erkennen zu geben.
Kisch fordert für die Reportage die Zusammenführung von Recherche und Erlebnis
(vgl. Pätzold 1999: 149). Ein Reporter sollte seiner Meinung nach nicht bloß das Erlebte
wiedergeben, sondern den Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
also den größeren gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhang, herstellen. Die Repor-
tage fasst dann neben der Beschreibung des Ereignisses selbst auch Ursachen und mög-
liche Konsequenzen. Die Themenbereiche von Kischs Reportagen stammen vor allem
aus der Großstadt der 20er Jahre: Technik, Arbeitswelt und Arbeitslosigkeit
20
. Sowohl
Winters als auch Kischs Absicht ist neben der Aufklärung die verbesserte Vermittlung
von Berichten aus dem Alltag (vgl. Haas 1999: 279). In ihren Reportagen werden nicht
nur räumliche Distanzen, sondern auch Barrieren geistiger sowie sozialer Art überwun-
den
21
. Die Reportage soll Kisch zufolge literarische Qualität haben, dem Realismus ver-
pflichtet sein und ihr ,,Sujet dem Unterhaltungsbedürfnis der Massen" (Haller 1997: 43)
entsprechen. Das Genre wird in den 20er Jahren in Deutschland im Zuge der ,,Neuen
Sachlichkeit"
22
modern. Bereits der Trend zur Reportage in den USA hatte in Deutsch-
land die Auffassung von Journalismus als rezeptiven Vorgang, der ,,nicht eigentlich
schöpferisch ist" (Haas 1999:234), gewandelt und den Boden für die Reportage bereitet.
19
In London und Paris wurde diese Recherchemethode schon Mitte des 19. Jahrhunderts angewandt (vgl.
Haller 1997: 36).
20
Nicht nur in den Themenbereichen, auch in der intensiven Recherche lässt sich eine Parallele zu den
(empirischen) Sozialwissenschaften ziehen (vgl. Haller 1997: 33).
21
Kisch verehrte den Begründer des Naturalismus (vgl. Zirbs 1998:388), den Schriftsteller Émile Zola
(1840-1902). Ein Beispiel für dessen reportageartige Texte ist ,,Das Leichenschauhaus", nachzulesen in
Kisch (1979: 346f.).
22
Literarische Stilrichtung als Gegenbewegung zum Expressionismus. Die ,,realistische Darstellung der
banalen Alltagswelt" wurde in den Vordergrund gestellt. Die ,,Gebrauchsliteratur in ihrer journalistisch-
dokumentarischen Funktion" (Zirbs 1998: 269 ff.) erlebte einen Höhepunkt.
Seite - 8 -
Wie andere journalistische Formen auch dient die Reportage während des Nationalsozi-
alismus in den 30er und 40er Jahren in Deutschland als Propagandainstrument (vgl.
Haas 1999: 236).
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges macht sich während des Aufbaus der west-
deutschen Publizistik der angelsächsische Einfluss des Nachrichtenjournalismus be-
merkbar (vgl. Hohlfeld/Meier/Neuberger 2002: 15). Der erste verpflichtende Grundsatz
wird die Trennung von Nachricht und Meinung (vgl. Schönbach 1977). Subjektive Dar-
stellungen wie beispielsweise Reportagen oder Essays erscheinen kaum noch (vgl. Hal-
ler 1997: 47).
Im Wiederaufleben der Reportage in den 60er Jahren werden die Traditionen des Au-
genzeugen- und des Reiseberichts, des Ereignis- und Erlebnisberichts vereint. Die
Gründe für die Renaissance der Form werden darin gesehen, dass die gedruckte Sprache
das Ferne und Mehrdeutige wiedergeben kann und die Erkenntnis, dass das Leben nicht
nur in Fakten darzustellen ist (vgl. Haller 1997: 47). Parallel entwickelt sich in den USA
eine Strömung, die mit ,,New Journalism" (Hohlfeld/Meier/Neuberger 2002: 13f.) be-
zeichnet wird. Als ,,Gegenkonzept zum distanzierten Informationsjournalismus und
dessen rationalen Zugang zur Wirklichkeit" (ebd.: 14) bekennen sich die Vertreter
23
des
,,New Journalism" zu subjektiver Berichterstattung. Sie wollen Lebensgefühl vermit-
teln. Zu diesem Zweck greifen sie auf literarische Erzähltechniken mit all ihren Innova-
tionen zurück. In den 70ern prägt in Deutschland vor allem Günter Wallraff
24
mit seinen
recherchierten Sozialreportagen das Genre, in denen er auch wissenschaftliches Material
verwendet (vgl. Haller 1997:50). Es werden zahlreiche Ehrungen und Preise für Repor-
tagen
25
geschaffen. Das Magazin GEO wird 1976 mit umfangreichen Reportagen ge-
gründet. Zeitgleich werden die Erhöhung von ,,institutionellen Barrieren und Schran-
ken" (Haller 1997: 50) und die Entfremdung der Lebenswelt als Folgen gesellschaftli-
cher Entwicklungen empfunden. Unter allen Genres kann besonders die Reportage die-
sen Empfindungen entgegenkommen, auch ein Grund für ihr Wiederaufleben. Gleich-
zeitig aber entsteht ein stärkerer Zwang zur Aktualität sowie härtere Schlagzeilen durch
den Wettbewerb um die Leser. Das Feature wird in Deutschland in den 80ern populär.
23
Als Beispiele seien hier Tom Wolfe, Jimmy Breslin und Gay Talese genannt.
24
1942 geboren, mit der Gruppe 61 in Dortmund verbunden war Wallraff ,,der breitenwirksamste Reprä-
sentant des dokumentarischen Trends` der westdeutschen Literatur in den frühen 70ern" (Zirbs 1998:
379).
25
Berühmtes Beispiel ist der Kisch-Preis, welcher 1977 von Henri Nannen begründet wurde und jährlich
für die drei besten deutschsprachigen Reportagen vergeben wird (vgl. www.stern.de).
Seite - 9 -
Es folgt eine Überflutung des Printmarktes mit Kriegs- und Krisenreportagen sowie
Reportage-Magazinen bis Mitte der 90er Jahre (vgl. Haller 1997: 55).
3 Bestimmung der Reportage in der Literatur
Gleichwohl die Reportage als journalistische Darstellungsform jung ist, hat sie Traditi-
on im deutschen Sprachraum (vgl. Haas 1999: 233). Als Kommunikationsform reichen
ihre Vorläufer weit in die Vergangenheit. Sowohl die Publizistik, mehr aber die Litera-
turwissenschaften beschäftigen sich vor allem in den 20er, 30er und in den 70er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts mit dem Genre
26
. Auch im Bereich der Linguistik wird
die Reportage untersucht. Eine einheitliche Definition liegt zum Zeitpunkt dieser Arbeit
jedoch innerhalb keiner der drei Wissenschaften vor (vgl. Müller 1989: 71f.). Innerhalb
der Literaturwissenschaften ist überwiegend die literarische Reportage Gegenstand der
Untersuchung
27
. Häufig werden in Sammelbänden einzelne Texte mit literaturwissen-
schaftlichen Methoden kritisiert.
Mehr als die publizistische beschäftigt sich die literaturwissenschaftliche Forschung mit
der Reportage in ihrem Verhältnis zu politischen Systemen, insbesondere zu dem des
Sozialismus oder Kommunismus
28
. Sowohl Publizistik als auch Literaturwissenschaften
setzen sich umfangreich mit dem Werk Egon Erwin Kischs auseinander
29
.
Innerhalb der Linguistik werden vor allem handlungstheoretische Grundlagen sowie die
Sprechakttheorie zur Analyse der Reportage herangezogen
30
31
(vgl. Burger 1990). Ei-
nen bedeutenden Beitrag leistet Marlies Müller (1989) mit ihrer linguistischen Analyse
der Reportage
32
.
26
,,Erheblich intensiver (als in der damaligen BRD) ist die Reportagediskussion in der DDR geführt wor-
den, (...)" (Brendel/Grobe 1976: 69).
27
Mit der literarischen Reportage haben sich auch Geisler (1982), Siegel (1978) und Schütz (1977) be-
schäftigt.
28
Dazu beispielsweise Blumenauer et al. (1988: 176ff.).
29
Beispiele hierfür sind Siegel (1973), Kunze (1959) sowie Schlenstedt (1960).
30
Mit der Sprechakttheorie wurde ,,erstmals der Gebrauch der Sprache systematisch aus handlungstheore-
tischer Perspektive analysiert" (Bucher 2000: 252). Als Basis für eine Theorie des kommunikativen Han-
delns ist sie aber nur eingeschränkt nutzbar, da ausschließlich isolierte sprachliche Einzelhandlungen
berücksichtigt wurden (ebd.).
31
Dazu auch Bucher (1986).
32
Müller (1989) sieht das Charakteristische der Reportage in der Doppelzugehörigkeit zum publizisti-
schen sowie literarischen Bereich und in einer weitgehenden thematischen, sprachlichen und komposito-
rischen Offenheit. Sie fungiere als authentischer Augenzeugenbericht und sei primär informierendes
Textmuster mit einem relativ hohen Anteil an subjektiven und emotionalen Elementen. Insgesamt sei die
Reportage der Textsortenklasse zuzurechnen, deren Grundfunktion Informationsvermittlung sei.
Seite - 10 -
Gemeinsam ist allen drei Wissenschaftsbereichen nicht nur die fehlende Definition der
Reportage, sondern auch eine fehlende allgemein anerkannte, systematische Klassifizie-
rung der Genres
33
insgesamt
34
:
,,Die Aufmerksamkeit auf eine journalistische Vermittlungsform zu len-
ken, ist in unserem Fach nicht selbstverständlich. (...) Welche Funktio-
nen und Leistungen die journalistischen Darstellungsformen haben,
(...) darüber wissen wir wenig. (...). Neben der Nachrichtenforschung
gibt es keine Forschungstradition über die Funktionen der journalisti-
schen Darstellungsformen (...)" (Pätzold 1999: 145).
Die Ursachen für den Stand der Forschung werden vielfältig gesehen
35
. Für eine Analy-
se der Reportage bereiten vor allem die verzweigte Entstehungsgeschichte des Genres
aus eher literarischem Reisebericht und eher journalistischem Augenzeugenbericht so-
wie ihre verschiedenen Stilmittel Probleme. Bei dem Versuch, über die Aufstellung von
Kategorien der journalistischen Formen und einer anschließenden Einordnung der Re-
portage, eine Definition zu finden, entstehen Widersprüche: Die Reportage vereint lite-
rarische sowie journalistische Techniken (vgl. Müller 1989: 13). Ihr Kern ist eine Nach-
richt, doch sie macht ihren Inhalt zum Ereignis durch die subjektive Sicht, aus der sie
schildert (vgl. Schlüter 1996: 126). Darüber hinaus ist anzunehmen, dass eine systema-
tische Kategorisierung der Genres erst dann schlüssig erarbeitet werden kann, nachdem
die einzelnen Genres nach einem einheitlichen Modell analysiert und bestimmt wurden
(vgl. Müller 1986: 14). Diese Arbeit konzentriert sich auf die Reportage. Eine Einord-
nung in ein noch zu erstellendes Kategoriensystem der Darstellungsformen wäre ein
Ansatz für eine weiterführende Fragestellung
36
.
33
Neben der Reportage werden desweiteren Nachricht, Bericht, Dokumentation, Interview, Glosse,
Kommentar, Leitartikel, Kolumne, Porträt, Feature und als neuere Formen der Report sowie die (Nach-
richten-) Magazingeschichte unterschieden, wobei die Grenzen zwischen den Formen häufig fließend
sind (vgl. Mast 1998: 221 ff.)
34
Für die Form der Nachricht allerdings ist die Forschung umfangreicher (vgl. Straßner 1975).
35
So forderte BDZV-Präsident Helmut Heinen (2001: ,,Journalismus und Medien: Qualität sichert Zu-
kunft", gefunden unter www.djv.de, gelesen am 23.9.2002 um 16.45 Uhr): ,,In der deutschen Diskussion
um Qualität und die berufliche Generalisierung oder Spezifizierung des Journalisten" solle es mehr um
Genres gehen, dort liege die Kompetenz des Journalismus. Stattdessen drehe sich die Diskussion um
Themenbereiche, beispielsweise Wirtschaft, Wissenschaft oder Umwelt.
36
Ausführlich hat sich mit dem Problem der Klassifizierung von journalistischen Textsorten aus linguisti-
scher Sicht Marlies Müller (1989) in ihrer Arbeit beschäftigt. Vom Standpunkt der Literaturwissenschaf-
ten aus lieferte beispielsweise Hempfer (1973) einen Beitrag mit dem Ziel, eine ,,Systematik der Gat-
tungsforschung" (ebd.: 9) zu entwickeln.
Seite - 11 -
Innerhalb der Publizistik stellt ein Teil der Medienwissenschaftler
37
die kommentieren-
den und die nachrichtlichen Darstellungsformen gegenüber. Letztere sind durch einen
hierarchischen Aufbau gekennzeichnet (vgl. Schneider 1998: 62f.). Allerdings herrscht
keine Einigkeit darüber, zu welcher Sorte die Reportage gehört
38
. Eckart Klaus Roloff
(1982: 10) unterscheidet beispielsweise 19 journalistischen Textgattungen nach drei
Charaktermerkmalen: Referierend, kommentierend und interpretierend. Eine sinnge-
bende Erläuterung fehlt der Kategorisierung jedoch.
Siegfried Weischenberg (1995: 122) unterteilt die Darstellungsformen folgend: Mei-
nung und Bericht sind Nachrichtendarstellungsformen, Kommentar und Glosse Mei-
nungsdarstellungsformen, die Reportage und das Feature zählen zu den Unterhaltungs-
darstellungsformen.
Claudia Mast (1998: 221) rechnet die Reportage neben dem Interview, der Nachricht,
dem Feature und der Dokumentation den tatsachenbetonten (referierenden) Stilformen
zu. Daneben ordnet sie die meinungsbetonten und die fantasiebetonten Formen. Sie un-
terstreicht die doppelte Tradition der Reportage. Die Umschreibung Masts für die Form
wird häufig zitiert: ,,Die Reportage ist ein tatsachenbetonter und tatsachenorientierter,
aber persönlich gefärbter Erlebnisbericht, besonders über Handlungen" (Mast 1998:
221).
Die Einteilung und Umschreibung der Stilformen von Mast sind ebenfalls im Fischer
Lexikon der Publizistik bei Kurt Reumann (1999: 94ff.) zu finden.
Die doppelte Tradition der Reportage erläutert auch Bernd Blöbaum (1994: 226) und
führt aus, dass es dem Journalismus mit der Ausbildung der Form der Reportage gelun-
gen sei, ,,die Ereignishaftigkeit der Gesellschaft (die Umweltkomplexität) besser, d.h.
adäquat, zu verarbeiten."
Koszyk und Pruys (1981: 39) definieren die Reportage nach eigenen Angaben ,,ent-
wicklungsgeschichtlich". Die Einteilung der Darstellungsformen ist bei ihnen jedoch
folgend nicht konsequent durchgehalten. Die Reportage habe als Berichtsform wie der
Bericht und die Meldung ihren Ursprung im Augenzeugenbericht.
Die Definition über die historische Analyse ist für Darstellungsformen zwar sinnvoll,
jedoch nicht erschöpfend. Denn journalistische Formen sind Ausdruck der Gesellschaft
37
So im wesentlichen bei Koszyk/Pruys (1981), Noelle-Neumann (1999) und Roloff (1982).
38
Bezüglich des Problems der Klassifizierung von Genres unterscheidet Michael Haller (1997: 64) inner-
halb der Publizistik zwei Richtungen bei der Zuordnung der Reportage in der Literatur: Die Kategorien-
lehre und die historische Schule. Er schlägt selber eine Klassifizierung der Genres nach zunehmender
Subjektivität vor.
Seite - 12 -
und der Zeit, in der sie stehen. Eine Bestimmung der Funktionen ist zusätzlich notwen-
dig. Eine Analyse der Darstellungsform, die historisch ansetzt, nach Entstehungsbedin-
gungen, aktueller Funktion und Leistung der Reportage fragt und sie in ein theoretisches
Modell einbindet, wird lange gefordert (vgl. Blöbaum 1994: 58f.).
Ulrich Pätzold (1999) unternimmt diesen Versuch. Für ihn ist das Entscheidende an der
Reportage ihre Funktion, da sie es dem Adressaten ermögliche, ,,aus der eigenen Haut
heraus und in die des Reporters hineinzuschlüpfen" (ebd.: 150). In diesem Sinne sei sie
Vermittlung und der Reporter Mittler. Pätzold bestimmt die moderne Reportage, indem
er sie in ein redaktionelles Vermittlungskonzept integriert. Michael Haller (1997: 70 f.)
vertritt ebenfalls einen funktionalen Ansatz. Doch er entwirft kein theoretisches Modell,
in welches er das Genre integriert. Auf sein Buch zum Thema Reportage wird vielfach
verwiesen, aber es ist mehr Ratgeber für die Praxis als eine funktionale Analyse
39
. Ei-
nen entscheidenden Ansatz liefert Silke Fritzsche (1998) in ihrer Diplomarbeit mit einer
Untersuchung der Reportergruppe der Berliner Zeitung
40
. Fritzsche entwirft ein Modell
der Reportage, welches an Pätzold orientiert, nur in ein redaktionelles Vermittlungskon-
zept integriert, bestehen kann.
Desweiteren wird zur Bestimmung der Reportage in der Literatur mit den Begriffen
,,Subjektivität" und ,,Objektivität" gearbeitet (vgl. 4.3).
Andere Autoren beziehen sich auf die Vermittlung der Wirklichkeit und beschreiben auf
diese Weise die Reportage, so beispielsweise Schlenstedt (1959: 22 ff.):
,,Reportage ist eine literarische Form der Aneignung der Wirklichkeit,
die künstlerische Teile (...) mit wissenschaftlicher Dokumentation sach-
lichen Zusammenhangs und begrifflichaufsatzartigen Darstellungen
verbindet, sie weist als Bericht strenge Detailtreue, Wahrheitscharak-
ter und gleichzeitig eine Ebene des Berichterstattungskommentars und
der ästhetischen Wertung auf; ihre Sprachform schwankt zwischen
sachlichem Berichtsstil und künstlerisch gestalteter Sprache."
39
,,Mit Michael Hallers Reportagebuch konnten wir leidlich arbeiten, mußten aber konstatieren, daß er
entweder in den Kategorien der Literaturwissenschaften verharrte oder aber den journalistischen Produk-
tionsprozeß, den wir Reportage nennen, nur unzureichend beschrieben hat." Das Zitat stammt aus einem
Manuskript Pätzolds zu einer Vorlesung gehalten am 2. Dezember 1998 an der Universität Dortmund,
welches auf Anfrage zugeschickt wurde.
40
Die Arbeit mit dem Titel ,,Die Reportergruppe der Berliner Zeitung ein neues Reportagemodell?"
wurde am Institut für Journalistik der Universität Dortmund absolviert und liegt nicht vor, da sie nur dort
einsehbar ist. In Auszügen wird sie in Pätzold (1999) zitiert.
Seite - 13 -
Straßner (1999: 16) sieht in der ,, (..) Darstellung der objektiven Realität als erfahrene
und erfahrbare Tatsache mit allen wichtigen Details (..) das Hauptmittel der Reportage."
Anhand der Darstellung des Menschen in der Reportage erklärt Siegel (1978: 2f.), dass
es sich bei der Umsetzung in die Form um Abbilder der Wirklichkeit handele, denen der
Leser begegne. Jedes Abbild sei Vermittlung. Somit sei das in der Reportage Darge-
stellte dem Leser ,,der Form nach Gegenstand unmittelbarer Erfahrung" (ebd.).
Darüber hinaus geben zahlreiche Werke praxisorientiert Anleitung und Rat zum Schrei-
ben von Reportagen. Ihre Unterteilungen der journalistischen Darstellungsformen sind
ebenso gebrauchsorientiert und häufig schwer nachvollziehbar
41
. Bei kommentierten
Sammelbänden mit Reportagen steht meist der Autor im Vordergrund
42
(vgl. Langen-
bucher 2002).
4 Bestimmung der Reportage in dieser Arbeit
Im folgenden Kapitel werden zunächst grundlegende Begriffe, die theoretische Basis
sowie die Wahl des funktionalen Ansatzes für die Bestimmung der Reportage in dieser
Arbeit analysiert.
Nachdem die Funktion der journalistischen Darstellungsformen allgemein dargelegt ist,
wird die spezifische Funktion der Reportage erläutert. Im Anschluss daran wird der
Funktion und den Leistungen entsprechend, ein idealtypisches Modell der Form der
Reportage aufgestellt.
Der Verdeutlichung dient schließlich die Abgrenzung des entwickelten Modells der
Reportage gegenüber dem Feature.
4.1 Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlage
Wie vorangegangen beschrieben, fehlt eine allgemein anerkannte Definition der Repor-
tage (vgl. Haller 1997: 69). Auch eine Theorie aus dem Bereich der Journalistik
43
in die
ein Reportagemodell und sein Kontext schlüssig eingefügt oder im Rahmen derer es
aufgebaut werden könnte, liegt derzeit nicht vor. Zu einem theoretischen Komplex der
Journalistik können beispielsweise die Subjekt- und Akteurstheorie, die Handlungstheo-
41
Die Perspektive auf die Praxis haben beispielsweise La Roche (1999) und Fey/Schlüter (1999) gerich-
tet.
42
Desweiteren beschäftigten sich auch Groth (1962), Dovifat (1962), Karst (1976), Langenbucher (1980),
Meyer (2001), Rudolf (1993), Schönbach (1977) sowie Schütz (1974) mit der Reportage.
43
,,Journalistik ist die Wissenschaft vom Journalismus (...). Die Journalistik ist eine Teildisziplin der
Kommunikationswissenschaft und geht doch durch ihren intensiven Praxisbezug über die Kommunikati-
onswissenschaft hinaus" (Neverla/Grittmann/Pater 2002: 11).
Seite - 14 -
rie, die Gatekeeper-Studien sowie Fallstudien gezählt werden
44
. Diese theoretischen
Ansätze werden genutzt, um professionelle und subjektive Einstellungen von Journalis-
ten sowie Ursachen von Berichterstattung zu erforschen. Gegenstand dieser Arbeit ist
jedoch die Reportage als ein bestimmtes Muster journalistischer Kommunikationsfor-
men. Der Reporter wird eingebunden in das journalistische Umfeld betrachtet. Zu Guns-
ten der Bestimmung eines Idealtypus der Reportage wird er als Kommunikator schema-
tisiert, zu dem Kontext der Reportage gezählt und als solcher behandelt. Das journalisti-
sche Subjekt bleibt außen vor
45
. Da für die Bestimmung der Reportage deduktiv ein
generalisierendes Muster erstellt wird, um Funktion, Leistungen und Form des Genres
zu bestimmen, greifen oben genannte theoretische Ansätze nicht.
Zu einem weiteren theoretischen Komplex können die System- und Organisationstheo-
rie, kybernetische Analysen sowie Untersuchungen von Rollen und sozialen Adressen
geordnet werden (vgl. Scholl 1998c: 3). Sie gehen davon aus, dass ,,technologische,
ökonomische, politische, organisatorische und strukturelle Zwänge journalistisches
Handeln auf Routineangelegenheiten in einem kybernetischen System" (ebd.) reduzie-
ren
46
.
Einer dieser theoretischen Ansätze in der Journalistik, der für die Genreforschung ver-
wendet wird, ist die Organisationstheorie. Sie wird meist herangezogen, um ,,die Repor-
tage als Vermittlungsleistung der Zeitung zu erklären" (Haller 2000: 114)
47
. Genres
haben aber einen weiter gefassten Kontext als die Zeitung, in der sie erscheinen. Um
einen Idealtypus zu bestimmen, muss zunächst die Perspektive auf das Genre an sich,
seine Funktion und Leistungen in der journalistischen Kommunikation gerichtet wer-
den. Erst dann kann die Reportage innerhalb einzelner Aspekte ihres Kontextes unter-
sucht werden
48
.
44
Die theoretischen Ansätze innerhalb der Journalistik sind vielfach in zwei Bereiche geteilt worden (vgl.
Scholl 1998c: 3): In das voluntaristische und das objektivistische Verständnis. Als gegensätzliche Strö-
mungen lassen sich ebenfalls realistische versus konstruktivistische-idealistische Theorien aufführen (vgl.
Weber 2000: 458).
45
Somit bleiben auch das Gewicht von politischen Einstellungen oder des Geschlechts des Reporters
unbeachtet, auch wenn es in der Praxis Einfluss auf die jeweilige Reportage hat. Zu ersterem Punkt gibt
es umfangreiche Literatur, vor allem aus der ehemaligen DDR (vgl. Siegel (1978) sowie Blumenauer
(1988)). Haller (2000: 114) dagegen erachtet das journalistische Individuum als ,,maßgeblich".
46
Die Distinktionstheorie versucht, vereinfacht dargestellt, beide Komplexe zu verbinden (vgl. Weber
2000: 459ff.).
47
So geschehen bei Pätzold (1999).
48
Da Genres ,,keine konstanten Größen" sind, wandeln sie sich mit dem ,,sozialen System und dem Me-
diensystem, ihre Funktion ist jeweils im Systemkontext zu bestimmen" (Weischenberg 1995: 120).
Seite - 15 -
Auch eine systemtheoretische Analyse ist für Genres nicht geeignet, da es sich nicht um
ein System im strengen Sinne handelt
49
. Die Gründe dafür werden deutlich, wenn man
einen der zentralen Begriffe der Systemtheorie, die Funktion beleuchtet. Da der Funkti-
onsbegriff in dieser Arbeit in einem anderen Verständnis verwendet wird, muss er zu-
nächst gegenüber seiner Bedeutung innerhalb der Systemtheorie abgegrenzt werden, um
dann die Verwendung des Begriffs in dieser Arbeit zu klären. Dies erfordert einen kur-
zen Exkurs:
Der Funktionsbegriff ,,zieht sich wie ein roter Faden durch die einschlägige publizisti-
sche Literatur" (Lüger 1977: 16). Seit den 60ern Jahren ist er in der Publizistik durch
die Systemtheorie besetzt
50
. Damals entwickelte Manfred Rühl (1969) den funktional-
strukturellen Ansatz der Systemtheorie auf medientheoretischer Ebene und wandte ihn
in der Redaktionsforschung an (vgl. Huber 1998:27)
51
. Rühl entwarf ein Bild des Jour-
nalismus, das diesen als soziales System begreift, welches in Beziehung zu anderen so-
zialen Systemen steht. Kommunikation ist das Grundelement zur Analyse der Systeme,
da diese als Kommunikationssysteme
52
gedacht werden (vgl. Blöbaum 1994: 75). Sys-
temtheorie wird seither vielfach zitiert, versucht weiterzuentwickeln
53
, als Ansatz für
individuelle Theorien gebraucht
54
und kritisiert (vgl. Löffelholz 2000: 55).
System meint in der Denkweise der Theorie ,,ein Gebilde mit einer bestimmten Ord-
nung, in dem Handlungen und Kommunikationen bestimmte Konsequenzen haben"
(Weischenberg 1995: 99). Die Funktionen des Systems beschreiben die Relationen
55
zu
anderen Systemen auf der Makroebene der Gesellschaft
56
, beispielsweise dem System
Wirtschaft oder Politik
57
.
49
Haller (2000: 114) sieht ,,Systemtheorie für Genreforschung ,,nicht anwendbar", da ,,für die journalisti-
sche Aussagenproduktion einzelner Genres keine Systemstruktur feststellbar ist."
50
Einige Vorläufer der Systemtheorie hat Huber (1998: 19) aufgeführt.
51
Ausführlicher dazu Löffelholz (2000:53).
52
Mehr bei Quandt (2000: 505).
53
Später baute Rühl (1980) Teile des systemtheoretischen Ansatzes von Niklas Luhmann in die Weiter-
entwicklung seines theoretischen Modells ein.
54
Die fünf zentralen Ansätze der Systemtheorie hat beispielsweise Huber (1998: 19ff.) erläutert.
55
,,Bei Funktionen handelt es sich um Relationen zu sozialen Einheiten" (Weischenberg 1995: 96).
56
Rühl (2000: 68) unterscheidet drei soziale Ebenen: Auf der Makroebene wird ,,(...) Journalismus ge-
samtgesellschaftlich untersucht, genauer: es werden Beziehungen zwischen dem Funktionssystem Journa-
lismus und den gesellschaftlichen Funktionssystemen (...) in Frage gestellt." Auf der Mikroebene werden
,, (...) die internen Verläufe und deren Management in der produzierenden Organisation (...)"(ebd.) be-
trachtet und ,,Programme des Journalismus organisationsförmig beobachtet" (ebd.: 76). Die Mesoebene
vereinigt ,, (...) journalistische Leistungen und Gegenleistungen gleichsam marktförmig als journalisti-
sches bzw. redaktionelles Marketing (...)" (ebd.)
57
Über die Einteilung der Systeme gab es in der anschließenden theoretischen Diskussion unterschiedli-
che Meinungen. Die einen zählten Journalismus als Teil der Publizistik, andere als Teilsystem der Gesell-
schaft (vgl. Löffelholz 2000: 53).
Seite - 16 -
,,Funktion ist einer jener Schlüsselbegriffe, der Kommunikationsfor-
schung, welche die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den
Medien sowie zwischen den Medien und dem Medienpublikum kenn-
zeichnen soll" (Weischenberg 1995: 93).
Als Leistung wird in der Systemtheorie ,,der Austausch von Ressourcen zwischen Sys-
temen (...) bezeichnet" (Blöbaum 1994: 77).
Für das System Journalismus wird eine Thematisierungsfunktion festgestellt
58
. Alle
weiterführenden vermeintlichen Funktionszuweisungen sind Aufgaben, Ziele, Zwecke
und Leistungen des Journalismus, auch die in Gesetzestexten zum Teil so benannte In-
formations-, Vermittlungs-, Orientierungs-, Meinungsbildungs-, Unterhaltungs- und
Servicefunktion, da sie nichts über die Strukturen aussagen (vgl. Weischenberg 1995:
103). Ein System hat verschiedene Subsysteme. Für das System Journalismus sind das
beispielsweise Verlag und Redaktion auf der Mikroebene, wobei diese sich noch weiter
in die Subsysteme der Ressorts gliedern lassen (vgl. ebd.: 100). Auch die Beziehungen
der Subsysteme lassen sich analysieren. Eine Darstellungsform ist jedoch kein System,
sondern in der systemtheoretischen Begrifflichkeit ein journalistisches Programm
59
:
Genres sind Darstellungsprogramme (vgl. Blöbaum 2000: 177). Der systemtheoretische
Funktionsbegriff kann nicht auf diese angewendet werden und wird zudem für gewöhn-
lich auf der Makroebene benutzt.
Nach diesem Exkurs wird folgend erläutert, in welchem Verständnis diese Arbeit den
Begriff verwendet. Es werden nicht die Funktionen eines Systems in der Gesellschaft,
sondern die der Darstellungsform Reportage in der journalistischen Kommunikation
betrachtet. Es werden im Folgenden Funktion und Leistungen unterschieden, es wird
nicht von Zielen, Anforderungen oder Aufgaben
60
gesprochen. Denn Kommunikation
setzt mindestens zwei Elemente, Personen oder Gruppen in Beziehung zueinander. Die
Funktion der Darstellungsform beschreibt ihre Position im Kommunikationsprozess.
58
Rühl (1980: 322f.) definiert die Primärfunktion von Journalismus folgendermaßen: ,,Die besonderen
Leistungen und die besonderen Wirkungen des Journalismus (...) bestehen in der Ausrichtung auf die
Herstellung und Bereitstellung von Themen zur öffentlichen Kommunikation".
59
Im System Journalismus werden fünf Typen von Programmen unterschieden: Ordnungs-, Darstellungs-
, Informations-, Selektions- und Prüfungsprogramme (Blöbaum 2000: 177ff.). ,,Die Darstellungspro-
gramme sind Textformen und Techniken der Präsentation, die auf der Vermittlung von Information aus-
gerichtet sind" (Blöbaum 1994: 220).
60
Gutting (1992: 12) begründet in ihrer Arbeit die Verwendung des Funktionsbegriffs statt des Aufga-
benbegriffs in Bezug auf die Zeitung damit, dass es keinen ,,Aufgabensteller" gebe, welcher berechtigt
sei, die Zeitung ihrer Tätigkeit wegen zur Verantwortung zu ziehen.
Seite - 17 -
Unter Funktion wird im Folgenden die Zuständigkeit der Darstellungsform innerhalb
der journalistischen Kommunikation verstanden
61
.
Als Teilnehmer der Kommunikation werden in dieser Arbeit der in den journalistischen
Kontext eingebundene Reporter als Kommunikator und der Leser als Rezipient betrach-
tet.
Für diese beiden Parteien erbringt die Darstellungsform Leistungen.
Die Intentionen und Erwartungen von Kommunikator und Rezipient für die Kommuni-
kation werden in den Leistungen der Darstellungsform ausgedrückt, sie beschreiben
auch ihre Beziehung (vgl. 4.4). Die Leistungen realisieren die spezielle Funktion der
jeweiligen Darstellungsform, sie bedingen sich gegenseitig.
Indem die Reportage über ihre Funktion in der journalistischen Kommunikation be-
stimmt wird, muss anschließend das Umfeld dieser Kommunikation betrachtet werden.
Hierzu zählen eingebunden in den Normenkontext von Massenmedien in dieser Arbeit
das Medium Zeitung, in welchem die Reportage erscheint, und die Organisation, die
hinter diesem Medium steht, sowie der Markt, auf dem die Zeitung angeboten wird (vgl.
6.). Auch Leser und Reporter gehören in das Umfeld.
Der Normenkontext von Massenmedien bezieht rechtlich verankerte und medientheore-
tisch zugewiesene Anforderungen ein (vgl. 6.1). Aus ihnen entstehen Aufgaben für die
einzelnen Organisationen, welche von Journalisten ausgeführt werden. Diese überneh-
men im Prozess der journalistischen Kommunikation eine Vermittlungstätigkeit. Ent-
scheidend für die Vermittlung ihrer Mitteilung ist die Auswahl der passenden journalis-
tischen Form. Diese erfolgt nach der spezifischen Funktion der Darstellungsform, wel-
che sie im Kommunikationsprozess übernehmen soll, sowie den Leistungen, die sie
folglich für Reporter und Leser erbringen soll. Dies ist auch von Medium, Thema, der
Intention des Reporters und den Erwartungen des Publikums abhängig
62
(vgl. Haller
1997: 71). Die Ebene, auf welcher die Auswahl stattfindet, wird aus medientheoreti-
scher Sicht mit Mikroebene (vgl. Rühl 2000: 68) bezeichnet und bildet die Untersu-
chungsebene dieser Arbeit.
4.2 Wahl des funktionalen Ansatzes
In dieser Arbeit wird als Ansatz zur Bestimmung der Reportage ihre Funktion gewählt.
Im Unterschied zu Haller (1997) und Pätzold (1999) werden die Funktion und ihre Leis-
61
,,Funktion kann (..) auch (...) bezeichnen, wodurch jemand für etwas zuständig oder verantwortlich
wird" (Weischenberg 1995: 93).
Seite - 18 -
tungen innerhalb der journalistischen Kommunikation dargestellt. Erst nach der Be-
stimmung der Reportage werden einzelne Bereiche ihres Umfeldes theoriegeleitet be-
trachtet.
Der Ansatzpunkt dieser Arbeit wird in der zu prüfenden These ausgedrückt: Ein Funkti-
onsverlust der Reportage führt zur Auflösung der Form
63
. Die Funktion bestimmt also
die Form. Diese Annahme erklärt sich aus dem Kommunikationsprozess an sich:
Kommunikationsprozessen stehen Kommunikationsabsichten voran, denn Kommunika-
tion ist intentional (vgl. Schulz 1999: 140ff.,160f.). Erst wenn der Kommunikator eine
Kommunikationsabsicht hat, wählt er eine Kommunikationsform entsprechend ihrer
speziellen Funktion, die Thema und Inhalt der Mitteilung adäquat vermittelt und seiner
Kommunikationsabsicht dient (vgl. Burkart 2002: 57). Die Funktion verbindet Form
und Inhalt der Mitteilung. Gleichwohl bedingen sich Form, Inhalt und Funktion auch
gegenseitig. Die Funktion einer Kommunikationsform wird ihr nicht im Nachhinein
zugewiesen, sondern sie prägt die Form und ist ihre Entstehungsbasis. Wie bereits er-
wähnt (vgl. 1.), hat der Eindruck des Schwindens der Reportage aus den Tageszeitungen
den Anstoß zu dem Thema der Arbeit gegeben. Für die Bestimmung des Genres, beim
Prüfen der These und Untersuchen von Ursachen für Entwicklungen ist die Funktion
der erste schlüssige Ansatzpunkt.
Für eine Untersuchung der aktuellen Reportage über ihre Funktion innerhalb der journa-
listischen Kommunikation wird der Gesamtzusammenhang des Genres berücksichtigt
64
.
Daraus erwächst der Vorteil, dass die Untersuchung der journalistischen Form nicht
ohne ihren Zusammenhang statt findet, sich nicht nur auf das Wesen des journalisti-
schen Produktes allein fokussiert, sondern innerhalb des vorgefundenen aktuellen jour-
nalistischen Umfeldes erfolgt (vgl. Weischenberg 1995: 112). Dieser Blickwinkel er-
möglicht es, einen Wandel des Umfeldes zu berücksichtigen, der die Funktion und so-
mit die Form der Reportage als Teil der journalistischen Kommunikation beeinflusst
(vgl. 6.)
65
.
62
,,Journalistisches Handeln ist institutionalisiertes Handeln und damit spezifischen Bedingungen (..)
unterworfen" (Bucher 2000: 261).
63
Dazu Pätzold (1998: 9) in Bezug auf die Untersuchung Fritzsches: ,,(...) die Reporter bestätigen, daß
die Reportage durch ihre Funktion bestimmt wird, daß sich aus dieser Funktion der Formenreichtum der
Reportage erklären läßt." Als funktionale Ebene ermittelt Pätzold (ebd.) die Vermittlungsebene.
64
,,(...) situative, funktionale und sozialstrukturelle Faktoren (sind) entscheidend an der Prägung kommu-
nikativer Gattungen beteiligt" (Haas 1999: 227).
65
Den Vorteil des funktionalen Ansatzes in der Untersuchung von Journalismus beschreibt Blöbaum
(1994: 62) in dem Versuch, ,,Funktionen (und) Leistungen (...) zu identifizieren", statt ,,Definitionen, die
Journalismus an das Handeln von Journalisten ketten und auf Werte beziehen, die sich wie Tugendkatalo-
ge lesen (..)".
Seite - 19 -
Der Nutzen einer solchen Untersuchung liegt in der berufsbezogenen Perspektive. Im-
mer wieder werden Genres als Qualitätsmerkmal des Journalismus herausgestellt
66
. Um
aber als solches zu dienen, muss ein Genre in Funktion, Leistung und Form bestimmt
sein. Zudem können Entwicklungen der Reportageform auf einen größeren Gesamtzu-
sammenhang hinweisen. In diesem sind Ursachen für Veränderungen in der Erschei-
nung eines Genres zu untersuchen.
4.3 Funktion und Leistung der journalistischen Darstellungsformen
Als ,,routinisierte Vermittlungsleistung" beschreibt Hannes Haas (1999: 228) Darstel-
lungsformen. Als ,,Muster der Gestaltung und Präsentation von Medienangeboten" be-
zeichnet Klaus-Dieter Altmeppen (2000: 301) sie. Zum Bereich der journalismuseige-
nen Symboltechniken rechnet Manfred Rühl (1980: 303) die Genres:
,,Diese verbal und/oder nonverbal auszufüllenden Schemata zur Ver-
einfachung öffentlicher Kommunikation sind zu mehr oder weniger
journalismusspezifischen Technikstandards geworden, die in Variati-
onen angewandt zur Ordnung journalistischer Kommunikation bei-
tragen".
Im Folgenden werden journalistische Darstellungsformen als Muster für die journalisti-
sche Kommunikation verstanden.
In ihrer Funktion sind journalistische Darstellungsformen anderen Kommunikations-
formen ähnlich. Sie sind auf die allgemeine Intention von Kommunikation, auf Vermitt-
lung ausgerichtet (vgl. Schulz 1999: 161). Kommunikationsformen haben eine Vermitt-
lungsfunktion. Kommunikation findet zwischen mindestens zwei Parteien statt, Kom-
munikator und Rezipient
67
. Die Kommunikationsformen haben die Position eines Bin-
degliedes zwischen den beiden Parteien. Für journalistische Darstellungsformen gilt
diese Funktion besonders, da sie Teil professionalisierter Kommunikation sind. Reali-
siert wird die Funktion der journalistischen Darstellungsformen durch ihre Leistungen.
Dazu gehört, Inhalt und Form passend zu verbinden, um Themen und Inhalte adäquat zu
66 Vgl. Heinen, Helmut (2001): ,,Journalismus und Medien: Qualität sichert Zukunft", Impulsreferat
anlässlich des Forums ,,Initiative Qualität im Journalismus", gehalten am 8.10.2001 in Bonn, gefunden
unter www.djv.de, gelesen am 23.9.2002 um 16.45 Uhr.
67
Wobei die Kommunikationsabsichten von Kommunikator und Rezipient durchaus unterschiedlich sein
können (vgl. Schulz 1999: 160 f.).
Seite - 20 -
vermitteln
68
. Denn Ziel gerade der professionalisierten Kommunikation ist, dass die
Mitteilung den Rezipienten erreicht
69
.
Eine weitere Leistung von Genres ist zum einen der Transport der Vermittlungsabsicht
des Kommunikators (vgl. Weischenberg 1995: 329). Das kann beispielsweise eine be-
stimmte Reaktion sein, die er bei dem Leser hervorrufen will. Zum anderen transportie-
ren Genres den Wirklichkeitsbezug, den der Kommunikator anbieten will und der in
Abhängigkeit von Rezeptionsgewohnheiten auswählt (vgl. ebd.: 124). Unter Wirklich-
keitsbezug wird die Art und Weise verstanden, in der Wirklichkeit medial widergespie-
gelt wird.
,,(...) die Erkenntnistheorie des Konstruktivismus und die Nachrichten-
werttheorie (stimmen) darin weitgehend überein, dass die Medien
ebenso wie die Menschen Weltbilder entwerfen und dass diese Wirk-
lichkeitskonstruktion der Medien vermutlich analog zu den Regeln der
menschlichen Wahrnehmung abläuft" (Weischenberg 1995: 172).
Ein Modell für solch eine Wirklichkeitskonstruktion ist das Berichterstattungsmuster
der objektiven Berichterstattung oder des Informationsjournalismus, der im Journalis-
mus der westlichen Länder dominiert (vgl. Weischenberg 1995: 112 f.,172). Grundsatz
dieses Musters ist die strikte Trennung von Nachricht und Meinung. Die Einteilung der
Geschehnisse der Welt in Fakten und Meinungen ist ein Modell, die Wirklichkeit wi-
derzuspiegeln. Die Darstellungsformen setzen diesen Grundsatz um, sie transportieren
ein Wirklichkeitsmodell und unterstützen es (ebd.: 122). Ist ein Artikel beispielsweise
als Kommentar gekennzeichnet, kann der Leser mit der Vermittlung von Meinung rech-
nen. Von einer kurz gefassten, hierarchisch aufgebauten Nachricht kann die Vermittlung
von Fakten erwartet werden. Darüber hinaus tragen die Genres durch ihre Einteilung zu
der Erfüllung von Kriterien bei, an denen Journalismus gemessen wird. Für den westli-
chen Journalismus sind das ,,Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Nützlichkeit" (Wei-
schenberg 1995: 167 f.). Durch die Genres als wiederkehrende Muster, wird den Rezi-
pienten die Möglichkeit gegeben, Schemata zu entwickeln, die ihren Umgang mit den
Medienangeboten steuern. Sie ordnen die journalistische Kommunikation und vereinfa-
chen sie (vgl. Rühl 1980: 303).
68
Haller (1997: 71) hat der Reportage die Funktion einer ,,Kreuzbogenbrücke" zugeschrieben, welche
,,Spezifika des Mediums, Thema, journalistische Intention" sowie die ,,Erwartungen der Leserschaft"
verbinde.
69
Ob die Mitteilung bei dem Rezipienten auch zur Information wird, ist von weiteren Faktoren abhängig
(vgl. Schulz 1999: 148 ff.).
Seite - 21 -
Die oben genannten Leistungen erbringen alle journalistischen Darstellungsformen, sie
realisieren ihre allgemeine Vermittlungsfunktion. Darüber hinaus haben journalistische
Formen eine ganz spezielle, jeweils unterschiedliche Vermittlungsfunktion, die durch
spezielle Leistungen umgesetzt und charakterisiert wird.
Die Leistungen der Genres entsprechen den Aufgaben von Massenmedien in Deutsch-
land welche von Normen geprägt sind, die eng mit dem Berichterstattungsmuster ver-
knüpft sind (vgl. 6.1). Massenmedien haben rechtlich verankerte Aufgaben (vgl. 6.1).
Sie sollen durch Selektion, Information und Kritik zu Bildung, Orientierung und Kon-
trolle beitragen (vgl. Altendorfer 2001: 29 ff., 263). Darüber hinaus haben sie die me-
dientheoretisch zugewiesene Aufgabe der Unterhaltung (vgl. Meyn 1999: 32). Diese
Aufgaben
70
von Medien in der Gesellschaft spiegeln sich in den journalistischen Dar-
stellungsformen wider. Schließlich sind sie Teil der journalistischen Kommunikation,
die diese Aufgaben umsetzt
71
. Dabei sind Unterhaltung und Information getrennt. ,,In-
formationsorientierte und unterhaltungsorientierte Journalismuskonzepte" (Klaus 2002:
620) werden in Deutschland teilweise sogar konträr gegenübergestellt. Dem Berichter-
stattungsmuster folgend, dient jedoch der überwiegende Teil der Darstellungsformen
der Informationsvermittlung. Die journalistische Kommunikation hat Genres zur Verfü-
gung, die sich durch ihre Vermittlungsfunktion, realisiert durch Leistungen, als Kom-
munikationsform voneinander unterscheiden.
Zusammenfassend lassen sich folgende allgemeine Leistungen von Darstellungsformen
feststellen: Sie verbinden Form und Inhalt der Mitteilung passend, um Themen und In-
halte adäquat zu vermitteln. Sie tragen dazu bei, dass die Mitteilung vom Rezipienten
aufgenommen und verarbeitet wird. Sie transportieren und unterstützen die Vermitt-
lungsabsicht des Kommunikators und das von ihm angebotene Wirklichkeitsmodell.
Genres vereinfachen die journalistische Kommunikation, indem sie zur Ordnung der-
selben beitragen und dem Rezipienten ermöglichen, Schemata für den Umgang mit Me-
dien zu entwickeln. Darüber hinaus haben Genres eine jeweils spezielle Vermittlungs-
funktion.
70
Die Aufgaben der Massenmedien entsprechen in Teilen den von Denis Mc Quail (1983: 83) aufgestell-
ten Bedürfnissen, welche ihm zufolge Absichten von Rezipienten bei Kommunikation bestimmen: Infor-
mationsbedürfnis, Bedürfnis nach persönlicher Identität, Bedürfnis nach Integration und sozialer Interak-
tion sowie Unterhaltungsbedürfnis.
71
Ein Wandel der Aufgaben von Massenmedien oder eine Verschiebung des Gewichtes unter ihnen hat
Auswirkungen auf die Darstellungsformen (vgl. 6).
Seite - 22 -
4.4 Funktion und Leistung der Reportage
Im Folgenden wird ein Idealtypus der Reportage anhand ihrer Funktion und Leistungen
dargestellt. Bevor auf die spezielle Vermittlungsfunktion und ihre Leistungen eingegan-
gen wird, muss auf einen Aspekt der eben dargestellten allgemeinen Vermittlungsfunk-
tion Bezug genommen werden, um eine anscheinende Widersprüchlichkeit zu vermei-
den.
Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, unterstützen Genres in Deutschland den so ge-
nannten Informationsjournalismus, an den das Kriterium der Objektivität
72
geknüpft ist.
Die Reportage ist aber durch die subjektive Sichtweise ihres Reporters geprägt. Das ist
der Grund, weshalb die Reportage auch als ,,subjektivste journalistische Form" (Haller
1997) bezeichnet wird
73
.
Trotzdem transportiert die Reportage das Berichterstattungsmuster und unterstützt es
74
.
Die Reportage ist sowohl subjektiver Erlebnisbericht als auch nachrichtlicher Ereignis-
bericht. Werden die Arbeitsmethoden der Reportage herangezogen, erfüllt sie sogar
überdurchschnittlich die Anforderungen journalistischer Objektivität
75
. Der Reporter ist
Augenzeuge der Handlungen der Reportage und hat die Informationen intensiv recher-
chiert (vgl. 4.4). Die Reportage hat auch in dieser Hinsicht die gleiche allgemeine
Vermittlungsfunktion wie andere Genres
76
.
Die spezielle Vermittlungsfunktion der Darstellungsform ist geprägt durch die aus ihrer
doppelten Tradition stammenden Leistungen und die Spuren ihrer Entwicklungsge-
schichte. Augenzeugenbericht und Reisebericht haben ihre spezielle Vermittlungsfunk-
tion gemeinsam (vgl. Schäfer: 150 f.). Diese wird durch die in 2.1 genannten Leistungen
realisiert, welche die Reportage vereinigt und ergänzt. Reportage hat die Funktion, ei-
nen Ausschnitt der Wirklichkeit aus der Sicht des Reporters an den Leser zu vermit-
teln
77
.
72
Gutting (2001: 15) hat Objektivität als den ,,Verzicht auf bewusste Manipulation" definiert.
73
,,Die journalistische Reportage gehört zu dem Journalismus, der sich um höchstmögliche Objektivität
bemüht" (Pätzold 1999: 146). Schneider (1998: 106) erklärt dazu: ,,Subjektivität meint die Auswahl der
Tatsachen durch den Autor, der sie selbst erlebt und für seine Reportage nutzt."
74
Petra E. Dorsch führte zum dem Thema ,,Objektivität durch Subjektivität?" ein Interview mit Herbert
Riehl-Heyse (1980: 97 ff.).
75
Die Objektivitätskriterien journalistischer Qualität richten sich beispielsweise nach Gianluca Wallischs
(1995:122-127) Untersuchung nach der Recherche.
76
Mit Subjektivität, Objektivität und Wahrheitsgehalt der Pressereportage hat sich Verena Blaum (1998)
ausführlicher auseinander gesetzt.
77
,,Reportage ist eine Ausschnittsvergrößerung von Wirklichkeit. Im günstigsten Fall ermöglicht sie
zugleich den Blick auf ein umfassendes Geschehen" (Leinemann 1997: 262).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832469689
- ISBN (Paperback)
- 9783838669687
- DOI
- 10.3239/9783832469689
- Dateigröße
- 877 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Bremen – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Juli)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- journalismus medienökonomie rezipient funktionsanalyse inhaltsanalyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de