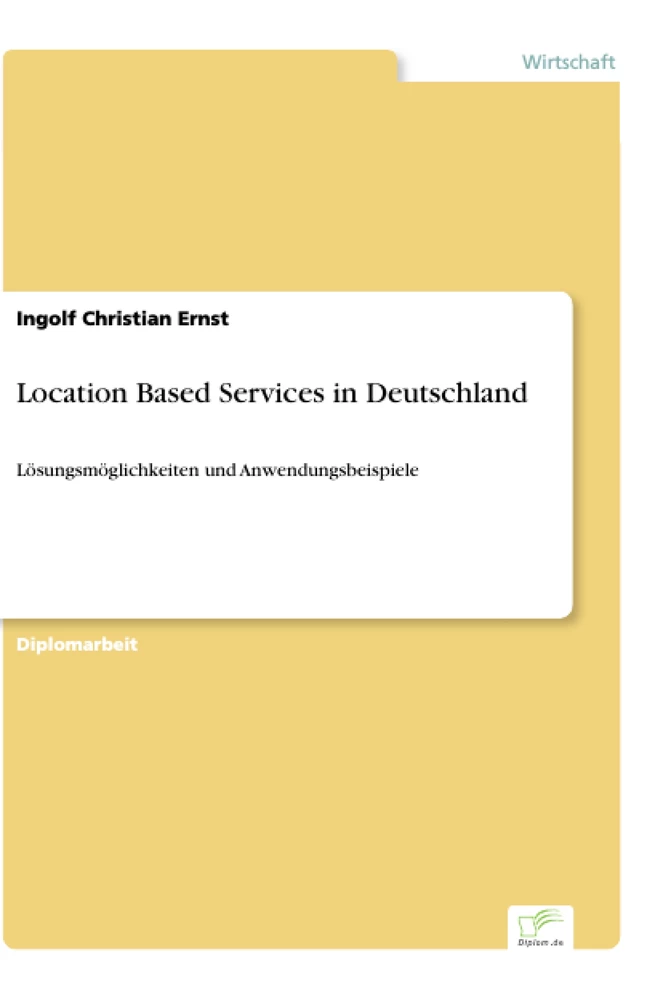Location Based Services in Deutschland
Lösungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele
Zusammenfassung
Mobilfunkbetreiber befinden sich durch hohe Investitionen in Netze und in Lizenzen für zukünftige Übertragungsstandards heute unter starkem Kostendruck. Die Mobilfunk-Penetration der Bevölkerung hat ein Maß angenommen, welches in Zukunft nur noch moderate Wachstumsraten ermöglicht. Neukundengewinnung und Kundenbindung sind mit hohen zusätzlichen Werbekosten verbunden. Darüber hinaus leiden die Netzbetreiber unter sinkenden Preisen und Gewinnmargen in den Bereichen der Sprachtelefonie.
Diese hohe Kostenbelastung drückt die Gewinnaussichten der Netzbetreiber und schlägt sich in der schlechten Kapitalmarktsituation der gesamten Telekommunikationsbranche nieder.
Aus dieser Lage heraus suchen die Netzbetreiber nach Lösungen zur Differenzierung und Erschließung neuer Umsatzmöglichkeiten.
Doch nicht nur die Netzbetreiber, auch die Endgerätehersteller und die Lieferanten der Netzinfrastruktur suchen verstärkt nach Lösungen, mit denen sie sich vom harten Wettbewerb abheben und neue Umsatzquellen erschließen können.
Standortbasierte Dienste, Location Based Services, können nach Aussage von Marktforschungsunternehmen eine vielversprechende Lösung sein, die Akzeptanz mobiler Internetangebote zu fördern und neue Umsätze zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNISI
ABBILDUNGSVERZEICHNISIV
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISV
1.EINLEITUNG1
1.1PROBLEMSTELLUNG1
1.2ZIELSETZUNG1
1.3VORGEHENSWEISE UND AUFBAU2
2.ENTWICKLUNG DER MOBILFUNKTECHNOLOGIEN4
2.1ABGRENZUNG DRAHTLOSE UND MOBILE KOMMUNIKATION4
2.2GESCHICHTE DER MOBILKOMMUNIKATION5
2.2.1Die Jahrhundertwende - Start der drahtlosen Kommunikation5
2.2.2Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg7
2.2.3Das Zeitalter von GSM8
2.2.4Ein weltweit einheitlicher Standard für zukünftige Telekommunikation11
2.2.5Optimierung der Datenübertragung bei GSM11
2.3MOBILFUNKSYSTEME IN GENERATIONEN13
2.3.11. Generation (analog)13
2.3.22. Generation (digital)13
2.3.33. Generation (multimedial)14
2.3.44. Generation19
3.LOKALISIERUNGSTECHNIKEN IM VERGLEICH21
3.1DEFINITION LOCATION BASED SERVICES21
3.2ANFORDERUNG AN DIE TECHNIK21
3.2.1Genauigkeit (Accuracy)21
3.2.2Aktualisierung der Position (Notwendigkeit zur Bewegungserfassung)22
3.2.3Dauer der Lokalisierungsanfrage22
3.2.4Verbreitung der notwendigen Endgeräte23
3.3NETZWERKBASIERENDE LOKALISIERUNGSVERFAHREN23
3.3.1Cell of Origin23
3.3.2Cell Global Identity - Timing Advance24
3.3.3Time Of […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Vorgehensweise und Aufbau
2 Entwicklung der Mobilfunktechnologien
2.1 Abgrenzung drahtlose und mobile Kommunikation
2.2 Geschichte der Mobilkommunikation
2.2.1 Die Jahrhundertwende – Start der drahtlosen Kommunikation
2.2.2 Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg
2.2.3 Das Zeitalter von GSM
2.2.4 Ein weltweit einheitlicher Standard für zukünftige Telekommunikation
2.2.5 Optimierung der Datenübertragung bei GSM
2.3 Mobilfunksysteme in Generationen
2.3.1 1. Generation (analog)
2.3.2 2. Generation (digital)
2.3.3 3. Generation (multimedial)
2.3.4 4. Generation
3 Lokalisierungstechniken im Vergleich
3.1 Definition Location Based Services
3.2 Anforderung an die Technik
3.2.1 Genauigkeit (Accuracy)
3.2.2 Aktualisierung der Position (Notwendigkeit zur Bewegungserfassung)
3.2.3 Dauer der Lokalisierungsanfrage
3.2.4 Verbreitung der notwendigen Endgeräte
3.3 Netzwerkbasierende Lokalisierungsverfahren
3.3.1 Cell of Origin
3.3.2 Cell Global Identity – Timing Advance
3.3.3 Time Of Arrival
3.4 Endgerätebasierende Lokalisierungsverfahren
3.4.1 Global Positioning System
3.4.2 Assisted Global Positioning System
3.4.3 Enhanced Observed Time Difference
3.5 Mobile Positioning Center
3.6 Verarbeitung der Positionsinformation
4 Staatliche Lokalisierungsinitiativen
4.1 Verbesserung der mobilen Notruf-Qualität in den USA
4.1.1 Basisdienste für mobile Notrufe
4.1.2 Anforderungen E911 Phase 1
4.1.3 Anforderungen E911 Phase 2
4.1.3.1 Anforderungen an endgerätebasierende Technologien
4.1.3.2 Anforderungen an netzwerkbasierende Technologien
4.2 Verbesserung der mobilen Notruf-Qualität in der EU
4.2.1 Coordination Group on Access to Location Information by Emergency Services
4.2.2 Zeitplan und Probleme
5 Anwendungsmöglichkeiten
5.1 Location Based Services in Zahlen
5.1.1 Strategis Group
5.1.2 AirFlash
5.2 Die Lokalisierung als ein Erfolgsfaktor mobiler Applikationen
5.3 Information
5.3.1 Verkehr
5.3.1.1 Stau
5.3.1.2 Routenplanung
5.3.1.3 Mapping
5.3.2 Regionalinformationssysteme
5.3.3 Kaufinformation
5.3.3.1 Shopfinder
5.3.3.2 Lokale Preisvergleiche
5.3.3.3 Werbung
5.3.4 Tourismus
5.3.4.1 Tourismusinformationen
5.3.4.2 Elektronische Führung
5.4 Abrechnung
5.5 Sicherheit
5.5.1 Notrufdienste
5.5.1.1 Straßendienste
5.5.1.2 Family Safety
5.5.1.3 Lone Worker Safety
5.5.2 Objektverfolgung
5.6 Steuerung
5.6.1 Arbeitskräftesteuerung
5.6.2 Flottenmanagement
5.7 Entertainment
5.7.1 Entertainment als Erfolgsfaktor am Beispiel i-Mode
5.7.2 Spiele
5.7.3 Mobile Community
6 Kritische Betrachtung
7 Zusammenfassung und Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: GSM Nutzer Weltweit 96-00
Abbildung 2: Mobiltelefonie-Generationen
Abbildung 3: Zellgrößen bei UMTS
Abbildung 4: Übertragungsgeschwindigkeiten
Abbildung 5: CGI und CGI+TA - Funktionsweise und Unterschiede
Abbildung 6: Aufbau Global Positioning System
Abbildung 7: Funktionsweise A-GPS
Abbildung 8: Funktionsweise E-OTD und UL-TOA
Abbildung 9: Ericsson Mobile Positioning System
Abbildung 10: Der europäische Location Based Service Markt
Abbildung 11: Europäische Location Based Service User
Abbildung 12: Erfolgsfaktoren für mobile Dienste
Abbildung 13: Optimierung des Erfolgspotentials mobiler Dienste
Abbildung 14: Verschiedene Tarife für ein Mobiltelefon
Abbildung 15: Zonenkonzept von Viag Interkom
Abbildung 16: Angebote und Nachfrage von i-Mode Diensten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„ A lot of dreams of mcommerce are not ever going to be fulfilled until location services
are up and available.”
(Bob Egan, Gartner Group Analyst)
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Mobilfunkbetreiber befinden sich durch hohe Investitionen in Netze und in Lizenzen für zukünftige Übertragungsstandards heute unter starkem Kostendruck. Die Mobilfunk-Penetration der Bevölkerung hat ein Maß angenommen, welches in Zukunft nur noch moderate Wachstumsraten ermöglicht. Neukundengewinnung und Kundenbindung sind mit hohen zusätzlichen Werbekosten verbunden. Darüber hinaus leiden die Netzbetreiber unter sinkenden Preisen und Gewinnmargen in den Bereichen der Sprachtelefonie.[1]
Diese hohe Kostenbelastung drückt die Gewinnaussichten der Netzbetreiber und schlägt sich in der schlechten Kapitalmarktsituation der gesamten Telekommunikationsbranche nieder.
Aus dieser Lage heraus suchen die Netzbetreiber nach Lösungen zur Differenzierung und Erschließung neuer Umsatzmöglichkeiten.[2]
Doch nicht nur die Netzbetreiber, auch die Endgerätehersteller und die Lieferanten der Netzinfrastruktur suchen verstärkt nach Lösungen, mit denen sie sich vom harten Wettbewerb abheben und neue Umsatzquellen erschließen können.
Standortbasierte Dienste, Location Based Services, können nach Aussage von Marktforschungsunternehmen eine vielversprechende Lösung sein, die Akzeptanz mobiler Internetangebote zu fördern und neue Umsätze zu ermöglichen.[3]
1.2 Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, prüfen zu können, ob diese Erwartungshaltung in standortabhängige Dienste berechtigt und sinnvoll ist. Um dem Leser einen Überblick über den Gesamtkontext der Location Based Services zu geben, werden die wesentlichen Bereiche Historie, Lokalisierungstechniken, regulatorische Aspekte sowie Applikationen vorgestellt und beschrieben.
Die Location Based Services werden zum besseren Verständnis in den Gesamtkontext der Mobilkommunikation und den darin entstehenden Applikationen eingeordnet.
Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Beschreibung der verschiedenen Lokalisierungstechnologien und deren Funktionsweise. Dieses Verständnis dient im Gesamtkontext als Grundlage für den Hauptschwerpunkt der Arbeit, der Analyse der Applikationen, die durch die Nutzung der gewonnen Standortinformationen entstehen können.
Darüber hinaus werden die kritischen Aspekte der Location Based Services vorgestellt, um im Gesamtkontext die Basis für eine differenzierte Prüfung der Eingangsfragestellung zu schaffen.
1.3 Vorgehensweise und Aufbau
Nachdem im ersten Kapitel die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit dargestellt wurden, wird im zweiten Kapitel die Entwicklung der Mobilfunktechnologien beschrieben. Zuerst wird die Geschichte der Mobilkommunikation chronologisch beleuchtet, um danach die Mobilfunksysteme in Generationen aufzuteilen.
In Kapitel drei werden Location Based Services definiert und die verschieden Lokalisierungstechniken beschrieben. Hierbei werden zuerst die wesentlichen Bewertungskriterien vorgestellt und danach die Technologien in ihrer Funktionsweise kategorisiert. Das Kapitel schließt mit einem beispielhaften Aufbau eines Lokalisierungssystems.
Die regulatorische Initiative E911 zur Verbesserung der Notrufqualität in den USA, die als ein Treiber der Location Based Services gilt, wird zusammen mit einer vergleichbaren Initiative der Europäischen Union (E112) in Kapitel vier der vorliegenden Arbeit vorgestellt.
Der inhaltliche Schwerpunkt, die Beschreibung der aus der Nutzung der Standortinformation entstehenden Anwendungsmöglichkeiten, liegt in Kapitel fünf. Nach einer Vorstellung ausgewählter Zahlen über das prognostizierte Potential der Location Based Services und einer Beschreibung der Erfolgsfaktoren mobiler Applikationen werden die Anwendungsmöglichkeiten in einzelnen Kategorien beschrieben.
Die Kategorien gliedern sich in die Hauptbereiche Information, Abrechnung, Sicherheit, Steuerung und Entertainment.
In Kapitel sechs werden die Location Based Services, insbesondere die Lokalisierung, kritisch betrachtet und hinterfragt.
Kapitel sieben fasst die gewonnenen Erkenntnisse noch einmal zusammen und stellt ein Fazit über das gesamte Thema dar.
Aufgrund der besonderen Aktualität und Neuheit der Thematik ist die Literaturlage sehr stark von Informationen aus dem World Wide Web geprägt. Viele Informationen wurden beispielsweise aus redaktionellen Beiträgen und Publikationen von Unternehmensberatungsgesellschaften und Marktforschungsunternehmen gewonnen. Darüber hinaus dienten oftmals Informationen von Unternehmen, die Lösungen in den einzelnen beschriebenen Bereichen anbieten, als Basis und Informationsquelle für die durchgeführten Untersuchungen.
Der Großteil der genutzten Informationen stand ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.
Der Begriff Location Based Services findet sich in nahezu allen bedeutenden Quellen als Eigenname in der dargestellten Schreibweise und wird deshalb auch in dieser Arbeit in der oben genannten Schreibweise verwendet.
2 Entwicklung der Mobilfunktechnologien
2.1 Abgrenzung drahtlose und mobile Kommunikation
Für ein genaueres Verständnis der verschiedenen in dieser Arbeit angesprochenen Technologien und der daraus entwickelten Applikationen[4]ist es notwendig, die Begriffe drahtlos und mobil von einander abzugrenzen.
Die Begriffe drahtlos und mobil lassen sich folgendermaßen unterscheiden.:
Mobilität bezieht sich oft auf den flexiblen Standort des Nutzer eines Kommunikationssystems oder auf den flexiblen Einsatzort eines Kommunikationsgeräts.[5]
Der Begriff drahtlos wird ausschließlich im Hinblick auf die Kommunikationsart der Geräte eingesetzt.
„Drahtlose Kommunikation beschreibt lediglich den Zugriff auf ein Kommunikationsnetz bzw. den Austausch von Daten mit einem Kommunikationspartner, ohne dass hierfür ein Draht oder eine Glasfaser eingesetzt wird.“[6]
Bei der drahtlosen Kommunikation werden beispielsweise elektromagnetische Wellen durch den Raum zum Transport der Daten eingesetzt. Leitungsgebundene Kommunikation, im Gegensatz zur drahtlosen Kommunikation, erfordert ein Medium (z.B. Draht oder Glasfaser) zum Transport der Daten.
Zur Verdeutlichung der Abgrenzung werden im folgenden die vier Kategorien vorgestellt, zu denen ein Kommunikationsgerät gezählt werden kann.:[7]
- Fest und leitungsgebunden
z.B. Arbeitsplatzrechner, die zu groß sind, um mobil genutzt zu werden. Die Kommunikation erfolgt hierbei über Festnetze.
- Mobil und leitungsgebunden
In diese Kategorie fallen die meisten der heute verwendeten Notebooks und Laptops. Die reisenden Nutzer tragen diese Rechner in der Regel von einem Ort zum nächsten (z.B. Hotel), nutzen aber dort wieder Festnetze zur Kommunikation. (Nutzer, die drahtlose Netze zur Kommunikation ihres Notebooks einsetzen, sind heute noch selten.)
- Fest und drahtlos
Geräte, die beispielsweise in historischen Gebäuden installiert sind, aber aufgrund baulicher Gründe nicht über ein leitungsgebundenes Netz kommunizieren, fallen unter diese Kategorie.
- Mobil und drahtlos
Geräte der letzten hier vorgestellten Kategorie sind für diese Diplomarbeit die interessantesten. In diese Klasse fallen z.B. Mobiltelefone. Sie sind selbst mobil und kommunizieren über ein drahtloses Netz, wie z.B. das GSM-Mobilfunknetz. Der Fokus der weiteren Arbeit liegt auf Techniken und Anwendungen für diese Gerätekategorie.
2.2 Geschichte der Mobilkommunikation
Der Wunsch, Informationen drahtlos zu übertragen, ist schon so alt wie die Nachricht über die Einnahme Trojas 1148 v. Chr., die mit Lichtzeichen offener Feuer 450 km weit über die Ägäis übertragen wurde.[8]
In den folgenden Kapiteln wird zuerst die geschichtliche Entwicklung in der drahtlosen Kommunikation dargestellt. Danach werden die verschiedenen Generationen[9]der Mobilkommunikation erläutert.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit beschränken sich die Darstellungen auf die für das Verständnis notwendigen Elemente aus Sicht der Betriebswirtschaft. Technische Aspekte werden aus diesem Grund nur oberflächlich behandelt.
2.2.1 Die Jahrhundertwende – Start der drahtlosen Kommunikation
Die hier beschriebene Geschichte der drahtlosen Kommunikation beginnt mit der ersten Demonstration einer drahtlosen Telegrafieübertragung von Guglielmo Marconi (1874-1937) im Jahre 1895. Diese Übertragung erfolgte mit Hilfe von Langwellen[10]und einer sehr hohen Sendeleistung (über 200 kW).
Nachdem im Jahr 1901 erstmalig eine Verbindung über den Atlantik getestet wurde, nahm man 1907 die erste kommerzielle Transatlantikverbindung in Betrieb. Hierzu waren noch 30 Antennenmasten mit jeweils 100 m Höhe auf beiden Seiten der Verbindung notwendig.
Die erste drahtlose Sprachverbindung wurde 1915 zwischen New York und San Francisco in Betrieb genommen.
Bisher waren für die Kommunikation noch sehr hohe Sendemasten und eine hohe Sendeleistung notwendig. 1920 war es wieder Marconi, der die Kurzwellenübertragung[11]entdeckte. Die Kurzwellenübertragung bietet für die drahtlose Kommunikation einen entscheidenden Vorteil zur Reduzierung der Antennengröße und Sendeleistung. Kurzwellen werden von der Ionosphäre[12]reflektiert, so dass es möglich war, mit geringerer Sendeleistung Nachrichten um die ganze Welt zu senden.
Das erste Zugtelefon war auf der Strecke Berlin-Hamburg verfügbar, wobei parallel zur Strecke gespannte Drähte als Antenne genutzt wurden.
1928 wurden verschiedene Feldversuche für Fernsehübertragungen durchgeführt. So übertrug z.B. John L. Baird (1888-1946) Fernsehsignale über den Atlantik und demonstrierte wenig später das erste Farbfernsehen.
In diesem Jahr begannen auch die ersten regelmäßigen Fernsehübertragungen und Fernsehnachrichten in den USA.
2.2.2 Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg
Durch die Zerstörung der Infrastruktur der leitungsgebundenen Kommunikation gewann während und nach dem zweiten Weltkrieg die mobile Kommunikation wesentlich an Bedeutung.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland und international viele Projekte im Bereich der drahtlosen Kommunikation gestartet.
Das erste Mobilfunknetz in Deutschland startete 1958. Dieses sog. A-Netz verwendete eine Trägerfrequenz[13]von 160 Mhz und eine analoge Datenübertragung.
Verbindungen konnten im A-Netz nur von einem Mobiltelefon begonnen werden. Die Übergabe eines Gesprächs von einer Basisstation (festen Sendeeinrichtung) auf eine andere, ein sog. Handover[14], war nicht möglich.
Das A-Netz besaß 1971 ca. 11.000 Kunden bei einer Flächendeckung von ca. 80 Prozent.
Das nachfolgende B-Netz wurde 1972 in Betrieb genommen. Es verwendete, wie das A-Netz eine Trägerfrequenz von 160 Mhz, jedoch war es beim B-Netz möglich, einen Anruf aus dem Festnetz zu initiiern. Hierfür musste jedoch der Aufenthalt des mobilen Teilnehmers bekannt sein. 1979 besaß das B-Netz ca. 13.000 Teilnehmer in Deutschland.
Verfügbar war das B-Netz auch in den angrenzenden Ländern Österreich, Niederlande und Luxemburg.
Die als Vorreiter in der Mobilkommunikation bekannten skandinavischen Länder einigten sich etwa zur gleichen Zeit auf das Nordic-Mobile-Telephone- (NMT-) System. Dieses System arbeitet auf einer Trägerfrequenz von 450 MHz.
1986 wurde NMT auf 900 MHz umgestellt, allerdings ist in manchen abgelegenen Orten NMT auf 450 Mhz noch heute die einzige Möglichkeit mobil zu kommunizieren.
Zu dieser Zeit wurden in Europa weitere verschiedene nationale Standards entwickelt, so dass zu Beginn der achtziger Jahre mehrere inkompatible analoge Mobilfunksysteme in Europa parallel existierten.
Mit Blick auf die Idee einer Europäischen Union wurde 1982 ein paneuropäischer Mobilfunkstandard ins Leben gerufen. Dieser Standard sollte vollkommen digital arbeiten und Sprach- und Datendienste anbieten. Er sollte auf Trägerfrequenzen um 900 Mhz arbeiten und Roaming[15]ermöglichen. Um diesen Standard zu entwickeln, wurde die Groupe Speciale Mobile (GSM) gegründet.
Da GSM sich noch in der Entwicklung befand, startete 1985 das C-Netz, ein weiteres analoges Funknetz, in Deutschland.
Das C-Netz arbeitete bei 450 Mhz, ermöglichte eine automatische Lokalisierung der Mobilstation, sowie Handover. Im C-Netz waren auch Fax und Datendienste integriert.
Um eine gewisse Abhörsicherheit zu gewährleisten, arbeitete das analoge C-Netz schon mit digitalen Signalen zur Abstimmung der Basisstationen und Endgeräte. Die Sprachübertragung erfolgte zwar zerstückelt, aber immer noch analog. Technologisch war das C-Netz zu seiner Zeit das ausgereifteste und komplizierteste. Es hatte 1995 ca. 1 Million Teilnehmer und eine Flächendeckung von fast 100 Prozent.[16]Ende 2000 wurde das C-Netz endgültig abgeschaltet.
2.2.3 Das Zeitalter von GSM
Mit einem Umfang von mehr als 5.000 Seiten wurde 1991 die Spezifikation des GSM-Standards verabschiedet.
Die erste Version von GSM arbeitet bei ca. 900 MHz und bietet 124 Vollduplexkanäle[17].
Darüber hinaus wurden Dienste wie Handover, Roaming, automatische Teilnehmerlokalisierung, Teilnehmer- und Geräteauthentifizierung[18]sowie Datenverschlüsselung auf der drahtlosen Strecke integriert.
Im Bereich der Datenübertragung bietet GSM einen Kurznachrichten-Dienst, den bekannten SMS-Dienst (Short Message Service), sowie Fax und Datendienste mit einer Bandbreite von 9.6 kbit/s.[19]
Die ersten Netze, die den GSM-Standard in Deutschland nutzten waren die D-Netze. Erstmalig ist neben der Deutschen Telekom[20]1992 ein zweiter Anbieter auf den Markt getreten: D2 Mannesmann (heute D2 Vodafone)[21]. Beide Anbieter haben ihr D-Netz parallel zueinander aufgebaut und verfügen mittlerweile über eine nahezu 100 Prozentige Flächendeckung.
1994 wurde GSM von Groupe Speciale Mobile in Global Systems for Mobile Communication umbenannt.
In diesem Jahr ist der dritte deutsche Mobilfunkanbieter E-Plus[22]mit seinem E-Netz gestartet.[23]Das E-Netz arbeitet auf dem GSM-Standard, allerdings im Unterschied zu den D-Netzen, bei 1800 MHz. Es bietet dadurch eine noch bessere Sprachqualität und kleinere Zellgrößen als GSM-Netze, die auf 900 MHz arbeiten.[24]
1998 startete der vierte Netzanbieter in Deutschland Viag Interkom[25]mit einem eigenen E-Netz Angebot. Das sog. E2 arbeitet genauso wie das Netz von E-Plus, allerdings hat Viag Interkom umfangreiche Roaming-Abkommen geschlossen, die den Kunden die Möglichkeit gaben, eines der anderen drei Netze zu nutzen, wenn kein Viag Interkom Netz verfügbar war.[26]
Die D-Netze sind aufgrund ihrer Struktur in den letzten zwei Jahren stark an ihre Kapazitätsgrenze gekommen, so dass die beiden Netzbetreiber (D2 Mannesmann und T-Mobil) zur Entlastung ihres Netzes auch Frequenzen um 1800 MHz nutzen.
Dualband-Mobiltelefone[27]können problemlos zwischen den Frequenzen wechseln, ohne dass der Nutzer Unterschiede bemerkt oder aktiv werden muss.
Aufgrund der Entwicklung von GSM400 (GSM auf 450 MHz) und den lokalen Besonderheiten der USA (GSM auf 1900 MHz) stehen Netze auf GSM-Basis heute weltweit in vier verschiedenen Frequenzbereichen zur Verfügung.[28]Mit sog. Triband-Mobiltelefonen[29]ist es aber möglich, in nahezu jedem Land der Welt, dass GSM Netze anbietet, zu telefonieren, sofern ein entsprechendes Roaming-Abkommen zwischen den jeweiligen Netzbetreibern besteht.
Im März 2001 gab es über 488 Millionen GSM-Nutzer in 168 Ländern.[30]
Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der GSM Nutzerzahlen in der Zeit von Dezember 1996 bis Dezember 2000.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: GSM Nutzer Weltweit 96-00; Quelle: http://www.gsmworld.com/membership/graph2.html (Stand 23.04.01).
In den USA haben sich zu gleicher Zeit drei weitere inkompatible Mobilfunkstandards etabliert, auf die hier allerdings aufgrund der Komplexität nicht eingegangen wird. Genauso wenig werden die verschieden Nahbereichsfunktechnologien wie z.B. Bluetooth[31]sowie die satellitengestützte Mobilkommunikation (z.B. Iridium[32]) beschrieben. Für das Verständnis der Thematik der Location Based Services sind diese Techniken ohne Bedeutung.
2.2.4 Ein weltweit einheitlicher Standard für zukünftige Telekommunikation
Die 1998 in Europa erreichte Einigung auf das Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) als Kommunikationssystem, war ein weiterer bedeutender Schritt.
UMTS war der europäische Vorschlag für das International Mobile Telecommunications-2000-Programm (IMT2000) der International Telecommunication Union (ITU[33]).
Dieses Programm beinhaltet ein weltweit einheitliches Rahmenwerk für zukünftige Telekommunikationstechnologien im Frequenzbereich von 2000 MHz.[34]Sofern noch einige ungeklärte Fragen bezüglich der verfügbaren Frequenzbereiche geklärt werden, gibt es die Hoffnung, mit UMTS einen weltweit einheitlichen Standard für zukünftige Kommunikationssysteme zu haben. Die Besonderheiten und Möglichkeiten von UMTS werden im Kapitel 2.3.3 skizziert.
Die ersten kommerziellen UMTS-Angebote werden 2001 in Liechtenstein und der Isle of Man erwartet. Außerdem möchte der japanische Netzbetreiber NTTDoCoMo[35]noch 2001 mit dem kommerziellen Betrieb von UMTS in Japan starten.[36]
2.2.5 Optimierung der Datenübertragung bei GSM
Da GSM in der ursprünglich standardisierten Bandbreite mit 9.6 kbit/s nur eingeschränkt für Datenübertragung geeignet ist, wurden Erweiterungen zum GSM Standard entwickelt, die hier kurz beschrieben werden.
Die Netzbetreiber E-Plus und D2 Vodafone haben im Jahr 2000 einen High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) Dienst gestartet.[37]HSCSD erweitert die Datenübertragungsrate von GSM durch Kanalbündelung.[38]Mit HSCSD erreicht man durch die Zusammenschaltung von mehreren GSM Kanälen theoretisch 38,4 kbit/s, höchstens allerdings 57,6 kbit/s.
Es besteht jedoch einen Nachteil für mobile Internetdienste. Da HSCSD verbindungsorientiert (circuit switched[39]) arbeitet, bleiben bei typischer Internetnutzung Kapazitäten ungenutzt, da ein Computer Daten in der Regel nicht gleichmäßig, sondern stoßweise überträgt. Dem Nutzer entstehen somit die Verbindungskosten für jeden einzelnen Kanal, auch wenn er ihn gar nicht effektiv nutzt. Außerdem belastet die Kanalbündelung bei HSCSD zusätzlich die Kapazität des Netzbetreibers.[40]Dieses Verfahren ist aus diesem Grunde teuer und unwirtschaftlich.
Aus den oben genannten Gründen resultiert, dass die meisten Netzbetreiber HSCSD gar nicht erst eingeführt, sondern den nächsten GSM basierenden Schritt General Packet Radio Service (GPRS) eingeführt haben. GPRS wurde im 1. Quartal 2001 von allen vier deutschen Netzbetreibern kommerziell gestartet und somit die Leistungsfähigkeit des GSM-Netzes stark erhöht.
Im Gegensatz zu HSCSD oder zum ursprünglichen GSM Standard, verwendet GPRS eine paketorientierte Übertragung. Mit GPRS wird ein Datentransferdienst angeboten, der kompatibel zum verbindungslosen, paketorientierten Schema des Internet mit dem Internet Protokoll (IP) ist.[41]GPRS ermöglicht außerdem eine „always-on“ Verbindung und bietet eine volumenabhängige Berechnung der übertragenen Daten. Der Nutzer kann z.B. permanent online sein, um e-Mail etc. zu empfangen, bezahlt jedoch nur die übertragene Datenmenge anstelle der verbrachten Onlinezeit. Mit GPRS können Übertragungsraten von 9,05 kbit/s bis zu 171,2 kbit/s erreicht werden. Realistisch werden Werte zwischen 40 und 50 kbit/s angestrebt.
2.3 Mobilfunksysteme in Generationen
Mobilfunksysteme werden ihrer Art nach verschiedenen Generationen zugerechnet. Die folgenden Kapitel beschreiben die zuvor erwähnten Systeme mit ihrer Zuordnung zur entsprechenden Generation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Mobiltelefonie-Generationen; Quelle: Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 6.
2.3.1 1. Generation (analog)
Analoge Mobilkommunikationssysteme gehören zur 1. Generation. Die Daten werden vor ihrer Übertragung nicht digitalisiert, das heißt sie werden nicht in bits umgewandelt, sondern analog übermittelt.[42]Dies ist mit dem Unterschied der analogen Information auf einer Schallplatte zur digitalen Information auf einer Compact Disc (CD) zu vergleichen. Analoge Mobilfunknetze bieten besonders im Hinblick auf mobile Datendienste nicht die Möglichkeiten der digitalen Mobilfunknetze. Die Sprachqualität ist merklich schlechter. Zu den Mobilkommunikationssystemen der 1. Generation gehören in Deutschland die A-, B- und C-Netze.
2.3.2 2. Generation (digital)
Digitale Mobilkommunikationssysteme mit ihren verbesserten Datendienstmöglichkeiten und der besseren Sprachqualität werden als 2. Generation bezeichnet.
In Deutschland ist GSM das einzige System der 2. Generation. Da im Kapitel 2.2.3 schon auf die verschiedenen Datendienste von GSM eingegangen wurde, werden diese hier nicht erneut erörtert.
Die am Ende des vorangegangen Kapitels erwähnten Technologien HSCSD und GPRS sind eine Weiterentwicklung von GSM. Da sie auf GSM, einem System der 2. Generation basieren, werden sie als Systeme der 2,5. Generation oder GSM Phase 2+ bezeichnet.
Während HSCSD im Prinzip keine funktionellen Erweiterungen beinhaltet, sind mit GPRS einige zusätzliche Dienste im Netz verfügbar. Neben den bereits kurz erwähnten Merkmalen wie paketorientierte Übertragung und Abrechnung sowie der „always-on“-Verbindung sind Sicherheitsdienste wie Teilnehmerauthentifizierung, Zugangskontrolle und vertrauliche Verarbeitung persönlicher Daten integriert. Darüber hinaus sind auch völlig anonyme Dienste möglich. Diese können eingesetzt werden, sobald kein Rückschluss auf die Identität des Nutzers gegeben sein darf.[43]
Die Übertragungsgeschwindigkeit von GPRS richtet sich nach den Fähigkeiten des Endgerätes und der Kapazität, die im Netz bereitgestellt wird. Realistische Einschätzungen gehen von ca. 43 kbit/s im normalen Betrieb aus.[44]
Um die bestehenden GSM-Netze noch stärker für Datenübertragung nutzbar zu machen und die für GSM maximale Datenrate zu erzielen, wird in den nächsten Jahren die Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE) eingesetzt werden. Diese Technologie erweitert die GSM Zeitschlitze auf eine Kapazität von 48 kbit/s. Damit lassen sich dann je nach Frequenz bis zu 384 kbit/s übertragen.
EDGE wird als Ergänzung zu UMTS in bestehende GSM Netze integriert werden und auch dort zum Einsatz kommen, wo ein UMTS-Netzaufbau nicht lohnenswert ist.[45]
Dadurch können auch ohne UMTS breitbandige Daten mobil übertragen werden.
2.3.3 3. Generation (multimedial)
Wie schon im Kapitel 2.2.4 beschrieben, ist UMTS der europäische Vorschlag für das Mobiltelefonsystem der 3. Generation im Rahmen des IMT-2000 Programmes.
UMTS stellt eine evolutionäre Weiterentwicklung von GSM aus der 2. Generation in ein System der 3. Generation dar.[46]
Die Charakteristika der dritten Mobilfunkgeneration sind z.B.:
- Unterstützung aller Eigenschaften der bisher bestehenden Systeme
- Unterstützung neuer Dienste mit hoher Dienstgüte[47]
- Hohe Kapazität
- Hohe Spektrumseffizienz
- Hohe Sicherheit
Die Anforderungen, die an die dritte Generation gestellt werden, sind z.B.:
- Unterstützung vieler Dienste mit wahlweise kanal- bzw. paketorientierter Übertragung
- Variable Bitraten[48]mit dynamischer Anpassung der Dienstgüte an die aktuellen Möglichkeiten des Funkkanals
- Einsatz in unterschiedlich großen Zellen (macro, micro, pico[49]) für Indoor- und Outdoor-Anwendungen
- Fortgeschrittene Mobilitäts-Charakteristika (z.B. Roaming)
- Flexibles Frequenzmanagement etc.
UMTS soll als erstes System ein Roaming mobiler Teilnehmer bei bestehenden Verbindungen mit Handover zwischen Netzen unterschiedlicher Einsatzbereiche und verschiedener Betreiber ermöglichen.
UMTS nutzt im Vergleich zu den bisherigen Mobilkommunikationssystemen eine neue Übertragungsart, eine breitbandige Modulation[50]und neue Funkfrequenzen. Somit werden für UMTS neue Sende- und Empfangsanlagen notwendig.
Ein großer Vorteil bei UMTS ist die Entkoppelung der Netzstruktur vom eigentlichen Funkverfahren. Somit können sich beide Bereiche (Netzstruktur und Funkverfahren) kontinuierlich weiterentwickeln, wobei die Zusammenarbeit sichergestellt ist.[51]
UMTS wird häufig synonym Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) genannt. WCDMA ist das bei UMTS genutzte Verfahren zu Modulation. Es beruht nicht mehr wie GSM auf Zeitschlitzen (Time Division), sondern auf einer breitbandigen Nutzung der Frequenz. Die Übertragungsfrequenzen sind bei WCDMA mit fünf MHz 25mal so breit wie bei GSM, welches nur 200 kHz nutzt.[52]
Da dieses Funkverfahren über andere Ausbreitungseigenschaften als GSM verfügt, ist eine neue Netzplanung notwendig. Durch dieses codebezogene[53]Verfahren ergibt sich bei gleichem Aufwand an Frequenzressourcen 30-60 Prozent mehr Zellenkapazität und eine Bedarfsanpassung der Zellen an ihre Nutzer. Nutzer mit hohen Bandbreitenanforderungen gleichen sich mit Nutzern mit geringer Anforderung automatisch aus.[54]Bei Mobilfunksystemen der 3. Generation richtet sich die Übertragungsgeschwindigkeit nach der Anzahl der Nutzer in einer Zelle, der Art der Zelle in der sich die Nutzer befinden und der Entfernung des Nutzers zur Basisstation.[55]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Zellgrößen bei UMTS; Quelle: Siemens (White Paper Mobilität, 2000) S. 30.
Der IMT-2000 unterscheidet die folgenden drei Übertragungsgeschwindigkeiten nach der Zellnutzung:[56]
- 144 kbit/s bei bewegten Fahrzeugen (mit hoher Geschwindigkeit)
- 384 kbit/s in sog. Micro- bzw. Macro-Zellen
- 1,92 Mbit/s auf kurzen Strecken und in sog. Pico-Zellen (stationär)
Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Übertragungsrate im Zeitablauf visuell dar. Der Begriff „Hype“ bezeichnet den theoretisch machbaren und der Begriff „Reality“ den zu erwartenden Wert in der Praxis.:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Übertragungsgeschwindigkeiten; Quelle: Durlacher (Mobile Commerce Report, 1999), S. 13.
Weitere Vorteile der Systeme der 3. Generation sind die z.B., wie schon bei GPRS beschrieben, die paketorientierte Übertragung und die Möglichkeit „always on“ zu sein. Der Nutzer kann bei UMTS sogar zugleich mehrere Datenflüsse nutzen. Er kann parallel Telefonieren, Faxen und Surfen, ohne wegen eines Datentransfers für andere Teilnehmer besetzt zu sein. Ursprünglich leitungsvermittelte und datenvermittelte Verbindungen lassen sich mit UMTS beliebig mischen und gleichzeitig nutzen.[57]
Die Lizenzen zum Aufbau und Betrieb der UMTS-Netze in Deutschland wurden in der Zeit vom 30.07.2000 bis 18.08.2000 in einer Auktion der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP[58]) versteigert. Für die Versteigerung wurden abschließend sieben Bewerber zugelassen, von denen sechs für insgesamt fast 100 Mrd. DM jeweils eine Lizenz mit zwei Frequenzblöcken ersteigert haben.[59]
UMTS–Lizenznehmer in Deutschland[60]:
- T–Mobil 16,70 Mrd. DM
- Mannesmann Mobilfunk (Vodafone) 16,59 Mrd. DM
- MobilCom Multimedia[61](Mobilcom[62], France Télécom[63]) 16,57 Mrd. DM
- Group 3G[64](Telefónica Moviles[65], Sonera[66]) 16,57 Mrd. DM
- VIAG Interkom (British Telecom[67]) 16,52 Mrd. DM
- E-Plus Hutchinson (KPN[68], Bell South[69]) 16,49 Mrd. DM
Auf den genauen Ablauf des Versteigerungsverfahrens mit den einzelnen Runden wird hier nicht weiter eingegangen, da es für die vorliegende Problemstellung nicht von Bedeutung ist.
Die Leistungsfähigkeit von UMTS im Alltag ist noch nicht nachgewiesen. Wie bereits dargestellt, werden die ersten Live-Testbetriebe für 2001 auf der britischen Isle of Man und in Liechtenstein erwartet. In Japan ist geplant, Mitte 2001 den ersten kommerziellen Dienst der 3. Generation starten zu können.
Im Live-Betrieb werden einige schwierige Situationen erwartet. Dazu gehören hohe Geschwindigkeiten der Teilnehmer, hohe Lasten in den Zellen (durch intensive Nutzung oder eine sehr hohe Nutzerzahl) und auch schlechte Witterungsbedingungen. Diese Faktoren beeinträchtigen die Übertragungsrate und damit die Leistungsfähigkeit von UMTS.
An dieser Stelle setzen die Überlegungen und Planungen für Systeme der 4. Generation an.[70]
2.3.4 4. Generation
Zur Entwicklung der Mobilkommunikationssysteme der 4. Generation gibt es bis heute noch sehr wenig Informationen.
Deshalb werden an dieser Stelle nur kurz die wesentlichen Faktoren der auf die 3. Generation folgenden Generation vorgestellt.
Im Gegensatz zu den vorher genannten Generationen gibt es für die 4. Generation keinen zugewiesenen Frequenzbereich und noch keine verabschiedete Definition.
Als wesentliches Merkmal der 4. Generation lässt sich die Verbesserung der Übertragungsgeschwindigkeit herausstellen. Darüber hinaus sollen die Probleme der 3. Generation, wie die Geschwindigkeit der Mobilstationen oder eine hohe Anzahl Teilnehmer in den Zellen, gelöst werden.
In diesem Zusammenhang wird unter anderem über eine starke Verkleinerung der Zellen und den Einsatz von sog. Ad-hoc[71]Netzwerken nachgedacht. So würden die einzelnen Mobilstation gegenseitig in Ad-hoc Netzwerken als Basisstationen auftreten und die Zellen somit relativ klein halten können.[72]
Oftmals wird anstelle der Bezeichnung 4. Generation der Titel Beyond 3G oder Beyond IMT-2000 verwendet. Damit ist unter anderem gemeint, dass die auf die 3. Generation folgenden Systeme mehr eine Integration und Verschmelzung der verschiedenen Funk- und Mobilkommunikationssysteme bedeuten, anstatt ein neues komplett anderes System aufzubauen.[73]
Außerdem beziehen diese Überlegungen auch die Entwicklung von Diensten und Applikationen an der Schnittstelle Endgerät und Nutzer ein. Angefangen bei weiterentwickelten Location Based Services gehen die Entwicklungen auch in die Richtung der „wearable devices“. Über diese tragbaren, intelligenten Endgeräte lassen sich zukünftig Engpässe an der Schnittstelle zwischen Nutzer und Endgerät überwinden.
Die Entwicklung der Systeme der 4. Generation oder Beyond 3G befindet sich momentan noch in den Anfängen, so dass die Nutzer in Europa wahrscheinlich erst ab 2010 von derartigen Systemen profitieren können.[74]
3 Lokalisierungstechniken im Vergleich
3.1 Definition Location Based Services
An dieser Stelle werden Location Based Services kurz definiert, um ein besseres Verständnis der notwendigen Lokalisierung zu bekommen.
“Location-based services (LBS) are services that exploit knowledge about where an information device user is located.”[75]
“Mobile location services are value-added services, which are dependent on information about the user´s position on current networks.”[76]
Unter Berücksichtigung der beiden Zitate lassen sich Location Based Services wie folgt definieren.:
Unter Location Based Services werden Dienste verstanden, die durch die Datenauswertung der aktuellen Position des Nutzers eines mobilen Endgerätes, einen Mehrwert für diesen Nutzer oder einen Dritten schaffen.
3.2 Anforderung an die Technik
Im folgenden Kapitel werden einige maßgebliche Parameter zur Bewertung der verschiedenen, in Kapitel 3.3 und 3.4 beschriebenen, Lokalisierungstechniken vorgestellt.
3.2.1 Genauigkeit (Accuracy)
Verschiedene Arten der Location Based Services erfordern unterschiedliche Grade der Genauigkeit der Standortinformation. Die Positionsbestimmung bei Schiffen oder Fahrzeugen für Navigationszwecke erfordert eine sehr genaue, bis auf wenige Meter korrekte Information, wohingegen bei einer Hotel- oder Geldautomatensuche kleinere Ungenauigkeiten eine untergeordnete Rolle spielen. Da eine höhere Genauigkeit in der Regel mit einem höheren Aufwand und höheren Kosten verbunden ist, unterscheidet man auch zwischen einer Start-Level-Anforderung und einer Massenmarkt-Akzeptanz-Anforderung[77].
3.2.2 Aktualisierung der Position (Notwendigkeit zur Bewegungserfassung)
Der Zeitpunkt zur Standortbestimmung und die mögliche Aktualisierung (Update) des Standortes spielen bei den verschiedenen Location Based Services eine unterschiedlich hohe Rolle. Eine Unterscheidung nach Zeitpunkt der Erfassung kann beispielsweise nach:
- abgehender Verbindung
die Lokalisierung des Endgerätes erfolgt bei Beginn einer vom Endgerät abgehenden Verbindung
- ankommender Verbindung
- während der Verbindung
- ohne Verbindung
- der Aktualisierungshäufigkeit
erfolgen.[78]
Notfallservices[79]und Flottenmanagement[80]haben unterschiedliche Anforderungen an den Zeitpunkt der Lokalisierung. Auf die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Applikationen wird in Kapitel fünf eingegangen.
3.2.3 Dauer der Lokalisierungsanfrage
Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Unterscheidung ist die Zeitdauer für die Ermittlung der Position. Wenn ein Nutzer z.B. per Wireless Application Protocol (WAP) Informationen abrufen möchte, können keine Lokalisierungsverfahren eingesetzt werden, die zur Ermittlung der genauen Position länger als eine Minute benötigen, da die daraus entstehende Wartezeit unzumutbar wäre.
3.2.4 Verbreitung der notwendigen Endgeräte
Einige Lokalisierungsverfahren (endgerätebasierend) benötigen bestimmte Technologien innerhalb der Endgeräte. Um überhaupt eine ausreichend große Zielgruppe mit diesem Service erreichen zu können, ist die Betrachtung der Verbreitung der notwendigen Endgeräte innerhalb der adressierten Zielgruppe von enormer Bedeutung.
3.3 Netzwerkbasierende Lokalisierungsverfahren
Für die Positionsbestimmung mobiler Endgeräte werden verschiedene Technologien entwickelt und verwendet. Diese unterscheiden sich zum Teil maßgeblich in ihrer Funktionsweise und den damit verbundenen Ergebnissen und Kosten.
Bei einem netzwerkbasierendem Verfahren erfolgt die Positionsbestimmung innerhalb des Mobilfunknetzwerks.
Endgerätebasierende Verfahren, auch terminalbasiert genannt, bestimmen die Position im Endgerät. Hierzu muss das Endgerät über eine entsprechende Hardware und Logik verfügen.
3.3.1 Cell of Origin
Das einfachste, schnellste, aber auch ungenaueste Verfahren zur Positionsbestimmung ist das sog. Cell of Origin (COO) Verfahren. Hierbei wird der Standort der gerade vom mobilen Endgerät (Mobilstation) verwendeten Base Transceiver Station (BTS)[81], auch Basisstation genannt, als momentaner Standort angenommen. Der Radius um eine BTS wird hierbei als Zelle (Cell) bezeichnet. Die Größe dieses Radius ist, je nach Einsatzgebiet, unterschiedlich. Innerhalb von Städten sind oftmals sehr viele Zellen nebeneinander, so dass der Radius nur wenige hundert Meter groß ist. In ländlichen Gebieten sind allerdings auch Zellen mit einem Radius von 30 Kilometern üblich.[82]Daraus leitet sich ab, dass mit dem COO Verfahren die Position des Endgerätes nur zwischen 250 m – 30 km genau bestimmt werden kann.[83]
Werden vom Netzbetreiber die Zellen in Sektoren aufgeteilt, so ist eine Positionsbestimmung nicht mehr nur im Gesamtradius, sondern für einen Sektor der Zelle, beispielsweise für ein Drittel der Fläche, möglich.[84]
Die Vorteile des COO Verfahrens liegen in der schnellen Verfügbarkeit, da die Netze nicht erst teuer aufgerüstet werden müssen, und der Nutzungsmöglichkeit aller momentan verbreiteten GSM-Endgeräte. Außerdem erfolgt die Positionsbestimmung in der Regel innerhalb von drei Sekunden.[85]
Für COO wird oft auch synonym Cell Global Identity (CGI) oder nur Cell Identity (Cell-ID) verwendet.
3.3.2 Cell Global Identity – Timing Advance
Um die Genauigkeit des vorher beschriebenen COO Verfahrens zu erhöhen, zieht man die sog. Timing Advance (TA) als einen zusätzlichen Parameter zur Positionsbestimmung hinzu. Die TA ist ein Parameter der die Signallaufzeit von der Mobilstation zur Basisstation kompensiert. Dies ist nötig, da die verfügbaren Zeitschlitze im GSM-Netz so eng sind, dass es ohne die TA zu Störungen kommen würde. Die TA ist direkt von der Entfernung abhängig und kann 64 Werte in 550 m Schritten annehmen.[86]Durch die Auswertung der TA kann man daraus unmittelbar die Entfernung zwischen Basisstation und Mobilstation ableiten.[87]
Diese Zusatzberechnung erlaubt in größeren Zellen eine genauere Positionsbestimmung als die COO. Der Aufenthaltsort kann auf ein Segment eines Kreisringes mit einer Breite von 150 m – 1 km (meist 550 m) eingegrenzt werden.
Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in der Nutzungsmöglichkeit der bestehenden Endgeräte, die nicht modifiziert werden müssen, und den geringen Aufrüstkosten des Netzwerkes. Die Positionsbestimmung erfolgt bei dieser Methode innerhalb von ca. fünf Sekunden.[88]
Die folgende Grafik veranschaulicht die Verbesserung der Positionsbestimmung durch die Ermittlung des Kreisringes.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: CGI und CGI+TA - Funktionsweise und Unterschiede; Quelle: Swedberg (Ericsson´s mobile location solution, 1999), S. 218.
3.3.3 Time Of Arrival
Die Positionsbestimmung durch das Time Of Arrival (TOA) oder synonym Uplink Time of Arrival (UL-TOA) Verfahren erfolgt durch die Messung und Peilung der Signallaufzeiten. Hierbei wird die Differenz der Signallaufzeit vom mobilen Endgerät zu drei verteilten BTS gemessen und analysiert.
Zur genauen Analyse ist allerdings die Synchronisierung des Mobilfunknetzes durch eine Referenzzeit notwendig. Diese dient als Basis für die Differenzberechnung.[89]Die Referenzzeit wird von sog. Location Measurement Units (LMU) geliefert, die die Zeit beispielsweise per GPS[90]erhalten.
Um eine sinnvolle Positionsbestimmung über eine Peilung durchführen zu können, muss das Signal der Mobilstation von mindestens drei BTS (mit Referenzzeit) empfangen und ausgewertet werden.
Das führt jedoch dazu, dass der Netzbetreiber eine sehr hohe Anzahl LMUs im Netzwerk installieren und betreiben muss. Dadurch entstehen bei diesem Lokalisierungsverfahren sehr hohe Kosten für den Netzbetreiber.[91]
Vorteilhaft bei diesem Verfahren ist die Kompatibilität mit allen mobilen GSM Endgeräten, da diese ohne Modifizierung genutzt werden können. Ein Computer (Mobile Location Center, MLC) im Netzwerk bestimmt anhand der Differenz der Signallaufzeiten vom Endgerät zu den BTS und den bekannten Koordinaten der BTS die exakte Position des mobilen Endgerätes. Zusätzlich erlaubt das Verfahren eine Abschätzung der Unsicherheit der Positionsbestimmung. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung über TOA ist abhängig von der Zahl der Messstationen und den örtlichen Gegebenheiten. Während das Verfahren in ländlichen Gebieten in der Regel eine Genauigkeit von 50 m erlaubt, ist in städtischen Gebieten meist eine Unsicherheit von 150 m gegeben.[92]
Die Positionsbestimmung erfolgt bei TOA innerhalb von zehn Sekunden.
Abbildung 8 veranschaulicht das Funktionsprinzip von UL-TOA.
Die Definition des TOA Verfahrens findet sich im Annex B von GSM 03.71 der GSM-Spezifikation.[93]
3.4 Endgerätebasierende Lokalisierungsverfahren
Bei endgerätebasierenden Verfahren erfolgt die Positionsbestimmung im jeweiligen Endgerät. Um die Positionsdaten innerhalb des Services nutzen zu können, müssen die Standortinformationen vom Endgerät über das Netzwerk an den jeweiligen Dienstanbieter übertragen werden.
3.4.1 Global Positioning System
Das Global Positioning System (GPS) ist ein satellitengestütztes Positionsfunksystem. Es wurde ursprünglich, unter dem militärischen Namen Navigation Satellite Timing and Ranging (NAVSTAR), zur hochgenauen Standortbestimmung im Rahmen von militärischen Anwendungen im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums entwickelt. Mittlerweile wird GPS als Navigationssystem in der Schifffahrt, für Flugzeuge und Fahrzeugflotten eingesetzt.
Das GPS besteht aus 24 Satelliten (space segment), sechs Bodenstationen (control segment) zur Überwachung und Korrektur der gesendeten Satellitendaten und einem GPS-Empfänger (user segment), der die Signale der Satelliten empfängt und die Position bestimmt.[94]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Aufbau Global Positioning System; Quelle: Garmin (GPS Guide, 2000), S. 4.
Jeweils vier Satelliten bewegen sich in sechs verschiedenen Umlaufbahnen in 20.200 km Höhe um die Erde. Durch eine optimale Verteilung der Satelliten sind jederzeit an jedem Punkt der Erde mindestens fünf Satelliten gleichzeitig „sichtbar“.
Jeder Satellit sendet einen typischen Erkennungscode, seine Umlaufbahndaten und eine hochpräzise Uhrzeit. Sobald der GPS-Empfänger die Signale von vier Satelliten empfängt, ist er in der Lage, aufgrund der Signallaufzeitberechnung, die genaue Position (Länge, Breite, Höhe) und Uhrzeit zu bestimmen.
Noch bis vor einiger Zeit sind die GPS-Signale für zivile Nutzer gestört worden, um die Positionsbestimmung auf nur 156 m vertikal und 100 m horizontal zu beschränken. Heute ist es jedoch für alle Nutzer möglich, die Position auf mindestens 27,7 m vertikal und 22 m horizontal genau zu bestimmen.[95]
Mobilfunkgeräte mit eingebauten GPS-Empfänger werden z.B. seit einiger Zeit von der finnischen Benefon Oyj.[96]angeboten.
3.4.2 Assisted Global Positioning System
Ein Hauptproblem bei der Nutzung von GPS zur Positionsbestimmung von Mobiltelefonen ist neben den teuren Endgeräten die schwache Signalstärke der GPS Satelliten. Das führt dazu, dass innerhalb von Umgebungen ohne direkten Sichtkontakt, beispielsweise in Gebäuden oder Straßenschluchten, zur Positionsbestimmung keine ausreichende Signalversorgung besteht.
Für diesen Zweck wurde Assisted-GPS (A-GPS) entwickelt. Bei der Lokalisierung durch A-GPS hilft das Mobilkommunikationsnetzwerk mit GPS-Signalen, so dass für das Endgerät an jedem Ort ausreichend GPS-Signale zur Verfügung stehen.
Um diese Signale anbieten zu können, müssen vom Netzbetreiber Location Measurement Units (LMU) integriert werden. Diese LMU nehmen die GPS Daten der Satelliten auf und senden die relevanten Daten als Netzwerkunterstützung an das Endgerät.
Das Endgerät ermittelt aus den selbst empfangenen und den zusätzlichen Daten die genaue Position, die nun über das Netzwerk an den Dienstanbieter übermittelt wird, um die Location Based Services zur Verfügung zu stellen.[97]
Die Genauigkeit und die Dauer der Positionsbestimmung mit A-GPS sind stark von der nötigen Netzwerkassistenz abhängig. In der Regel erfolgt die Lokalisierung innerhalb von 1 – 60 Sekunden und ist zwischen 25 – 50 m genau.[98]
Die folgende Grafik veranschaulicht die Funktionsweise von A-GPS.
[...]
[1]Vgl. Ovum (Mobile Location Services, 2000), S. 3.
[2]Vgl. Gneiting (Location Based Services, 2000), S. 34.
[3]Vgl. Ovum (Mobile Location Services, 2000), S. 3.
[4]Applikationen werden hier auch synonym mit Anwendungen oder Diensten bezeichnet.
[5]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 17f.
[6]Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 18.
[7]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 18f.
[8]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 12.
[9]Zur Abgrenzung der verschiedenen technischen Evolutionsstufen spricht man in der Mobilkommunikation oft von sog. Generationen.
[10]Siehe Anhang A: Glossar.
[11]Siehe Anhang A: Glossar.
[12]Siehe Anhang A: Glossar.
[13]Siehe Anhang A: Glossar.
[14]Siehe Anhang A: Glossar.
[15]Siehe Anhang A: Glossar.
[16]Vgl. http://nesi.e-technik.tu-darmstadt.de/uli/L/node5.html (Stand 18.04.2001).
[17]Siehe Anhang A: Glossar.
[18]Siehe Anhang A: Glossar.
[19]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 32.
[20]Deutsche Telekom, http://www.dtag.de; Seit 1993 ist die T-Mobil für das Mobilfunkgeschäft der Deutschen Telekom zuständig; T-D1, http://www.t-d1.de
[21]D2 Vodafone, http://www.d2vodafone.de
[22]E-Plus, http://www.eplus.de
[23]Vgl. http://www.gsmworld.com/membership/networks_complete_page.html (Stand 23.04.01).
[24]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation Folien, 2000), Folie 1.15.2.
[25]VIAG Interkom, http://www.viaginterkom.de
[26]Vgl. http://www.viaginterkom.de (Stand 23.04.01).
[27]Siehe Anhang A: Glossar.
[28]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 33.
[29]Siehe Anhang A: Glossar.
[30]Vgl. http://www.gsmworld.com/membership/mem_stats.html (Stand 23.04.01).
[31]The official Bluetooth SIG Website, http://www.bluetooth.com
[32]Iridium – Home, http://www.iridium.com
[33]Welcome to the International Telecommunication Union, http://www.itu.int
[34]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 34.
[35]DoCoMoNet, http://www.nttdocomo.com
[36]Vgl. http://www.heise.de/newsticker/data/klp-04.04.01-001/ (Stand 25.04.01).
[37] Vgl. http://www.teltarif.de/arch/2000/kw47/s3628.html (Stand 25.04.01);
Vgl. http://www.teltarif.de/arch/2001/kw02/s4034.html (Stand 25.04.01).
[38]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 175.
[39]Siehe Anhang A: Glossar.
[40]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 176f.
[41]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 177.
[42]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 6.
[43]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 179.
[44]Vgl. Durlacher (Mobile Commerce Report, 1999), S. 13.
[45]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 18.
[46]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 192.
[47]Siehe Anhang A: Glossar.
[48]Siehe Anhang A: Glossar.
[49]Siehe Anhang A: Glossar.
[50]Siehe Anhang A: Glossar.
[51]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 19.
[52]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 20.
[53]Die Unterscheidung einzelner Gespräche erfolgt nicht frequenz- oder zeitschlitzabhängig, sondern abhängig von einem eindeutigen Code.
[54]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 21.
[55]Siehe Abbildung drei.
[56]Vgl. http://www.tecchannel.de/internet/496/2.html (Stand 26.06.01).
[57]Vgl. Ericsson (Von GSM zu UMTS, 2001), S. 21.
[58]Reg TP - Regulierungsbehoerde für Telekommunikation und Post, http://www.regtp.de
[59]Insgesamt standen zwölf Frequenzblöcke zur Auswahl, von denen ein Lizenznehmer mindestens zwei, höchstens jedoch drei erwerben konnte. T-Mobil und D2 Mannesmann haben bis zum Ende versucht, jeweils eine „große“ Lizenz zu ersteigern um somit einen kleineren Mitbewerber aus dem Markt zu drängen.
[60]Vgl. http://www.regtp.de/aktuelles/pm/00120/index.html (Stand 19.06.01).
[61]MobilCom UMTS, http://www.mobilcom-multimedia.de
[62]MobilCom AG | Willkommen bei der MobilCom AG, http://www.mobilcom.de
[63]Accueil France Telecom, http://www.francetelecom.com
[64]http://www.group3g-umts.de, http://www.group3g-umts.de
[65]Bienvenidos a Telefónica Moviles, http://www.telefonicamoviles.com
[66]Sonera, http://www.sonera.fi
[67]Welcome to BT, http://www.bt.com
[68]www.kpn.com - Welkom bij KPN, http://www.kpn.com
[69]Wellcome to BellSouth.com, http://www.bellsouth.com/
[70]Vgl. Schiller (Mobilkommunikation, 2000), S. 200.
[71]Ad-hoc Netzwerke bezeichnen Netzwerke, die sich selbständig kurzfristig aus den in der Umgebung befindenden Endgeräten aufbauen.
[72]Vgl. Cederquist (New generation demands attention, 2000) zitiert nach http://www.ericsson.se/SE/kon_con/contact/cont17_00/tech.shtml (Stand: 02.05.2001).
[73]Vgl. Rauch (Zukunft von 3G, 2001), S. 18.
[74]Vgl. Rauch (Zukunft von 3G, 2001), S. 20.
[75]http://whatis.techtarget.com/definition/0,289893,sid9_gci532097,00.html (Stand 26.06.01).
[76]Ovum (Mobile Location Services, 2000), S. 1.
[77]Bei der Start-Level-Anforderung geht man davon aus, dass in der Anfangsphase der Dienste eine gröbere Genauigkeit toleriert wird, wohingegen bei der Massenmarkt-Akzeptanz-Anforderung ein höherer Genauigkeitsgrad vorausgesetzt wird.; Vgl. Mobile Lifestreams (Mobile Positioning, 1999), S. 4.
[78]Vgl. Mobile Lifestreams (Mobile Positioning, 1999), S. 4.
[79]Siehe Kapitel 5.5.1.
[80]Siehe Kapitel 5.6.2.
[81]Die Base Transceiver Station oder Basis-Sende- / -Empfangseinheit ist eine Komponente des GSM-Netzes. Die Aufgabe der BTS ist die Herstellung der Funkverbindung zu den mobilen Endgeräten.; Vgl. Lipinski (Lexikon: Mobilkommunikation, 1999) S. 18.
[82]Vgl. http://whatis.techtarget.com/definition/0,289893,sid9_gci509920,00.html (Stand 05.05.01).
[83]Vgl. http://www.cursor-system.com/sitefiles/cursor/tech_technology.htm (Stand 05.05.01).
[84]Siehe Abbildung fünf.
[85]Vgl. http://whatis.techtarget.com/definition/0,289893,sid9_gci509920,00.html (Stand 05.05.01).
[86]Vgl. http://w3.siemens.de/solutionprovider/_online_lexikon/index.htm, Suchbegriff “timing advance” (Stand 19.06.01).
[87]Vgl. Gneiting (Location Based Services, 2000), S. 37.
[88]Vgl. http://www.cursor-system.com/sitefiles/cursor/cursor_techtim.htm (Stand 05.05.01).
[89]Vgl. Gneiting (Location Based Services, 2000), S. 37.
[90]Siehe Kapitel 3.4.1.
[91]Vgl. Mobile Lifestreams (Mobile Positioning, 1999), S. 8.
[92]Vgl. Gneiting (Location Based Services, 2000), S. 37.
[93]Vgl. Mobile Lifestreams (Mobile Positioning, 1999), S. 8.
[94]Vgl. Garmin (GPS Guide, 2000), S. 3.
[95]Vgl. Siemens (White Paper Mobilität, 2000), S. 22.
[96]Benefon Oyj., http://www.benefon.com
[97]Vgl. Piekarski (E911 Location Technology, 1999), Folie 19ff.
[98]Vgl. http://www.cursor-system.com/sitefiles/cursor/cursor_techgps.htm (Stand 29.05.01).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832465971
- ISBN (Paperback)
- 9783838665979
- DOI
- 10.3239/9783832465971
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2003 (März)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- mobilkommunikation umts marketing telekommunikation
- Produktsicherheit
- Diplom.de