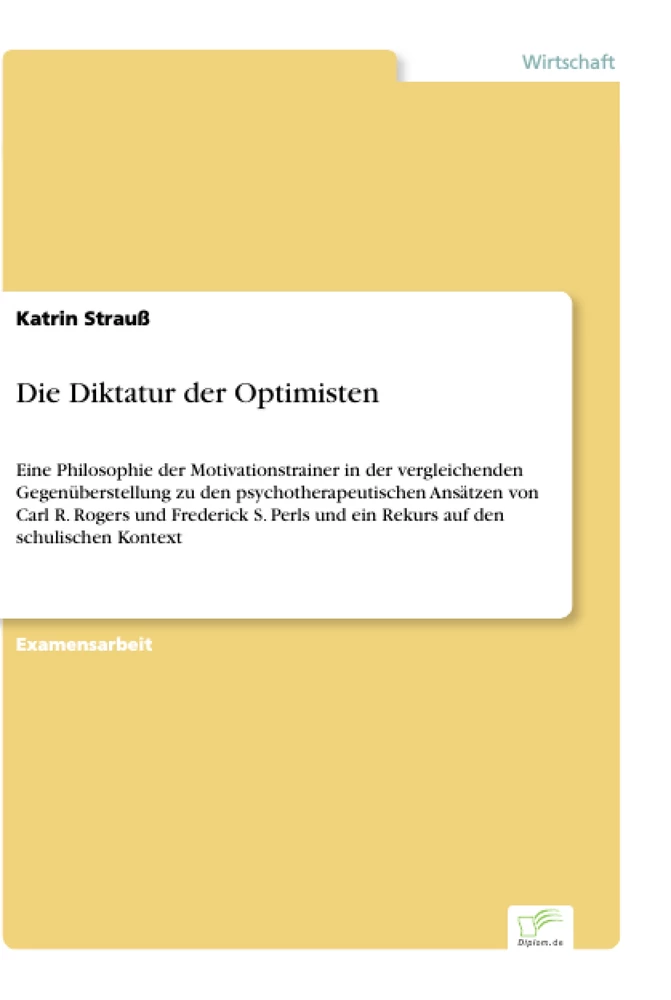Die Diktatur der Optimisten
Eine Philosophie der Motivationstrainer in der vergleichenden Gegenüberstellung zu den psychotherapeutischen Ansätzen von Carl R. Rogers und Frederick S. Perls und ein Rekurs auf den schulischen Kontext
©2002
Examensarbeit
147 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Wie misst du den Erfolg?
Er bedeutet, häufig und viel zu lachen;
die Achtung von intelligenten Menschen zu gewinnen;
die Wertschätzung ehrlicher Kritiker zu gewinnen
und den Betrug falscher Freunde aushalten zu können;
Schönheit schätzen zu können;
das Beste in anderen sehen und finden zu können;
die Welt ein wenig besser zurückzulassen,
sei dies nun durch ein gesundes Kind,
ein blühendes Gartenbeet,
eine soziale Tat oder eine gut gemachte Arbeit;
zu wissen, dass es einem anderen Menschen
freier und leichter ums Herz war,
weil du gelebt hast
das heißt: Erfolg gehabt zu haben (Pastor Charles Swindoll).
Was ist Erfolg? Wer beurteilt den Erfolg? Was bringt Erfolg?
Überlegungen und Anregungen, die eng mit der Thematik Motivation zusammenhängen, denn wozu sollte ein Mensch motiviert sein, wenn er nicht in gewisser Weise Erfolg anstrebt?
Dabei lässt sich nicht klar definieren, was eigentlich unter Erfolg verstanden werden kann. Erfolg kann sich in einem wunderschönen Haus, einem schnellen Auto oder sonstigen Prestigeobjekten äußern. Eine berufliche Spitzenkarriere hingelegt zu haben, Träger eines gesellschaftlich anerkannten politischen oder sozialen (Ehren-)Amtes zu sein oder in der Rolle als Hausfrau und Mutter aufzugehen, kann ebenso Erfolg bedeuten. Erfolgreich mag besonders gelten, wer von anderen Menschen bewundert und bestätigt wird. Wer anderen zur Bereicherung wird: Wenn auch nur einem einzigen Menschen durch meine Tätigkeit, mein Wirken [...] ein Nutzen gegeben wird, bin ich erfolgreich!
Letztendlich entscheidet über den Erfolg jedoch der einzelne Mensch für sich persönlich, geprägt durch seine Selbstachtung und Ethik. [...] vor dem Spiegel geradestehen können und seinen Erfolg nach eigenen Wertmaßstäben bemessen, das schafft die Chance auf ein erfülltes Leben.
Was der eine Mensch als erfolgreich betrachtet, mag den anderen vielleicht frappieren Ansichtssache, je nach den individuellen Wertmaßstäben. Es zählt die Beurteilung des Lebens: erfüllt oder unerfüllt?
Oft lässt sich der Mensch dabei täuschen. Von der Gesellschaft, die sich anmaßt festzulegen, wann ein Mensch das Prädikat erfolgreich verdient hat, von den Mitmenschen, die Sympathie und Antipathie nach dem individuellen Erfolg oder Misserfolg verteilen, von sich selbst, wenn sich die Selbstakzeptanz und liebe am erfolgreichen oder erfolglosen Leben ausrichtet.
Die Ethik der Selbsttäuschung gerät in das Dilemma, in eine Ethik der […]
Er bedeutet, häufig und viel zu lachen;
die Achtung von intelligenten Menschen zu gewinnen;
die Wertschätzung ehrlicher Kritiker zu gewinnen
und den Betrug falscher Freunde aushalten zu können;
Schönheit schätzen zu können;
das Beste in anderen sehen und finden zu können;
die Welt ein wenig besser zurückzulassen,
sei dies nun durch ein gesundes Kind,
ein blühendes Gartenbeet,
eine soziale Tat oder eine gut gemachte Arbeit;
zu wissen, dass es einem anderen Menschen
freier und leichter ums Herz war,
weil du gelebt hast
das heißt: Erfolg gehabt zu haben (Pastor Charles Swindoll).
Was ist Erfolg? Wer beurteilt den Erfolg? Was bringt Erfolg?
Überlegungen und Anregungen, die eng mit der Thematik Motivation zusammenhängen, denn wozu sollte ein Mensch motiviert sein, wenn er nicht in gewisser Weise Erfolg anstrebt?
Dabei lässt sich nicht klar definieren, was eigentlich unter Erfolg verstanden werden kann. Erfolg kann sich in einem wunderschönen Haus, einem schnellen Auto oder sonstigen Prestigeobjekten äußern. Eine berufliche Spitzenkarriere hingelegt zu haben, Träger eines gesellschaftlich anerkannten politischen oder sozialen (Ehren-)Amtes zu sein oder in der Rolle als Hausfrau und Mutter aufzugehen, kann ebenso Erfolg bedeuten. Erfolgreich mag besonders gelten, wer von anderen Menschen bewundert und bestätigt wird. Wer anderen zur Bereicherung wird: Wenn auch nur einem einzigen Menschen durch meine Tätigkeit, mein Wirken [...] ein Nutzen gegeben wird, bin ich erfolgreich!
Letztendlich entscheidet über den Erfolg jedoch der einzelne Mensch für sich persönlich, geprägt durch seine Selbstachtung und Ethik. [...] vor dem Spiegel geradestehen können und seinen Erfolg nach eigenen Wertmaßstäben bemessen, das schafft die Chance auf ein erfülltes Leben.
Was der eine Mensch als erfolgreich betrachtet, mag den anderen vielleicht frappieren Ansichtssache, je nach den individuellen Wertmaßstäben. Es zählt die Beurteilung des Lebens: erfüllt oder unerfüllt?
Oft lässt sich der Mensch dabei täuschen. Von der Gesellschaft, die sich anmaßt festzulegen, wann ein Mensch das Prädikat erfolgreich verdient hat, von den Mitmenschen, die Sympathie und Antipathie nach dem individuellen Erfolg oder Misserfolg verteilen, von sich selbst, wenn sich die Selbstakzeptanz und liebe am erfolgreichen oder erfolglosen Leben ausrichtet.
Die Ethik der Selbsttäuschung gerät in das Dilemma, in eine Ethik der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6401
Strauß, Katrin: Die Diktatur der Optimisten -
Eine Philosophie der Motivationstrainer in der vergleichenden Gegenüberstellung zu den
psychotherapeutischen Ansätzen von Carl R. Rogers und Frederick S. Perls und ein
Rekurs auf den schulischen Kontext
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Staatsexamensarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
,,Dürfen wir da nicht mit ebensoviel Recht diejenigen tadeln, welche den unserer Seele
innewohnenden Trieb zur Betrachtung und Erkenntnis auf Dinge richten, die zu hören oder zu
sehen sich nicht verlohnt, während sie am Guten und Nützlichen achtlos vorbeigehen?
Unsere Sinne zwar verhalten sich den Eindrücken der Außenwelt gegenüber nur passiv und
müssen daher alles aufnehmen, was auf sie eindringt, mag es nun nützlich sein oder nicht.
Wer hingegen seinen Verstand gebrauchen will, kann sich ohne jede Schwierigkeit einem
Gegenstand nach Belieben zuwenden oder sich von ihm abkehren.
Daher soll der Mensch immer nur dem Besten nachjagen, nicht allein, um es zu betrachten,
sondern um durch die Betrachtung innerlich zu wachsen."
1
(nach Plutarch)
1
Zit. n. Berlyne 1974, 13 (Übersetzt aus: Plutarch. Große Griechen und Römer Bd. II. Zürich: Artemis 1955.)
Inhaltsübersicht
Seite
1. Einleitende Gedanken zur
,,Ethik der Selbst[ver]führung"... 8
2. Grundannahmen und traditionelle Denkansätze... 11
2.1 Motiv... 13
2.2 Motivation...15
2.3 Lernmotivation... 16
2.4 Thesen zur Motivation (nach Abraham H. Maslow)... 17
2.4.1 Der Einzelne als ein integriertes Ganzes... 17
2.4.2 Hunger
als
Paradigma...
17
2.4.3 Mittel und Zwecke... 17
2.4.4 Verlangen und Kultur...17
2.4.5 Multiple
Motivationen...18
2.4.6 Motivierende
Zustände...
18
2.4.7 Beziehungen von Motivationen... 18
2.4.8 Triebkatalog...18
2.4.9 Klassifikation des Motivationslebens... 19
2.4.10 Motivation und Ergebnisse aus der Verhaltensforschung an Tieren... 19
2.4.11 Umwelt... 20
2.4.12 Integration... 20
2.4.13 Nichtmotiviertes Verhalten... 20
2.4.14 Möglichkeit von Erlangung... 21
2.4.15 Realitätseinfluss... 21
2.4.16 Wissen über gesunde Motivation... 21
3. Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)... 22
3.1 Die grundlegenden (physiologischen) Bedürfnisse... 22
3.2 Die
Sicherheitsbedürfnisse... 23
3.3 Die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe... 24
3.4 Die Bedürfnisse nach Achtung... 24
3.5 Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung...25
3.6 Maslows Bedürfnishierarchie in der Kritik... 25
4. Die Philosophie der Motivationstrainer... 27
5. Beweggründe für die Suche nach Motivation... 31
6. ,,Mr. Motivation": Jürgen Höller... 34
6.1 Zur
Person... 34
6.2 Die
Erfolgsprinzipien... 37
6.2.1 Erfolg
er-folgt!...
37
6.2.2 Lebe Deine Träume!...39
6.2.3 GAD = Glaube an Dich selbst!... 39
6.2.4 Alles ist möglich!... 40
6.2.5 Ich freue mich!... 41
6.3 Fünf Stufen zum Erfolg... 42
6.3.1 Geist/Materie-Gesetz...
42
6.3.2 Denk-Kategorien...
45
6.3.2.1 Zuschauer des Lebens... 45
6.3.2.2 Verlierer des Lebens...45
6.3.2.3 Gewinner des Lebens... 45
6.3.3 Magnet
im
Bauch...
46
6.3.4 Lebensspiralen...
47
6.3.5 Visionen...48
6.4 Die
Erfolgsstrategie... 49
6.4.1 Die Aufgabe... 49
6.4.2 Das
Ziel...
50
6.4.3 Der
Glaube...
52
6.4.4 Die
Konzentration...
52
6.4.5 Die
Wiederholung...
53
6.4.6 Der
Erfolgsplan...54
6.4.7 Das
Handeln...54
7. Die religiöse Dimension in den Aussagen
von Jürgen Höller... 56
8. Bewertung der Motivationstrainer... 58
9. Die person- bzw. klientenzentrierte Psychotherapie
nach Carl Ransom Rogers (1902 1987)... 61
9.1
Grundbegriffe der person- bzw. klientenzentrierten Psychotherapie... 62
9.1.1 Die
Aktualisierungstendenz...
62
9.1.2 Das
Selbstkonzept...
62
9.1.3 Erleben...
62
9.1.4 Inkongruenz...63
9.2
Die therapeutische Beziehung... 64
9.2.1 Präzises
empathisches
Verstehen...
64
9.2.2 Wertschätzung oder bedingungslose positive Zuwendung... 65
9.2.3 Echtheit oder Kongruenz... 65
9.2.4 Ein transzendentes Phänomen... 66
9.3
Der therapeutische Prozess... 67
9.3.1 Erstes
Stadium...
67
9.3.2 Zweites
Stadium...
67
9.3.3 Drittes
Stadium...
68
9.3.4 Viertes
Stadium...
68
9.3.5 Fünftes
Stadium...
68
9.3.6 Sechstes
Stadium...
69
9.3.7 Siebtes
Stadium...
69
9.4
Grenzen des Ansatzes...71
9.5 Personenzentrierte
Gruppenleiter...73
9.6 Vergleichende
Gegenüberstellung der klientenzentrierten
Psychotherapie und der Erfolgsstrategie von Jürgen Höller...75
10. Die Gestalttherapie
nach Frederick Solomon Perls (1899 1970)... 81
10.1 Gestalttherapeutische
Grundlagen... 83
10.1.1 Homöostase... 83
10.1.2 Holismus... 84
10.1.3 Kontakt... 85
10.2 Die neurotischen Mechanismen... 88
10.2.1 Introjektion... 89
10.2.2 Projektion... 89
10.2.3 Konfluenz... 90
10.2.4 Retroflektion... 91
10.3 Die
Neurose... 92
10.4 Die Hier- und Jetzt-Therapie...95
10.5 Der gestalttherapeutische Prozess... 97
10.6 Techniken der Gestalttherapie...98
10.7 Kritische
Würdigung...100
10.7.1 J. Kovel...100
10.7.2 J. Masson...102
10.7.3 J. E. Dublin...103
10.7.4 I. Yalom...104
10.8 Vergleichende
Gegenüberstellung der Gestalttherapie
und der Erfolgsstrategie von Jürgen Höller...106
11. Versuch einer Synthese:
Klientenzentrierte Psychotherapie und Gestalttherapie... 112
12. Exkurs in die betriebliche Praxis... 114
13. Motivation im Kontext der Schule oder
,,Warum machen wir das eigentlich alles...?"... 118
14. Motivation und Führung im schulischen Alltag... 120
14.1 Stärkung der Gestaltungsfreiheit... 121
14.2 Stärkung von Selbstverantwortung und Empowerment...121
14.3 Vereinbarung gemeinsamer Leitziele... 122
14.4 Entwicklung einer kooperativen und partizipativen Führung... 122
14.5 Umfassende Information und Transparenz der Entscheidungen... 122
14.6 Delegation wichtiger Aufgaben... 123
14.7 Akzeptanz der Pluralität... 123
14.8 Stärkung der Teamentwicklung... 123
14.9 Kooperative Konfliktlösung... 124
14.10 Professionelle Beratungskultur... 124
14.11 Motivierende Führungsqualitäten...125
14.12 Verbesserung des Schulklimas...126
14.13 Stärkung einer innovativen Unterrichtspraxis... 126
15. Selbstmanagement und -motivation
für den einzelnen Lehrer... 129
15.1 Standortbestimmung...130
15.1.1 Lust-Frust-Bilanz...130
15.1.2 Leistungsbilanz...131
15.1.3 Stärken- und Schwächenanalyse...131
15.2 Persönlichkeitsreifung...132
16. Lernmotivation der Schüler... 134
17. Ausblick: ,,Gib nie, nie, nie, nie gib niemals auf!"... 137
Literaturverzeichnis... 139
Erklärung... 145
Einleitende Gedanken zur ,,Ethik der Selbst[ver]führung"
8
1. Einleitende Gedanken zur ,,Ethik der Selbst[ver]führung"
2
,,Wie mißt du den Erfolg?
Er bedeutet, häufig und viel zu lachen;
die Achtung von intelligenten Menschen zu gewinnen;
die Wertschätzung ehrlicher Kritiker zu gewinnen
und den Betrug falscher Freunde aushalten zu können;
Schönheit schätzen zu können;
das Beste in anderen sehen und finden zu können;
die Welt ein wenig besser zurückzulassen,
sei dies nun durch ein gesundes Kind,
ein blühendes Gartenbeet,
eine soziale Tat oder eine gut gemachte Arbeit;
zu wissen, daß es einem anderen Menschen
freier und leichter ums Herz war,
weil du gelebt hast
das heißt: Erfolg gehabt zu haben"
3
(Pastor Charles Swindoll).
Was ist Erfolg? Wer beurteilt den Erfolg? Was bringt Erfolg?
Überlegungen und Anregungen, die eng mit der Thematik ,,Motivation" zusammenhängen, denn
wozu sollte ein Mensch motiviert sein, wenn er nicht in gewisser Weise Erfolg anstrebt?
Dabei lässt sich nicht klar definieren, was eigentlich unter Erfolg verstanden werden kann.
Erfolg kann sich in einem wunderschönen Haus, einem schnellen Auto oder sonstigen
Prestigeobjekten äußern. Eine berufliche Spitzenkarriere hingelegt zu haben, Träger eines
gesellschaftlich anerkannten politischen oder sozialen (Ehren-)Amtes zu sein oder in der Rolle
als ,,Hausfrau und Mutter" aufzugehen, kann ebenso Erfolg bedeuten. Erfolgreich mag
besonders gelten, wer von anderen Menschen bewundert und bestätigt wird. Wer anderen zur
Bereicherung wird: ,,Wenn auch nur einem einzigen Menschen durch meine Tätigkeit, mein
Wirken [...] ein Nutzen gegeben wird, bin ich erfolgreich!"
4
Letztendlich entscheidet über den Erfolg jedoch der einzelne Mensch für sich persönlich,
geprägt durch seine Selbstachtung und Ethik. ,,[...] vor dem Spiegel geradestehen können und
seinen Erfolg nach eigenen Wertmaßstäben bemessen, das schafft die Chance auf ein erfülltes
Leben."
5
2
Rempe 1991, 145
3
Zit. n. Rempe 1991, 146
4
Höller 2000a, 29
5
Rempe 1991, 145
Einleitende Gedanken zur ,,Ethik der Selbst[ver]führung"
9
Was der eine Mensch als erfolgreich betrachtet, mag den anderen vielleicht frappieren
Ansichtssache, je nach den individuellen Wertmaßstäben. Es zählt die Beurteilung des Lebens:
erfüllt oder unerfüllt?
Oft lässt sich der Mensch dabei täuschen. Von der Gesellschaft, die sich anmaßt festzulegen,
wann ein Mensch das Prädikat ,,erfolgreich" verdient hat, von den Mitmenschen, die Sympathie
und Antipathie nach dem individuellen Erfolg oder Misserfolg verteilen, von sich selbst, wenn
sich die Selbstakzeptanz und liebe am erfolgreichen oder erfolglosen Leben ausrichtet.
Die Ethik der Selbsttäuschung gerät in das Dilemma, in eine ,,Ethik der Selbst[ver]führung"
6
zu
münden. Um der Gefahr zu entgehen, sich persönliche Schwächen oder Niederlagen
eingestehen zu müssen, ist der Mensch verführt, Verdrängungsmechanismen in Form der
Leugnung oder Schmälerung zu aktivieren oder sich in verführerische Motivationsangebote zu
flüchten. Im Grunde erreicht er damit, dass er die Selbstführung aus seinen Händen gibt und
anderen Personen die Macht verleiht, das eigene Leben zu regieren. Dies alles für den Preis
der Wertschätzung von außen und der Motivationssteigerung.
All jene Überlegungen gilt es in die Auseinandersetzung mit der folgenden Ausarbeitung zum
Thema:
,,Die Diktatur der Optimisten"
7
Die Philosophie der Motivationstrainer in der
vergleichenden Gegenüberstellung zu den psychotherapeutischen Ansätzen von
Carl R. Rogers und Frederick S. Perls und ein Rekurs auf den schulischen Kontext
einzubeziehen und kritisch zu hinterfragen, ob und vor allem wie der Mensch die
Aufrechterhaltung seiner Motivation zu gewährleisten vermag.
Innerhalb meiner beruflichen Laufbahn wird dies insofern an Relevanz gewinnen, als ich als
Lehramtsanwärterin für berufliche Schulen sowohl den persönlichen Anreiz als auch die
Motivation vonseiten der Schüler, Eltern und Kollegen sicherstellen muss, um mir langfristig
Freude am schulischen Geschehen zu erhalten.
Zu Beginn meiner Arbeit kläre ich Begrifflichkeiten, die sich inhaltlich um den Aspekt der
,,Motivation" gruppieren: Erläuterung der Motive, die die Ausgangsbasis zur Entstehung
motivationaler Bedingungen bilden und der von Abraham H. Maslow entworfenen Thesen zur
Motivation. Während die Lernmotivation für die Übertragbarkeit auf den schulischen Kontext
einer Abgrenzung bedarf, möchte ich die Bedürfnispyramide nach Abraham H. Maslow (1943)
für ein generelles Verständnis der menschlichen Motivation heranziehen und einer kritischen
Würdigung unterziehen.
6
Rempe 1991, 145
7
Schüle 2001a, 13
Einleitende Gedanken zur ,,Ethik der Selbst[ver]führung"
10
In den weiteren Kapiteln gehe ich auf die zugrunde liegende Philosophie der Anbieter von
Motivationsseminaren und im Speziellen auf Jürgen Höller als dem in Deutschland
(erfolg)reichsten Motivationstrainer ein. Neben der Darstellung seiner Biographie, die einen
unabdingbaren Beitrag zum Verständnis seiner Erfolgsstrategie leistet, skizziere ich seine
Erfolgsprinzipien und die von ihm propagierten Stufen zum Erfolg. In einem kurzen Exkurs
beziehe ich Stellung zu der religiösen Dimension in Jürgen Höllers Aussagen, bevor ich eine
umfassende Bewertung der Theorien und der Praxis der Motivationstrainer vornehme.
Der nächste Teil meiner Ausführungen befasst sich mit zwei psychotherapeutischen Ansätzen.
Als Ausgangspunkt wird die person-
bzw. klientenzentrierte Psychotherapie nach
Carl Ransom Rogers (1902 1987) inhaltlich dargestellt und eine vergleichende Gegenüber-
stellung zu der Erfolgsstrategie von Jürgen Höller versucht. In ähnlicher Weise wird danach mit
der Gestalttherapie nach Frederick Solomon Perls (1899 1970) verfahren. Beide Theorien
sollen nach einzelner kritischer Betrachtung im Anschluss dem Versuch einer Synthese
unterzogen werden.
Die Anwendbarkeit in der betrieblichen und schulischen Praxis bildet den letzten Bereich meiner
Arbeit. Die Betonung liegt dabei auf dem Moment der Motivation innerhalb der Schule, worunter
einerseits Aspekte der Führung und Selbstverantwortung und andererseits die Selbstmotivation
der Lehrer subsummiert werden. Obwohl es im Kontext der Schule natürlich auch die Schüler
zu motivieren gilt, behandle ich diese Thematik lediglich oberflächlich, da ich weil in meiner
beruflichen Zukunft vorrangig davon betroffen den Fokus auf die Lehrerseite richte.
Der Ausblick rundet die Ausführungen mit einer etwas unerwarteten Wende im Leben Jürgen
Höllers ab, hält aber dennoch an seinem Plädoyer ,,Gib nie, nie, nie, nie gib niemals auf!"
8
fest.
In diesem Sinne hoffe ich, in meiner Arbeit nicht nur einen Überblick, sondern auch einen
tieferen Einblick in das stets aktuelle und unerschöpfliche Feld der Motivation zu geben und die
in den einführenden Worten aufgeworfenen Fragestellungen zufriedenstellend erfassen zu
können.
8
www.juergenhoeller.com/body_stellungname.html
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
11
2. Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
,,Über Motivation zu diskutieren heißt geradezu, Menschenbilder zu diskutieren."
9
Diese
Menschenbilder implizieren anthropologische Grundannahmen, individuelle Erfahrungen und
den Zeitgeist der jeweiligen Generation. Daher muss jede Definition von Motivation im Kontext
der persönlichen und situativen, historisch bestimmten Gegebenheiten betrachtet werden.
10
Aufgrund der daraus resultierenden Problematik einer verbindlichen und allgemein akzeptierten
Begriffseingrenzung von Motiv und Motivation (lat. motio = Bewegung
11
), möchte ich mich im
Folgenden auf die Ausführungen von Keller (1977)
12
beziehen, der eine Summe an
Definitionsversuchen unterschiedlichster Vertreter liefert.
Allport (1970) beschreibt ,,Motive als jede innere Bedingung, welche das Handeln oder das
Denken der Person induziert"
13
.
Mc Clelland et al. (1953) bestimmen ein Motiv als ,,[...] a strong affective association,
characterized by an anticipatory goal reaction and based on past association of certain cues
with pleasure or pain"
14
.
Ach (1935): ,,Die Motivation umfaßt die Gesamtheit derjenigen bewußten und unbewußten
psychonomen Faktoren, auf Grund derer unser Wollen und Handeln zustande kommt"
15
.
Murphy (1947) definiert Motivation als ,,General name for the fact that an organism`s acts are
partly determined by its own nature or internal structure"
16
.
Heckhausen (1965) umschreibt Motivation als ,,das Wirkungsgefüge vieler Faktoren eines
gegebenen Person-Umwelt-Bezuges, die das Erleben und Verhalten auf Ziele richten und
steuern"
17
.
Im Bezug auf die von mir zu erörternde Thematik empfinde ich die Definition von
Graumann (1969) äußerst treffend: ,,Motivation ist dasjenige in und um uns, was uns dazu
bringt, treibt, bewegt, uns so und nicht anders zu verhalten"
18
.
9
Sprenger 1993, 38
10
Vgl. Sprenger 1993, 38
11
Zit. n. Kunz & Mehler 1989, 27
12
Vgl. Keller 1977, 19 22
13
Zit. n. Keller 1977, 20
14
Zit. n. Keller 1977, 20
15
Zit. n. Keller 1977, 20
16
Zit. n. Keller 1977, 19
17
Zit. n. Keller 1977, 20
18
Zit. n. Keller 1977, 20
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
12
In präzisen Worten grenzt Graumann den Begriff der Motivation ab, indem er die Person und
die Umwelt (,,in und um uns") als verantwortlich für motivationale Einflüsse erklärt.
Motivation kann dabei sowohl intrinsisch als auch extrinsisch bedingt sein. Intrinsisch motivierte
Handlungen werden um ihrer selbst willen getan, weil diese als spannend, interessant oder
herausfordernd erscheinen, wohingegen bei extrinsischer (meist durch äußere Zwänge
erzeugte) Motivation die Ziele inhaltlich nicht mit der Handlung übereinstimmen und negative
Folgen vermieden bzw. positive Folgen herbeigeführt werden sollen.
Ein Mensch verspürt, aufgrund eigener oder von außen herangetragener Anreize, Motivation zu
einem bestimmten Handeln. Zu diesem Handeln wird er ,,gebracht" oder stärker akzentuiert
,,getrieben", indem das Bedürfnis entsteht, intentional genau jenes Verhalten zu zeigen. Die
Bezeichnung ,,bewegen" impliziert die damit verbundene Dynamik. Verhalten passiert aktiv, im
Prozess der erwünschten Zielerreichung. Diese Zielerreichung verfolgt u.a. den Zweck, durch
das erhöhte Leistungsniveau mit verstärkter innerer Beteiligung des Handelnden
19
ein
Selbstkonzept der eigenen Identität zu entwerfen, das wiederum das zukünftige Handeln
beeinflusst. Pongratz (1973) schreibt: ,,[...] Es [das Selbstkonzept; d.V.] hat motivierende, das
Verhalten zu sich und zur Welt bestimmende Kraft. Aus der Art des individuellen
Selbstkonzeptes lässt sich zum Teil das Verhalten voraussagen, denn durch das Selbstkonzept
werden bestimmte Einstellungen erzeugt, die ihrerseits die Wahrnehmung, das Denken und
Verhalten steuern"
20
.
Da in der Literatur die Begriffe ,,Motiv" und ,,Motivation" allerdings eine wenig trennscharfe
Verwendung finden, führe ich die von Weiner (1975) getroffene Differenzierung an.
Ein Motiv bezeichnet bei ihm ,,eine zeitlich relativ stabile Disposition einer Person"
21
, Motivation
oder Motivierung dagegen ,,eine momentane, mehr oder weniger kurzfristige Handlungstendenz
[...], die sich in Abhängigkeit von wechselnden Situationsgegebenheiten schnell ändern kann"
22
.
19
Vgl. Mackowiak 2000, 56
20
Zit. n. Keller 1977, 260/261
21
Zit. n. Keller 1977, 22
22
Zit. n. Keller 1977, 22
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
13
2.1 Motiv
Zur Abgrenzung der Richtung, der Intensität und der Ausdauer menschlichen Verhaltens
müssen Variablen auf der Seite der Person und der Umwelt betrachtet werden.
Der Begriff des Motivs, der unterschiedlichen Ausprägungen unterliegt und ein
wiederkehrendes Anliegen darstellt, dient nach Heckhausen (1974 und 1989) zur Erklärung von
Verhaltensunterschieden zwischen Menschen, die sich in Erwartungen bezüglich Erfolg und
Misserfolg, der Orientierung an Normen und der Wahl an Ursachenfaktoren manifestieren. Die
Bewertungssysteme entsprechen den Person-Umwelt-Bezügen, die erlernt werden müssen,
wobei genetische Faktoren und Reifungsprozesse Einflussfaktoren darstellen. Konsistenzen
und Variabilitäten im Verhalten eines Menschen können danach mit den in verschiedenen
Momenten erlebten Erfahrungen (auch bezüglich der Selbsteinschätzung) erklärt werden. Die
Bewertung verankert sich im Gedächtnis, wenn der Situation eine gewisse Relevanz oder
Allgemeingültigkeit zukommt.
Auch indirekt, z.B. über das Verhalten oder die Aussagen anderer Personen, ist eine
Internalisierung möglich. Nach Tolman (1965) bilden sich Wert-Überzeugungs-Matrizen eine
hierarchische Strukturierung der einzelnen Vorlieben und Abneigungen , auf die bei der
Erwartung einer Bedürfnisbefriedigung gedanklich zurückgegriffen wird. Das Verhalten, aus
dem die Befriedigung resultieren soll, gestaltet sich nach individuellen Charakterzügen im
Prozess der willentlichen Entscheidung, wobei die Motive dazu nicht aktuell auf situative
Konstellationen zurückführbar sind und nicht als Verursachung, sondern als Begründung erfasst
werden müssen. Demzufolge ,,aktiviert, begründet und bestimmt"
23
ein Motiv eine menschliche
Handlung, die ihren Verlauf aufgrund intentionaler Spannung (spontane Motive) oder einem
situativen Anreiz (reaktive Motive) findet und dem Individuum eine ich-zentrierte und reflektierte
Selbstbestimmung und gestaltung eröffnet.
24
Motive können laut Tolman
25
in dreifacher Weise unterschieden werden: primäre Motive (der
Hungertrieb und die damit verbundene Basis der Energie), sekundäre (angeborene und durch
Stimulation aktivierte oder im Lernprozess erworbene) und tertiäre (vom kulturellen Einfluss
abhängige und geformte) Motive.
Ein Motiv ist nach Schiefele (1974) ,,[...] der Oberbegriff für alle Bedeutungen, um deretwillen
eine Person handelt. Was im Zusammenhang mit menschlicher Motivation als Antwort auf die
Frage ,warum?` gesagt werden kann, ist Motiv"
26
.
23
Schiefele 1963, 66
24
Vgl. Liepmann 2000, 55; Meister 1982, 30 35; Schiefele 1963, 64 70; Sprenger 1993, 38
25
Vgl. Schiefele 1963, 64
26
Zit. n. Meister 1982, 30
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
14
Laut Schneider & Schmalt (1994) bezeichnet es ,,latente Verhaltensbereitschaften
(Dispositionen) bzw. Bewertungsvoreingenommenheiten einer Person, die ständig auf ihr
Erleben und Verhalten Einfluß nehmen"
27
, genetisch verankert sind und klassifizierbare
Beweggründe für entsprechendes Handeln darstellen.
Wird ein Motiv in einer bestimmten Situation mit Anreizen gekoppelt, entsteht eine
Motivationstendenz, deren Stärke sowohl aufgrund intraindividueller wie innerorganismischer
Faktoren variiert. So genannte volitionale Faktoren bestimmen, wie und wann bzw. bei welcher
Gelegenheit diese Tendenzen verwirklicht werden.
27
Zit. n. Wegge 1998, 26
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
15
2.2 Motivation
Zu Motivation rechnet Heckhausen (1989)
28
,,[...] alle gedanklichen bzw. emotionalen Prozesse,
die dafür Sorge tragen, daß eine Person ihr Verhalten nach den zu erwartenden
Handlungsergebnissen und deren Folgen ausrichtet und selbst steuert"
29
, wobei erwünschte
und unerwünschte Ergebnisse, Wahrscheinlichkeiten der Realisierung und die Folgewirkungen
in der Überlegung nach dem Erwartungs-Wert-Modell (vgl. Heckhausen 1989) miteinander
verglichen werden. Der Wert und die Chance der Erreichbarkeit entscheiden letztlich über die
Attraktivität des Handlungszieles. Motivation, die situationsabhängig ist, dient dazu, unter
gegebenen Anreizen eine Handlung aufrechtzuerhalten. Diese Anreize Motive liegen häufig
gleichzeitig vor und kollidieren mit Persönlichkeitseigenschaften und situativen Bedingungen.
Meister (1982)
30
führt ein Motivations-Handlungs-Modell an, das in ähnlicher Form auch von
Mackowiak (1998)
31
vertreten wird, das den Prozess der Motivation folgendermaßen beschreibt.
Aufgrund von Anregungsbedingungen, die über die bewusst gewordenen Bedürfnisse
entsprechende durch die subjektive Wahrnehmung und Interpretation festgelegte Motive der
Person aktivieren, bilden sich Erwartungen bzw. Interessen, sowohl kognitiver wie emotionaler
Art (vgl. Definition von Heckhausen). Die agierende Person greift bei der Tätigkeit auf sein
verfügbares Repertoire an Fähigkeiten zurück. Die entsprechenden Tätigkeiten umfassen auch
nicht-beobachtbare Verhaltensweisen und ,,Untätigsein". Zusätzlich fließen in den
Motivationsprozess neben äußeren Bedingungen und Personen, auch Lernvorgänge, die
Sozialisation und individuelle Persönlichkeitsstruktur mit ein.
Anhand individueller oder external vorgegebener Normen bewertet die Person über
Erklärungen von Ursachen und Vergleichen ihr Tun. Entsprechend der Attribution fällt die
Selbstbewertung entweder positiv (die Person schreibt sich selbst den Erfolg zu) oder negativ
(Nichterreichung des angestrebten Zielzustandes wird als persönliches Versagen empfunden)
aus. Neben der Selbstbekräftigung wird die Person auch mit Reaktionen der Außenwelt
konfrontiert (Fremdbekräftigung). Entsteht eine Diskrepanz zwischen der Selbstbewertung und
den vorherigen Intentionen, kann die Handlungsausführung mit dem Ziel, das Soll-Ist-Verhältnis
zu revidieren, erneut folgen. Langfristig wird dieser Bewertungsprozess in das Selbstbild
integriert und trägt somit zu einer Stabilisierung bzw. einer Antizipation bei.
28
Vgl. Meister 1982, 31 36; Wegge 1998, 29 31
29
Zit. n. Wegge 1998, 29
30
Vgl. Meister 1982, 85 90
31
Vgl. Mackowiak 2000, 57 58
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
16
2.3 Lernmotivation
Infolge von Wechselwirkungen zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen des Lernenden mit den
individuellen Fähigkeiten und Motivausprägungen und den in der Situation vorhandenen
Anreizen entsteht Lernmotivation, die in unterschiedlichen Ausprägungen auftritt
(vgl. Heckhausen & Rheinberg (1980)). Pekrun & Schiefele (1996)
32
ergänzen diese Definition,
indem sie eine Unterscheidung zwischen Emotion (,,subjektives Erleben mehrerer
Reaktionskomponenten"
33
) und Motivation (,,(deklarative) Wünsche der Person, ihre Absichten
und die Aktivierung von Verhaltensprogrammen"
34
) vornehmen, während Heckhausen beide
Aspekte unter dem Begriff der Motivation subsummiert.
Relevant für die schulische Lernmotivation nennt Bossong (1978)
35
vier Motive bzw.
Motivgruppen. Der kognitive Trieb verfolgt lediglich das Ziel, den Wissenserwerb zu
ermöglichen. Während die Leistungsmotive Vermeidung von Misserfolgserlebnissen und
Begünstigung von Erfolgsgefühlen anstreben, beziehen sich die Anreizmotive ebenfalls auf
positive Zustände (die verstärkt aufgesucht werden) und negative Zustände (die zu meiden
versucht werden). Das Motiv zur Vermeidung kognitiver Dissonanz dient der Person, zu einer
realistischen möglichst positiven Selbsteinschätzung zu gelangen, indem passende
Leistungsergebnisse erwartet werden.
Bei nicht erbrachten Leistungen auf fehlende Motivation zu schließen, gilt hierbei als
unzulässig, da die ursächlichen Aspekte ein mehrdimensionales, komplexes Gefüge darstellen.
32
Vgl. Wegge 1998, 47 49
33
Zit. n. Wegge 1998, 48
34
Zit. n. Wegge 1998, 49
35
Vgl. Bossong 1978, 13 29
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
17
2.4 Thesen zur Motivation (nach Abraham H. Maslow)
36
2.4.1 Der Einzelne als ein integriertes Ganzes
Die Motivation eines Menschen bezieht sich auf seinen gesamten Körper so wie die
Befriedigung eines Bedürfnisses den Menschen als Ganzes umfasst. Dabei erstreckt sich der
Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung auch auf physiologische und psychologische Funktionen
und Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Erinnerung, Emotionen, Inhalt des Denkens u.a.
2.4.2 Hunger als Paradigma
Der Hunger als physiologischer Trieb (Primärtrieb) unterscheidet sich von den kulturellen
Trieben (Sekundärtrieben) beispielsweise Wünsche nach Geld, Prestige, Freundlichkeit oder
Liebe vor allem durch die vorhandene ,,spezifische, isolierte, lokalisierte somatische Basis"
37
.
Über die Sekundärtriebe lassen sich Charakteristika der allgemeinen menschlichen Motivation
erschließen, wobei dieser Prozess innerhalb dynamischer die Ganzheit des Organismus`
betreffender Zusammenhänge betrachtet werden muss.
2.4.3 Mittel und Zwecke
Gewöhnlich verfolgt jedes Bedürfnis das Ziel, über ein geeignetes Mittel den erwünschten
Zweck zu erlangen. Das Bedürfnis kann als Symptom für ihre Bedeutung, die Intentionen und
Beweggründe des Akteurs und die Richtung und den Endpunkt der Zielerreichung
herangezogen werden. Da allerdings ein bewusstes Verlangen auch die Erreichung eines
indirekt im Bewusstsein befindlichen Zieles impliziert, wird hierbei zusätzlich die unbewusste
Motivation erfasst.
2.4.4 Verlangen und Kultur
,,Die Menschen gleichen einander mehr, als man auf den ersten Blick sieht."
38
Die elementaren menschlichen Bedürfnisse decken sich im Gegensatz zu den alltäglichen
Wünschen annähernd kulturübergreifend.
36
Vgl. Maslow 1977, 55 73
37
Maslow 1977, 57
38
Maslow 1977, 59
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
18
Wegen der in verschiedenen Kulturen vorhandenen breiten Basis an existierenden
Grundbedürfnissen differieren lediglich die Wege der Zielerreichung je nach gesellschaftlichem
Kontext, d.h. das primäre Verlangen der Menschen stimmt unabhängig von der jeweiligen
Kultur überein. Dessen Befriedigung ergibt sich aufgrund der Normen und Werte, innerhalb
deren Rahmen bestimmte Wünsche realisierbar werden, in der kulturellen Interaktion.
2.4.5 Multiple Motivationen
Das Bedürfnis bzw. das Verhalten eines Menschen wird als Ausdruck komplexer,
verschiedenartiger Zweckorientierungen verstanden. Darüber hinaus kann ein Symptom auch
auf mehrere einander entgegengesetzte Wünsche verweisen.
2.4.6 Motivierende Zustände
Jedes Gefühl im Menschen ruft wiederum Wirkungen und Reaktionen in psychischer wie in
physiologischer Hinsicht hervor, die sich auf den gesamten Organismus erstrecken, so ,,[...] daß
Motivation konstant ist, nie endet, fluktuiert, komplex strukturiert ist, und daß Motivation ein fast
universelles Charakteristikum praktisch jedes organischen Zustands ist"
39
.
2.4.7 Beziehungen von Motivationen
Der Mensch befindet sich immer im Zustand des Verlangens. Von einer längeren völligen
Bedürfnisbefriedigung kann nicht ausgegangen werden. Gilt ein Bedürfnis als gestillt, erstrebt
das Nächste die Befriedigung in einem relativen, stufenweise aufsteigenden Prozess, wobei
sich die Bedürfnisse selbst hierarchisch anordnen.
2.4.8 Triebkatalog
Die Erstellung eines Triebkataloges zeigt sich in dreifacher Weise als unzureichend.
Erstens wäre somit eine Gleichheit aller aufgeführten Triebe, deren Priorität und
Wahrscheinlichkeit des Auftretens vorausgesetzt.
39
Maslow 1977, 61
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
19
Die Bewusstwerdung eines Verlangens, deren Auftrittswahrscheinlichkeiten stark variieren,
kollidiert allerdings mit der Befriedigung anderer, momentan vorrangiger Bedürfnisse.
Zweitens würde die Festlegung einer Anzahl von Trieben gleichzeitig den Ausschluss eines
beeinflussenden Verständnisses der Triebe untereinander implizieren.
Und drittens wäre die Dynamik der einzelnen Triebe vernachlässigt.
Triebe schließen sich nicht, wie bei Anfertigung eines Kataloges angenommen, gegenseitig
aus. Stattdessen sollte von einer Gesamtheit, von ,,Kollektionen von Bedürfnissen"
40
,
ausgegangen werden, die sich je nach hierarchischer Spezifität gliedert, wobei diese
Bedürfnisse keine eindeutige Unterscheidung in Trieb und Zielobjekt erlauben.
2.4.9 Klassifikation des Motivationslebens
Triebe, motiviertes Verhalten oder ein spezifisches Zielobjekt sind Ausdruck einer Vielzahl von
wünschenswerten Bedürfnissen, die in ihrer Zuordnung nicht eindeutig festzulegen sind. Aus
diesem Grunde müssen diese als Basis einer Klassifikation ausgeschlossen werden und ein
Rückgriff auf die unbewussten, grundlegenden Ziele und Bedürfnisse erfolgen.
2.4.10 Motivation und Ergebnisse aus der Verhaltensforschung an Tieren
Eine Motivationstheorie sollte anthropozentrisch sein, da Ergebnisse von Tierexperimenten nur
begrenzt auf den Menschen übertragen werden können.
Der Gegenstand des Instinkts (nach Maslow ein ,,gleichsam automatisch ablaufendes Verhalten
zur Befriedigung eines Bedürfnisses, in dem der Trieb am Anfang und die Erlangung des
Triebziels am Ende steht"
41
) in der Auffassung einer hereditären Determinierung wird beim
Menschen relativiert. Im Vergleich zu weißen Ratten und Affen, die dem Menschen unter den
Tieren am vergleichbarsten sind, erscheint der menschliche Hunger-, Sexual- und Mutterinstinkt
gänzlich latent.
Stattdessen existiert ein Zusammenspiel von Reflexen und Trieben, die als Folge der
Vererbung gelten, von autogenem und kulturellem Lernen im Motivationsverhalten und in der
Auswahl der Zielobjekte mit dem Moment der gesellschaftlichen Anpassung.
40
Maslow 1977, 63
41
Maslow 1977, 65/66
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
20
2.4.11 Umwelt
Menschliche Motivation realisiert sich in der Beziehung zur Situation und im Kontakt zu anderen
Menschen im jeweiligen kulturellen Kontext. Die Situationstheorie proklamiert die einseitige
Betonung der Umwelt, wobei es zu beachten gilt, dass der Organismus mit seiner
entsprechenden Charakterstruktur seine Wertobjekte und die Barrieren, die auf dem Weg der
Zielerreichung auftreten, aus einer Eigeninitiative heraus festlegt. Die Suche nach dem
,,Verstehen der Natur der Beständigkeit des Organismus"
42
darf nicht zugunsten des
,,Verstehens der Welt"
43
aufgegeben werden.
2.4.12 Integration
Die Fähigkeit zur Integration scheint beim Menschen dann am größten, wenn dieser in Erfolg
versprechender Weise mit Freude oder Kreativität zu rechnen hat oder sich einer beträchtlichen
Problemlage bzw. einer Bedrohung ausgesetzt sieht. Bei zu starker Überforderung vor allem
auch bei gleichzeitiger Erledigung von Anforderungen tendiert der Organismus zur
Desintegration. Dieses Phänomen kann damit erklärt werden, dass lediglich ein geringer Anteil
der menschlichen Ressourcen zur Bewältigung bekannter, irrelevanter oder simpler
Schwierigkeiten eingesetzt wird, um die verbleibenden Kompetenzen für komplexere
Herausforderungen verfügbar zu erhalten.
2.4.13 Nichtmotiviertes Verhalten
Mangelnde Ausrichtung auf Bedürfnisbefriedigung kennzeichnet ein Verhalten, das
nichtmotiviert ist (beispielsweise Aspekte des Wachsens, der Reifung, des Ausdrucks oder der
Selbstverwirklichung) und nicht jede menschliche Aktion ist von Motivation geprägt.
Norman Maier (1949) unterscheidet zwei verschiedene Symptomarten. Zum einen diejenigen,
bei denen die Grundbedürfnisbefriedigung unterdrückt oder auf ein falsches Ziel ausgerichtet
ist, mit anderem Verlangen gekoppelt ist oder sich fehlerhaften Mitteln bedient. Zum anderen
die ziellosen Symptome, die mit Hilfe eines defensiven, hoffnungslosen Charakters versuchen,
weiteren Schaden oder Enttäuschung abzuwenden.
42
Maslow 1977, 68
43
Maslow 1977, 68
Grundannahmen und traditionelle Denkansätze
21
2.4.14 Möglichkeit von Erlangung
Der Aspekt der Möglichkeit der Erlangung geht auf Dewey (1939) und Thorndike zurück und
liefert einen zusätzlichen Erklärungsansatz für interkulturelle motivationale Unterschiede.
Menschen beziehen in ihre Wünsche, ein Ziel zu erreichen, auch die realistische Möglichkeit
ein. Dabei wird ein möglicherweise zu verwirklichendes Bedürfnis bewusst angestrebt,
wohingegen ein unrealistischer Wunsch auch unbewusst nicht ersehnt wird.
2.4.15 Realitätseinfluss
Als Erklärung des Realitätseinflusses unbewusster Triebe kann Freuds Theorie vom
Zusammenspiel des Es- und Ich-Triebes (1970) dienen.
Der Es-Trieb stellt nach Freud eine Einheit dar, die keinen Bezug zu anderen Instanzen hat und
ebenso über keine moralische Richtlinie verfügt, sondern ausschließlich am Prinzip der
Ökonomie und der Lust orientiert ist. Im Prozess der Modifikation, Kontrolle und Hemmung
dieser Bedingungen in Begegnung mit der Realität erfolgt eine Integration als eines Bereichs
des Ichs.
Dewey dagegen bestreitet die Existenz dieser Ich-Triebe (bzw. hält diese im Grunde für
pathologisch), da er davon ausgeht, dass sich alle vorhandenen Triebe im Menschen im
Einklang mit der Realität befinden.
Da das Vorhandensein der Es-Triebe in Form der Phantasietriebe (zumindest in den Reihen der
Psychoanalytiker) kaum bestritten werden kann, eröffnen sich etliche Fragen bezüglich des
Wesens, der Entstehung und Wirkung dieser Triebe.
2.4.16 Wissen über gesunde Motivation
Die meisten Untersuchungen über Motivation fanden im Rahmen der Psychotherapie an
Neurotikern statt. Da Gesundheit allerdings mehr umfasst als die Abwesenheit von Krankheit,
wird diese Stichprobe als nicht-repräsentativ zur Gewinnung von Aussagen bezüglich des
Motivationslebens von ,,gesunden" Menschen betrachtet. Diese müssten direkt in die
Beobachtungen einbezogen werden.
Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)
22
3. Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)
,,Motive sind dem Menschen nicht angeboren. [...] Ihre zureichende Ausformung erhält die
Motivationsthematik durch Selbstbestimmung in Autonomie."
44
Diese von Schiefele vertretene
Position
45
kann als Einleitung zur Erläuterung der von Maslow entworfenen Hierarchiestufen der
Motivationsentwicklung
46
herangezogen werden. Auch Schiefele vertritt die Meinung, dass der
Mensch in Eigenverantwortung einzelne Niveaus der Motivationsgenese durchläuft, wobei der
Grad des Niveaus durch sittliche Maßstäbe festgelegt ist.
3.1 Die grundlegenden (physiologischen) Bedürfnisse
Die Basis einer Motivationstheorie bilden die physiologischen Bedürfnisse, die über das
Empfinden von Appetit relativ genau eingegrenzt werden können und von denen ein Großteil
homöostatischen Charakter besitzt. Verspürt der menschliche Körper Mangel an etwas, so wird
er einen Bedarf in Form von Appetit oder Hunger nach dem entsprechenden Bestandteil
entwickeln (vgl. Young 1941/1948).
Homoöstase dagegen meint die Tatsache, dass der Körper automatisch Aktivierung vornimmt,
um eine regelmäßige Blutzirkulation zu gewährleisten (vgl. Cannon 1932). Für Training und
bloße Aktivität, Schläfrigkeit, das Sexualbedürfnis oder das mütterliche Verhalten konnte die
Homoöstase noch nicht belegt werden. Dagegen lassen sich Tendenzen erkennen, dass der
Organismus gleichzeitig nach Erregung/Aktivität und minimaler Anregung/Trägheit strebt.
Über die physiologischen Bedürfnisse und das damit verknüpfte Verhalten kann weit mehr als
nur das reine Bedürfnis ausgedrückt werden. So mag das Verlangen nach Nahrung
beispielsweise auch ein Verlangen nach Bequemlichkeit sein. Und dieses Verlangen lässt sich,
außer durch die Aufnahme von Speise, ebenfalls über kompensierende Aktivitäten (z.B. ein
Glas Wasser trinken) zumindest vorübergehend beseitigen.
,,Alle Fähigkeiten werden in den Dienst der Hunger-Befriedigung gestellt, und die Organisation
der Fähigkeiten wird fast vollständig von dem einen Zweck, den Hunger zu stillen,
determiniert."
47
Sämtliche weiteren (höherwertigen) Bedürfnisse eines Menschen verlieren an
Bedeutung, wenn dieser das Verlangen nach Nahrung verspürt. Der Hungertrieb beherrscht als
solcher das gesamte Handeln, indem primär nach Sättigung gestrebt wird.
44
Schiefele 1963, 68
45
Vgl. Schiefele 1963, 68 70
46
Vgl. Maslow 1977, 74 95
47
Maslow 1977, 76
Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)
23
Dieses Streben kann durch die einseitige Fixierung auf den Wunsch, das Hungerbedürfnis zu
befriedigen, die zukünftige Lebensweise gänzlich bestimmen und letztlich Zufriedenheit und
Freude einzig und alleine an der Erreichung dieses Zieles festmachen.
Da in der westlichen Zivilisation für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Sättigung durch
ausreichend Nahrung gewährleistet ist, sollte Abstand von der Position des einseitig durch
Hunger festgelegten Menschen genommen werden, da zunehmend höherwertige Bedürfnisse
in den Blickpunkt geraten.
Physiologische Bedürfnisse verlieren bei permanenter Befriedigung ihren deterministischen
Charakter und erscheinen erst wieder im Moment der Entbehrung. Sobald deren Mangel
wirksam wird, reagiert der Organismus mit Frustration. Hierbei scheinen Menschen, die über
längere Zeit hinweg Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses erfahren haben, über mehr
Kompetenz im Umgang mit diesem frustrierenden Ereignis zu verfügen.
3.2 Die
Sicherheitsbedürfnisse
Das Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit, Geborgenheit, Recht und Ordnung orientiert sich
hinsichtlich der Organisation des menschlichen Verhaltens, der Dominanz und
Zukunftsplanung, an den Prinzipien der physiologischen Bedürfnisse.
Um Aussagen über erwachsene Verhaltensweisen bezüglich der Sicherheitsbedürfnisse treffen
zu können, wurden hauptsächlich Ergebnisse aus Experimenten mit Kindern herangezogen, da
deren Reaktionen spontaner, direkter und eindeutiger erfolgen. Ihr Wunsch nach einer
strukturierten und gerechten Welt soll Unzuverlässigkeit und Unvorhersehbarkeit beseitigen und
über Routine, feste Zeiteinteilung und Verlässlichkeit eine adäquatere Bewältigung der Realität
ermöglichen. In diesem Kontext spielt die Familie und in besonderem Maße die Eltern eine
tragende Rolle. Umfassender elterlicher Schutz stellt für das Kind eine Basis für Zuverlässigkeit
und Geborgenheit dar. Angst- und Alarmreaktionen entstehen bei neuartigen und
unüberschaubaren Situationen.
Ähnliches trifft auch auf erwachsene Personen zu. Jedoch existieren in unserer gesicherten,
funktionierenden und geordneten Gesellschaft kaum noch aktive Sicherheitsmotivatoren.
,,Der gesunde und von Glück begünstigte Erwachsene ist in unserer Kultur in seinen
Sicherheitsbedürfnissen im großen und ganzen befriedigt."
48
Das Streben nach Sicherheit des
Arbeitsplatzes oder Versicherungen jeglicher Art sollen sämtliche Risiken des Lebens
eindämmen. Lediglich bei gesellschaftlich und sozial unterprivilegierten Personen oder in
Kriegs- und Krisenzeiten werden Ausprägungen dieses Wunsches nach Sicherheit deutlich.
48
Maslow 1977, 82
Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)
24
3.3 Die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe
Nach Sicherstellung der physiologischen Bedürfnisse und der Sicherheitsbedürfnisse beginnt
der Mensch, sich nach Zuneigung, Zugehörigkeit und Liebe zu sehnen und reagiert äußerst
sensibel auf Ignoranz und Isolation. Als Individuum möchte er sich innerhalb der Familie oder
einer Gruppe konstituieren und als deren Teil akzeptiert werden.
Das Einlösen dieser ,,Sehnsucht nach Liebe" bildet das Fundament einer Gesellschaft, um
dauerhaft als solche existieren zu können. Dabei impliziert das Geben von Liebe wiederum ein
reziprokes Empfangen derselben.
Die Tendenz innerhalb unserer Gesellschaft, in T-Gruppen oder anderen intentionalen
Zusammenschlüssen, die Erfüllung der eigenen Wünsche nach Geborgenheit eingelöst zu
erhalten, spricht laut Maslow für den ,,unbefriedigten Hunger nach Kontakt, Intimität,
Zugehörigkeit und dem Bedürfnis [...], das weitverbreitete Gefühl der Entfremdung, Einsamkeit,
Fremdheit und Verlassenheit zu überwinden [...]"
49
.
3.4 Die Bedürfnisse nach Achtung
Die meisten Menschen besitzen das Bedürfnis nach Achtung sei es durch sich Selbst oder die
Umwelt. Einerseits äußerst sich dies beispielsweise in dem Wunsch nach Kompetenz, Stärke,
Leistung, Vertrauen, Unabhängigkeit und Freiheit. Vor allem Alfred Adler u.a. heben
andererseits das Verlangen nach Reputation, Status, Dominanz, Anerkennung und Würde
hervor. Dale Carnegie
50
dagegen unterscheidet zwei Arten von egoistischen Bedürfnissen im
Menschen, nämlich diejenigen nach Selbstachtung (Kompetenz, Erfolg, Vertrauen) und die
nach Anerkennung, Status und Prestige, wobei die egoistischen Bedürfnisse den sozialen
folgen.
Um eine relativ stabile Selbstachtung zu erzeugen, sollte der erhaltene Respekt auf ,,wahrem"
Verdienst und nicht auf unbegründeter Bewunderung beruhen. Die Realisierung dieser
Bedingungen vermittelt dem Individuum, dass es für die Mitmenschen und die Umwelt von
Nutzen und unbedingter Notwendigkeit ist. Dagegen führen enttäuschte Erwartungen zu
Frustration, Minderwertigkeitsgefühlen und Hilflosigkeit.
49
Maslow 1977, 86
50
Vgl. Carnegie 2001, 228
Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)
25
3.5 Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
,,Was ein Mensch sein kann, muss er sein. Er muss seiner eigenen Natur treu bleiben."
51
Dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung bzw. ,,Selbstaktualisierung"
52
(der Begriff wurde
1939 erstmals von Kurt Goldsteiner geprägt) umfasst laut Allport (1970) die
,,Hauptinteressensysteme des Erwachsenenalters"
53
und entspricht der menschlichen Suche
nach Selbsterfüllung, d.h. die individuellen Ressourcen zu nutzen und zu perfektionieren. Es
entsteht gewöhnlich erst nach Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse und derjenigen
nach Sicherheit, Zugehörigkeit/Liebe und Achtung.
3.6 Maslows
Bedürfnishierarchie in der Kritik
Eine kritische Würdigung des von Maslow vorgelegten Konzeptes der Selbstverwirklichung laut
Keller
54
ergibt, dass Motivation nicht mehr nur auf den triebhaften und konfliktbeladenen
Charakter reduziert wird und die Betonung des ,,Individuellen" der Motivation zukunftsorientiert
erfolgt (weitere Informationen dazu vgl. Allport 1970).
Als Schwachpunkte werden von Drever & Fröhlich (1972), Cofer & Appley (1964) und
Smith (1973) bemängelt, dass die Theorie der Selbstverwirklichung von Maslow nur unpräzise
und spekulativ entworfen wurde und vorausgesetzte Grundannahmen keine empirische
Entsprechung besitzen.
Zudem tritt nach Zigler & Child (1969) und Frankl (1959) wegen der einseitigen Hervorhebung
der individuellen Aspekte der soziale Bereich und die damit verbundene Wertorientierung der
menschlichen Existenz in den Hintergrund. Maslow entschärft diesen Einwand, indem er die
Überzeugung vertritt, dass ,,[...] nur in dem Maße, in dem wir Aufgaben und Forderungen
verwirklichen, erfüllen und verwirklichen wir uns auch selbst"
55
. Ein befriedigtes Bedürfnis wirkt
nicht motivierend, es gilt als nicht existent.
Die Kategorisierung Maslows scheint darüber hinaus insofern fraglich, als implizite, teilweise
unreflektierte Aussagen über das Wesen des Menschen ohne Stützung durch empirische
Befunde getroffen werden. Zudem erschwert die komplexe Formulierung abstrakt-idealistischer
Begriffe den Zugang zu einer Operationalisierung, sodass die einzelnen Motive in dem Versuch
der praktischen Differenzierung versagen. Ebenso kann bezweifelt werden, dass eine
hierarchische Fixierung der einzelnen Stufen vorliegt.
51
Maslow 1977, 88
52
Zit. n. Keller 1977, 244
53
Zit. n. Keller 1977, 244
54
Vgl. Keller 1977, 244 251
55
Zit. n. Keller 1977, 249
Die Theorie der menschlichen Motivation
nach Abraham H. Maslow (1943)
26
In bestimmten Lebensphasen scheinen Menschen in der Lage zu sein, das höherwertige
Prinzip verwirklichen zu können, obwohl die scheinbar als Basis geltenden ,,niederen"
Bedürfnisse nicht gewährleistet sind (detailliertere Ausführungen dazu vgl. Keller 1977).
56
Kunz & Mehler
57
fügen hinzu, dass Zuwendung für den Menschen die Lebensbasis darstellt,
obwohl Maslow diese erst ab der dritten Stufe aufgreift. Zudem scheinen Bereiche wie
,,Ästhetik" oder ,,Kriegslust" (vgl. F. Nietzsche) ausgeklammert zu bleiben.
Nachdem bei Rempe
58
eine inhaltliche Entsprechung der aufgeführten Hierarchie zu finden ist,
halte ich trotz der kritischen Anmerkungen an der von Maslow getroffenen Einteilung fest
und möchte zum Untermauern die im ,,Ursprungsenergiemodell" genannten drei Stufen
heranziehen. Laut Rempe trägt jedes Individuum von Geburt an diese Energien in sich, die im
Verlauf des Lebens über Erziehungsregeln und Normen modifiziert und minimiert werden. Bis
zum Erwachsenenalter bildet sich jedoch eine gewisse Harmonie zwischen ,,verschütteten
Energiequellen und belebenden Energien"
59
aus.
Statikerhaltende Motive wie Sicherheit, Status und Freunde, lassen sich in der
Bedürfnispyramide von Maslow unter die ersten drei Stufen subsummieren. Die
Heilungsenergiemotive mit dem Verlangen nach Wertschätzung, Lob, Anerkennung und
Selbstwertgefühl sind vergleichbar mit den Bedürfnissen nach Achtung und
Selbstverwirklichung. Dagegen können die Ursprungsenergiemotive (Neugier, Spaß, Kreativität,
Zuhören, Abenteuerlust, Intensität, Klarheit, Freude am Erfolg, Ziele und Visionen), die nach
Rempe für die Selbstmotivation den höchsten Stellenwert einnehmen und Analogien zum
kindlichen Spiel aufzeigen, in Maslows Kategorisierung nicht eindeutig zugeordnet werden.
Die Behauptung Maslows, dass die Gesamtheit der Menschen einander ähnliche Bedürfnisse
mit unterschiedlichen Graden der Ausprägung zu verspüren scheint, lässt sich vermutlich
bestätigen. Diese Erkenntnis bildet eine wichtige Voraussetzung, um die Quellen menschlicher
Motivation zu ergründen und bei fehlendem Antrieb die entsprechenden Ursachen zu suchen.
Insofern zeigt sich auch die Relevanz der bisherigen Erläuterungen für die logische
Argumentationsstruktur der folgenden Ausarbeitung. Nur mit einer entsprechend
grundlegenden, theoretischen Wissensbasis wird auch eine stringente Analyse ermöglicht.
56
Vgl. Keller 1977, 207/208
57
Vgl. Kunz & Mehler 1989, 30 32
58
Vgl. Rempe 1991, 32 37
59
Rempe 1991, 32
Die Philosophie der Motivationstrainer
27
4. Die Philosophie der Motivationstrainer
,,Die Welle führt, je nach Standpunkt des Betrachters, hilfreiche Visionen, fatale Ideologien oder
schlicht zusammengeklaubte Kalenderweisheiten mit sich. Sie verspricht ,Power`, Frische und
Aufbruch, fließt im Bett des ,Positiven Denkens`, speist sich hemmungslos aus dem Prinzip
Individualismus und ergießt sich in das ,Un- und Unterbewusste`. Auf ihrem Weg hat sie
Kinesiologie und Kybernetik mit sich gerissen und vor allem das ,Neurolinguistische
Programmieren (NLP)` [...]."
60
Ergriffene ,,Evangelisten" ,,importierten" aus den Vereinigten Staaten die Lehre von einem mit
Selbstmächtigkeit ausgestatteten Menschen, der aufgrund gesellschaftlicher Repression zu
deren Ausübung nicht mehr fähig ist. Diesen Befreiungsschlag initiierten um das Jahr 1950
auch Dale Carnegie, Joseph Murphy, Norman Peale und Erhard Freitag in Deutschland. Ihnen
folgten Brian Tracy, Tom Peters und Anthony Robbins in den Achtzigern und Neunzigern
zeitgleich mit Vera F. Birkenbihl mit der Idee des ,,psychologischen Supermarktes"
61
, Nikolaus
B. Enkelmann und Emile Ratelband.
Heute werden mit dem Begriff ,,Motivationstrainer" Namen wie Ulrich Strunz, Jörg Löhr,
Bodo Schäfer und Jürgen Höller assoziiert. Die meisten dieser Personen berufen sich inhaltlich
auf die Prinzipien des positiven Denkens, des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) und
der Autosuggestion. Die Theorie des Neurolinguistischen Programmierens als ,,Struktur der
subjektiven Erfahrung"
62
befasst sich mit der Interaktion von Gehirn, Sprache und Körper und
geht dabei von einer reziproken Beeinflussung von Geist und Körper aus. Der Mensch nimmt
nicht die äußere Realität als Basis für seine Reaktion, sondern die subjektive Abbildung der
Wirklichkeit.
Das positive wie das negative Denken legt über das Unterbewusstsein das individuelle
Verhalten fest, wobei besonders labile Menschen mit der Verarbeitung enttäuschter Hoffnungen
zu kämpfen haben. Mit der Technik der Autosuggestion der Eigenbeeinflussung soll das
Verhalten systematisch gesteuert werden. Täglich gesprochene positive Botschaften erzeugen
eine Täuschung des Unterbewusstseins mit Hilfe der Selbstprogrammierung, da
,,Wunschwahrheiten" als real übernommen werden.
60
Schüle 2001a, 13
61
Schüle 2001a, 13
62
www2.wiwo.de/wiwowwwangebot/fn/ww/SH/0/sfn/buildww/cn/cn_artikel/id/62605!91531/layout//58327/depot/0/index.html
Die Philosophie der Motivationstrainer
28
Beispielhaft möchte ich die Philosophie eines Vertreters Dale Carnegies
63
analysierend
herausgreifen.
Der Spezialist für ein ,,glückliches" Leben scheint das Bedürfnis unserer heutigen Gesellschaft
aufzufangen. Als einer der erfolgreichsten Autoren trifft er mit seiner ,,Theorie" die Menschen
offensichtlich an ihrer sensibelsten Stelle der Unzufriedenheit. Ob im privaten oder beruflichen
Bereich, Leistung und Erfolg dominieren das Geschehen und legen fest, wer als attraktiv und
beneidenswert gilt. Nämlich derjenige, der Erfolg zu verzeichnen hat. Dass dieser Erfolg
wesentlich zur Zufriedenheit des eigenen Lebens beiträgt, muss nicht ausdrücklich betont
werden. Da der Erfolg der einen den Misserfolg der anderen aber fast zwangsläufig bedingt,
werden Strategien notwendig, sich trotz der Gefahr des Scheiterns immer wieder neu auf
Anforderungen einzulassen. Eine dieser Strategien kann darin bestehen, den Blick weg von
diesen möglichen Misserfolgen zu richten und den eigentlichen Weg zum Ziel als ,,erfüllend" zu
betrachten. In Dale Carnegies Worten ,,Machen Sie Ihre Arbeit mit Begeisterung"
64
würde
dies folgendermaßen lauten:
,,Wenn Sie jede Stunde am Tag mit sich reden, können Sie sich so beeinflussen, daß Sie
mutige und glückliche Gedanken denken, Gedanken an Kraft und Frieden. Wenn Sie sich selbst
erzählen, für wie viele Dinge Sie dankbar sein müssen, können Sie Ihren Geist mit erhebenden,
fröhlichen Gedanken füllen. [...] Denken Sie die richtigen Gedanken, und Ihre Arbeit jede
Arbeit wird weniger unerfreulich sein."
65
Die Gedanken als bestimmender Impuls des Handelns und Empfindens bilden für Carnegie die
Basis einer positiven Lebenseinstellung. Über die Gedanken setzt sich der Mensch mit sich und
seiner Umwelt auseinander, legt eigene Richtlinien fest und versucht, seinen Lebensweg
dementsprechend zu gestalten: ,,Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken"
66
(Marc Aurel). Da wir über die Gedanken steuern können, wie intensiv unsere Lebensfreude
ausfallen wird, müssen wir ,,um unser Glück [kämpfen]"
67
. Um diesen Kampf täglich neu
aufnehmen zu können, beruft sich Carnegie auf ein von Sibyl F. Partridge vorgelegtes
Tagesprogramm:
,,NUR HEUTE
1. Heute will ich glücklich sein. Deshalb glaube ich, was Abraham Lincoln sagte: ,Die meisten
Menschen sind so glücklich, wie sie sein wollen.` Glück kommt von innen, es hat mit
äußeren Umständen nichts zu tun.
2. Heute nehme ich alles, wie es ist, und zwinge den Dingen nicht meinen Willen auf. Familie,
Arbeit und Glück ich nehme es, wie es kommt, und stelle mich darauf ein.
63
Vgl. Carnegie 1998, 37 47; Carnegie 1990, 127 141
64
Carnegie 1998, 47
65
Carnegie 1998, 46
66
Zit. n. Carnegie 1990, 127
67
Carnegie 1990, 140
Die Philosophie der Motivationstrainer
29
3. Heute kümmere ich mich um meinen Körper. Ich bewege ihn, pflege ihn, ernähre ihn und
vernachlässige oder mißbrauche ihn nicht, damit er so perfekt reagiert, wie ich es mir
wünsche.
4. Heute trainiere ich meinen Geist. Ich lerne etwas Nützliches und faulenze nicht, sondern
lese etwas, das Anstrengung, Konzentration und Denkarbeit verlangt.
5. Heute mache ich drei Seelenübungen: Ich erweise jemand einen Gefallen, ohne daß er es
merkt, und tue zwei Dinge, die ich nicht gerne tue, um in Übung zu bleiben, wie
William James das nennt.
6. Heute möchte ich erfreulich sein. Ich mache mich so hübsch wie möglich, ziehe mich nett
an, spreche leise, bin höflich, lobe oft, kritisiere niemand, nörgle nicht und versuche nicht,
andere zu ermahnen oder zu verbessern.
7. Heute lebe ich allein für diesen Tag und versuche nicht, alle Probleme meines Lebens auf
einmal zu lösen. Zwölf Stunden kann ich Dinge tun, die ich hassen würde, wenn ich sie
mein ganzes Leben tun müßte.
8. Heute mache ich mir ein Programm. Ich teile die Zeit genau ein und schreibe es mir auf.
Vielleicht halte ich die Einteilung nicht durch, aber immerhin habe ich sie gemacht. Damit
vermeide ich zwei lästige Übel: Eile und Unentschlossenheit.
9. Heute nehme ich mir eine ruhige halbe Stunde und entspanne mich. In dieser halben
Stunde denke ich auch an Gott, um in mein Leben eine größere Dimension zu bringen.
10. Heute bin ich ohne Angst, vor allem habe ich keine Angst davor, glücklich zu sein, das
Schöne zu genießen, zu lieben und zu glauben, daß die Menschen mich auch lieben, die ich
liebe."
68
In ähnlicher Weise vertritt auch Altmann
69
die Ansicht, dass unsere Gedanken eine enorme
Macht auf unsere Ausstrahlung und unser Verhalten ausüben. Anhand der Gesetze des
positiven Denkens entwarf er sechs Maximen für ein ,,glückliches" und erfolgreiches Leben,
wobei er den Erfolg des Menschen fast ausschließlich an seinen eigenen Gedanken festmacht.
Der Mensch definiert sich über seine Gedanken (,,Der Mensch ist, was er denkt!"
70
nach
Marc Aurel) und orientiert sein Reden und Handeln an den momentanen Gedanken. Folglich
lapidar ausgedrückt: Je positiver diese ausfallen, desto besser für das Ego. Und nicht nur für
die eigene Person, sondern auch für die Wirkung auf die Mitmenschen (,,Was der Mensch
denkt, strahlt er aus!"
71
) und zwar über Worte, Gestik, Mimik und Körpersprache. ,,Was der
Mensch ausstrahlt, das zieht er an!"
72
68
Zit. n. Carnegie 1990, 140 141
69
Vgl. Altmann 1989, 61 77
70
Zit. n. Altmann 1989, 65
71
Altmann 1989, 66
72
Altmann 1989, 66
Die Philosophie der Motivationstrainer
30
Einstellungen wie Zuversicht und Gelassenheit oder im Gegenzug Enttäuschung und
Pessimismus kommen bei dem Gegenüber in mehr oder weniger abgeschwächter Form an und
erzeugen adäquate Reaktionen.
,,Der Mensch bekommt nicht das, was er will, sondern das, woran er glaubt!"
73
Positivem
Denken muss immer ein entsprechendes Handeln folgen, damit die Gedanken in das
Unterbewusstsein vordringen können und wirklich geglaubt werden. Denn nur wenn sich der
Optimismus auch in konkreten Aktionen realisiert, wird die vertretene Position von der eigenen
Person und von anderen als glaubwürdig und authentisch anerkannt. Allerdings möchte
Altmann nicht im Sinne der Praktizierung eines blinden Optimismus` in sämtlichen
Angelegenheiten verstanden werden die Bündelung aller positiven Gedanken und deren
Ausrichtung auf ein Ziel zählt (,,Wir bewegen uns auf das Ziel hin, mit dem wir uns gedanklich
am meisten beschäftigen!"
74
). Letztendlich trifft die Überzeugung: ,,Wir sind so erfolgreich, wie
unsere positiven Gedanken über uns selbst!"
75
zu. Ein von Zufriedenheit und Stabilität
gekennzeichnetes Selbstbild erhöht die Erfolgschancen.
Obwohl diese Positionen meiner Meinung nach etliche hilfreiche Ansätze zur Gestaltung des
täglichen Lebens bieten können, bergen sie dennoch die Gefahr, die Probleme des Lebens zu
verharmlosen. Nicht allein durch die Tatsache, dass ich mir wünsche, die Unannehmlichkeiten
würden beseitigt werden, kann ich meine Gedanken und mein Handeln auch danach
ausrichten. Denn ich bin nicht die einzige Triebfeder der Probleme. Aber gerade Carnegie
entgegnet diesem Einwand, dass er nicht in dem Sinne verstanden werden will, dass es sich
nicht lohne, Gedanken an die Probleme zu verschwenden, sondern dass die Sorge um die
Probleme die Unruhe und Verzweiflung des Menschen schafft. Und tatsächlich entstehen
Schwierigkeiten und Hürden häufig in unserer gedanklichen Vorwegnahme. Mit dieser
Einstellung an problembehaftete Angelegenheiten heranzugehen, programmiert Sorge und
Enttäuschungen sichtlich vor. Mut und Ruhe dagegen helfen, das Leben zu meistern, indem die
Gedanken durch einen ,,einfachen Willensakt"
76
zum Positiven verändert werden. Äußert sich
dieser Willensakt im Handeln, so wird das Gefühl automatisch dadurch beeinflusst; denn allein
das praktizierte Verhalten, dass man glücklich wäre auch wenn scheinbar nur Bruchstücke
dieses Endzustandes vorhanden sind , unterbindet eine negative gedankliche Einstellung und
verhilft, das Handeln nach diesen ,,idealen" Prinzipien auszurichten und zum Teil auch zu
realisieren.
73
Altmann 1989, 67
74
Altmann 1989, 67
75
Altmann 1989, 68
76
Carnegie 1990, 136
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832464011
- ISBN (Paperback)
- 9783838664019
- DOI
- 10.3239/9783832464011
- Dateigröße
- 686 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-Friedrich-Universität Bamberg – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- motivation motivationstraining psychotherapie management schule
- Produktsicherheit
- Diplom.de