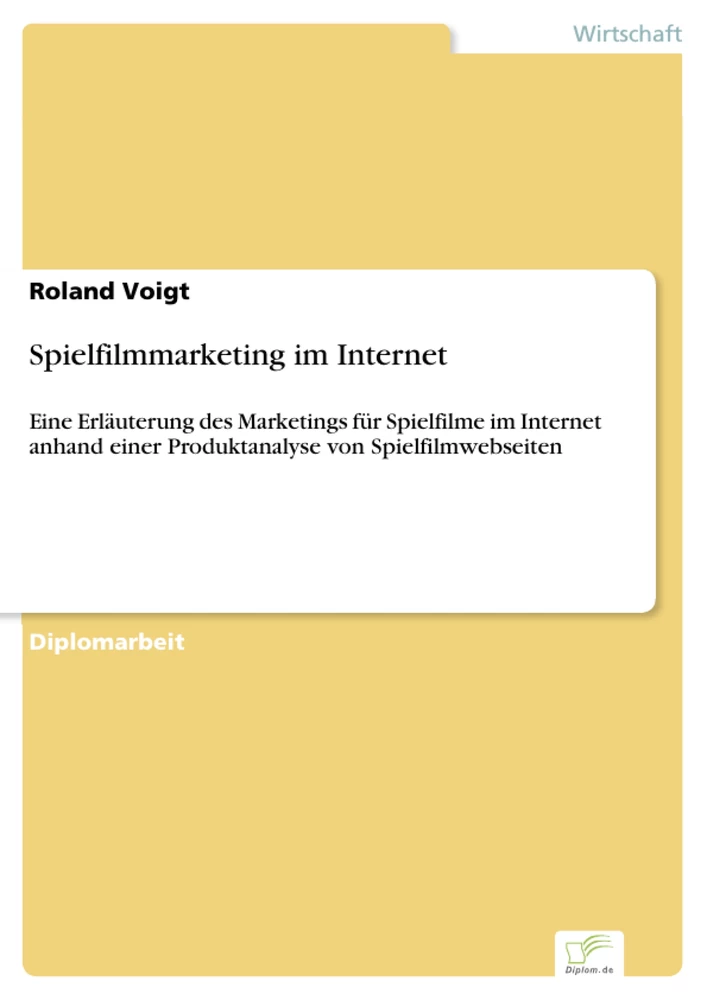Spielfilmmarketing im Internet
Eine Erläuterung des Marketings für Spielfilme im Internet anhand einer Produktanalyse von Spielfilmwebseiten
©2002
Diplomarbeit
180 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Diese Arbeit beschäftigt sich prinzipiell mit der Vermarktung von Spielfilmen. Spielfilmmarketing, als relativ alte Form des Marketings, bestand jahrzehntelang vor allem aus vor allem der Präsentation von Filmtrailern, Filmplakaten und der PR für den Film. In den Siebziger Jahren erfolgte die Erweiterung des Spektrums an Werbemöglichkeiten durch das Fernsehen, wodurch der Spielfilm zum Markenprodukt stilisiert wurde.2 Es wurden zwar neue Zielgruppen mit neuen Methoden angesprochen, an den Argumenten und Techniken änderte sich hingegen wenig. Erst Ende der Neunziger, kam, durch die Integration des Internets in das Marketing für den Spielfilm, eine neue und innovative Darstellungsform hinzu. Zunächst wurden, in einem kurzen, subjektiven und nicht durch empirische Daten belegten historischen Rückblick, wohl rein repräsentative, ähnlich dem Filmplakat gestaltete und kaum interaktive Webseiten im Internet präsentiert. Doch auch das Internet und seine Darstellungsmöglichkeiten entwickelte sich weiter, sodass Spielfilmwebseiten zunehmend multimedialer und interaktiver wurden, und andere, innovativere Möglichkeiten des Marketings in die Webseiten miteinbezogen werden konnten. An dieser Stelle endet der historische Rückblick und wird ersetzt durch das Forschungsinteresse dieser Arbeit, dessen primäres Ziel eine Bestandsaufnahme der aktuell eingesetzten Spielfilmwebseiten, ihrer Inhalte, ihre multimedialen Typen, ihre Werbemethoden, ihrer interaktiven Elemente und ihrer Ziele darstellt. Dadurch soll eine Kategorisierung und Interpretation des Staus Quo von Spielfilmwebseiten ermöglicht und mit Eigenschaften der beworbenen Spielfilme in Verbindung gebracht werden. Dazu muss zunächst der Spielfilm selbst, das Internet und in weiterer Folge die Konvergenzen zwischen den beiden Medien aufgezeigt werden. Den hinter den Darstellungsformen im Internet verbergen sich viele, nicht offensichtliche, strukturelle
Bezüge zur filmischen Darstellungsform, die, gerade für diese Arbeit, von doppelter Bedeutung sind.
A hundred years after cinemas birth, cinematic ways of seeing the world, by structuring time, of narrating a story, of linking one experience to the next, have become the basic means by which computer users access and interact with cultural data.
Wenn sich zwei, prinzipiell unterschiedliche Medien, die das selbe Repertoire von Medienschemen bedienen, zu einer gemeinsamen Darstellungsform, der Spielfilmwebseite, vereinigen, […]
Diese Arbeit beschäftigt sich prinzipiell mit der Vermarktung von Spielfilmen. Spielfilmmarketing, als relativ alte Form des Marketings, bestand jahrzehntelang vor allem aus vor allem der Präsentation von Filmtrailern, Filmplakaten und der PR für den Film. In den Siebziger Jahren erfolgte die Erweiterung des Spektrums an Werbemöglichkeiten durch das Fernsehen, wodurch der Spielfilm zum Markenprodukt stilisiert wurde.2 Es wurden zwar neue Zielgruppen mit neuen Methoden angesprochen, an den Argumenten und Techniken änderte sich hingegen wenig. Erst Ende der Neunziger, kam, durch die Integration des Internets in das Marketing für den Spielfilm, eine neue und innovative Darstellungsform hinzu. Zunächst wurden, in einem kurzen, subjektiven und nicht durch empirische Daten belegten historischen Rückblick, wohl rein repräsentative, ähnlich dem Filmplakat gestaltete und kaum interaktive Webseiten im Internet präsentiert. Doch auch das Internet und seine Darstellungsmöglichkeiten entwickelte sich weiter, sodass Spielfilmwebseiten zunehmend multimedialer und interaktiver wurden, und andere, innovativere Möglichkeiten des Marketings in die Webseiten miteinbezogen werden konnten. An dieser Stelle endet der historische Rückblick und wird ersetzt durch das Forschungsinteresse dieser Arbeit, dessen primäres Ziel eine Bestandsaufnahme der aktuell eingesetzten Spielfilmwebseiten, ihrer Inhalte, ihre multimedialen Typen, ihre Werbemethoden, ihrer interaktiven Elemente und ihrer Ziele darstellt. Dadurch soll eine Kategorisierung und Interpretation des Staus Quo von Spielfilmwebseiten ermöglicht und mit Eigenschaften der beworbenen Spielfilme in Verbindung gebracht werden. Dazu muss zunächst der Spielfilm selbst, das Internet und in weiterer Folge die Konvergenzen zwischen den beiden Medien aufgezeigt werden. Den hinter den Darstellungsformen im Internet verbergen sich viele, nicht offensichtliche, strukturelle
Bezüge zur filmischen Darstellungsform, die, gerade für diese Arbeit, von doppelter Bedeutung sind.
A hundred years after cinemas birth, cinematic ways of seeing the world, by structuring time, of narrating a story, of linking one experience to the next, have become the basic means by which computer users access and interact with cultural data.
Wenn sich zwei, prinzipiell unterschiedliche Medien, die das selbe Repertoire von Medienschemen bedienen, zu einer gemeinsamen Darstellungsform, der Spielfilmwebseite, vereinigen, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6129
Voigt, Roland: Spielfilmmarketing im Internet - Eine Erläuterung des Marketings für
Spielfilme im Internet anhand einer Produktanalyse von Spielfilmwebseiten
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Wien, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Einleitung
Seite:3
Inhalt:
1 Einleitung... 6
2 Problemstellung... 7
3 Theorie ... 9
3.1 Medientheorie ... 9
3.1.1 Massenmedien ... 9
3.1.2 Neue, interaktive elektronische Medien ... 10
3.2 Wirkungsforschung ... 11
3.2.1 Symbolischer Interaktionismus ... 11
3.2.2 Nutzung der Massenmedien... 12
3.2.3 ,Opinion Leader' Theorie ... 14
3.3 Semiotik ... 16
3.3.1 Metaphern ... 17
3.3.2 Filmbild ... 18
3.3.3 Bilder am Computer... 18
3.4 Mediendispostive ... 19
3.4.1 Webdispositiv... 20
3.5 Computervermittelte Kommunikation ... 21
3.5.1 Mensch-Mensch-Kommunikation... 22
4
Neue Medien / Internet ... 23
4.1 Neue Medien ... 23
4.1.1 Multimedia ... 23
4.1.2 Internet ... 27
4.1.3 Montage und neue Medien ... 34
4.1.4 Narration und neue Medien ... 37
4.1.5 Simulation und neue Medien ... 39
4.1.6 Webkunst... 41
4.2 Webdesign... 42
4.2.1 Content Design ... 43
4.2.2 Visuelles Design ... 47
4.2.3 Informationsdesign ... 48
Einleitung
Seite:4
4.2.4 Interaktionsdesign... 56
4.2.5 Kompabilitäts- und Performancedesign ... 61
5 Marketing... 63
5.1 Klassisches Marketing ... 63
5.1.1 Der Marketing-Mix ... 63
5.2 Marketing im Internet ... 66
5.2.1 Online Marketing Mix ... 67
6 Spielfilm... 71
6.1 Zielgruppe... 71
6.2 Spielfilmproduktion... 72
6.3 Genres ... 73
7 Spielfilmmarketing ... 76
7.1 Spielfilm-Marketing-Strategie... 76
7.1.1 High concept... 77
7.2 Spielfilm als Produkt ... 78
7.2.1 Spielfilm ... 78
7.2.2 Zweitauswertung / Merchandising ... 79
7.3 Werben für den Spielfilm... 79
7.3.1 Werbestrategie ... 80
7.3.2 Besonderheiten von Spielfilmwerbung... 81
7.3.3 Wirkung von Spielfilmwerbung... 82
7.3.4 Werbemittel der Spielfilmwerbung ... 87
8 Forschungsfragen
und Hypothesen ... 91
9 Forschungsdesign ... 95
9.1 Inhalts- bzw. Produktanalyse ... 95
9.2 Produktanalyse der Spielfilmwebseiten ... 96
9.2.1 Erkenntnisobjekt ,Spielfilmwebseite' ... 96
9.2.2 Ziel der Produktanalyse ... 97
9.2.3 Beschränkung des Datenmaterials ... 97
9.2.4 Datenquellen... 98
9.2.5 Methode... 98
9.2.6 Probleme bei der Produktanalyse... 99
Einleitung
Seite:5
10 Spielfilmwebseiten... 100
10.1 Definition ... 100
10.2 Theoretische
Betrachtungsweisen ... 100
10.2.1 Spielfilmwebseiten als Objekt der neuen Medien ... 100
10.2.2 Theoretische Aspekte ... 105
10.3 Zielgruppe
von
spielfilmspezifischen Webseiten ... 109
10.4 Marketing
auf
der Webseite ... 110
10.4.1 Marketingziele... 110
10.4.2 Webseite als Marketinginstrument... 110
10.4.3 Der Trailer und Spielfilmwebseiten ... 111
10.5 Ergebnisse
der
Produktanalyse ... 112
10.5.1 Übersicht ... 112
10.5.2 Die Performance... 114
10.5.3 Webdesign... 116
10.5.4 Onlinemarketing... 118
10.6 Content... 120
10.6.1 Formale Unterteilung in multimediale Typen ... 120
10.6.2 Externe Unterscheidungsmerkmale... 125
10.6.3 Inhaltliche Unterteilung ... 128
10.6.4 Zusammenfassung der Kategorien... 142
10.6.5 Genres und ihre inhaltliche Zusammenhänge ... 145
10.7 Ergänzungen... 146
10.7.1 Netzkampagnen... 146
10.7.2 Andere Online-Spielfilm-Medien ... 147
11 Resümee
und
Ausblick... 148
12 Literatur ... 151
12.1 Bücher und Online-Literatur ... 151
12.2 Hyperlinks ... 167
12.2.1 Online-Datenquellen ... 167
12.2.2 Spielfilmwebseiten ... 168
13 Abbildungsnachweis... 172
14 Anhang ... 174
Einleitung
1 Einleitung
Seite:6
Die Idee eine Diplomarbeit zum Thema Spielfilmwebseiten zu verfassen, kann auf
die Kombination meines subjektiven Interesses sowohl am Spielfilm und als auch am
Internet zurückgeführt werden. Ausgehend von der Idee, eine Webseite, ähnlich wie
einen Film, analytisch zu betrachten, musste ich feststellen, dass es zu Webseiten
von Spielfilmen keine Literatur gibt und es aufgrund der fehlenden Grundlagen
unmöglich erschien, den ursprünglichen filmanalytischen Ansatz in die Tat um zu
setzen. Die logische Folge aus dieser Erkenntnis war, das Thema der Diplomarbeit
derart zu verändern, das die Materie der Spielfilmwebseiten, auf einer allgemeinen
Ebenen, durch diese Arbeit erschöpfend beschrieben wird. Die Abkehr von den
filmanalytischen Aspekten der Spielfilmwebseiten war jedoch keine entgültige, da
sich im Laufe der Untersuchung herausstellte, dass das Kino, filmische
Darstellungsweisen und das Internet untrennbar miteinander verflochten sind und
sich einander immer weiter annähern. Die neuen Medien, und vor allem das Internet
sind in der Lage Inhalte und Darstellungsweisen von anderen Medien zu
übernehmen. Wenngleich das Internet, laut dem rieplschen
1
Gesetz, niemals die
anderen Medien verdrängen wird, so ist es sehrwohl in der Lage, diese zu
substituieren, zu simulieren und detailgetreu, innerhalb des eigenen Dispositives, zu
präsentieren. Gerade diese Eigenschaften machen das Internet für das
Spielfilmmarketing interessant, da sowohl Elemente der alten Medien, als auch neue,
interaktive Darstellungsformen benutzt werden können, um für den Spielfilm zu
werben.
1
Hagen, Riepls Gesetz im Online-Zeitalter Nach Riepl: Das Nachrichtenwesen des Altertums
Problemstellung
2 Problemstellung
Seite:
7
Diese Arbeit beschäftigt sich prinzipiell mit der Vermarktung von Spielfilmen.
Spielfilmmarketing, als relativ alte Form des Marketings, bestand jahrzehntelang vor
allem aus vor allem der Präsentation von Filmtrailern, Filmplakaten und der PR für
den Film. In den Siebziger Jahren erfolgte die Erweiterung des Spektrums an
Werbemöglichkeiten durch das Fernsehen, wodurch der Spielfilm zum
Markenprodukt stilisiert wurde.
2
Es wurden zwar neue Zielgruppen mit neuen
Methoden angesprochen, an den Argumenten und Techniken änderte sich hingegen
wenig. Erst Ende der Neunziger, kam, durch die Integration des Internets in das
Marketing für den Spielfilm, eine neue und innovative Darstellungsform hinzu.
Zunächst wurden, in einem kurzen, subjektiven und nicht durch empirische Daten
belegten historischen Rückblick, wohl rein repräsentative, ähnlich dem Filmplakat
gestaltete und kaum interaktive Webseiten im Internet präsentiert. Doch auch das
Internet und seine Darstellungsmöglichkeiten entwickelte sich weiter, sodass
Spielfilmwebseiten zunehmend multimedialer und interaktiver wurden, und andere,
innovativere Möglichkeiten des Marketings in die Webseiten miteinbezogen werden
konnten.
An dieser Stelle endet der historische Rückblick und wird ersetzt durch das
Forschungsinteresse dieser Arbeit, dessen primäres Ziel eine Bestandsaufnahme
der aktuell eingesetzten Spielfilmwebseiten, ihrer Inhalte, ihre multimedialen Typen,
ihre Werbemethoden, ihrer interaktiven Elemente und ihrer Ziele darstellt. Dadurch
soll eine Kategorisierung und Interpretation des Staus Quo von Spielfilmwebseiten
ermöglicht und mit Eigenschaften der beworbenen Spielfilme in Verbindung gebracht
werden.
Dazu muss zunächst der Spielfilm selbst, das Internet und in weiterer Folge die
Konvergenzen zwischen den beiden Medien aufgezeigt werden. Den hinter den
Darstellungsformen im Internet verbergen sich viele, nicht offensichtliche, strukturelle
2
Hediger, Verführung zum Film, S.202
Problemstellung
Seite:
8
Bezüge zur filmischen Darstellungsform, die, gerade für diese Arbeit, von doppelter
Bedeutung sind.
,,A hundred years after cinemas birth, cinematic ways of seeing the world, by
structuring time, of narrating a story, of linking one experience to the next,
have become the basic means by which computer users access and interact
with cultural data."
3
Wenn sich zwei, prinzipiell unterschiedliche Medien, die das selbe Repertoire von
Medienschemen bedienen, zu einer gemeinsamen Darstellungsform, der
Spielfilmwebseite, vereinigen, dann ist die Frage legitim, wie eine solche neue
Darstellungsform die dennoch bestehenden Gegensätzlichkeiten bewältigt und den
Spielfilm, geradezu selbstreflexiv, im Internet präsentiert.
Zur theoretischen Behandlung des Themas muss zunächst die theoretische
Handhabung des Mediums Internet bestimmt werden. Dabei müssen die
wesentlichen Aspekte aus dem breiten Spektrum wissenschaftlicher Ansätze, welche
von der Informatik, über die Psychologie, die Kommunikationswissenschaft bis zur
Soziologie reichen, selektiert und interpretiert werden. Interdisziplinarität
4
ist gefragt
um die entscheidenden Eigenschaften des Mediums Internets sichtbar zu machen
und mit den, ebenfalls zu definierenden, theoretischen Faktoren von Spielfilm und
Marketing in Einklang zu bringen.
3
Manovich, The Language of New Media S.78
4
Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.47
Theorie
3 Theorie
Seite:
9
Zunächst möchte ich die theoretischen Grundlagen der interpersonalen
Kommunikation und der Massenkommunikation anschneiden, da diese Theorien
grundlegend für des Verständnis des Internets und in weiterer Folge von
spielfilmspezifischen Webseiten sind.
3.1 Medientheorie
Da es laut Burkart
5
noch keinem für die gesamte Kommunikationswissenschaft
geltende, Definition eines Mediums gibt, müssen einige unterschiedliche Ansätze
betrachtet werden.
Kommunikationstechnisch gesehen, zeichnet sich, nach Saxer
6
, jedes Medium
einerseits durch ein gewisses kommunikationstechnologisches Potential und
anderseits durch ein bestimmtes, sich um diese Kommunikationstechnologie
bildendes Sozialsystem aus. Der Hinweis, dass es sich bei Medien um
Kommunikationskanäle mit integrierten Zeichensystemen, um arbeitsteilige
,Organisationen' und um gesellschaftliche ,Institutionen' handelt, charakterisiert den
Begriff Medium.
7
Betrachtet man die Medien kulturwissenschaftlich, dann sind alle
Kulturträger Medien und richten sich nach dem Leitsatz ,the medium is the message'
von McLuhan.
8
Er behauptet die vermittelte Botschaft wäre vom Medium abhängig
und erziele ihre Wirkung, unabhängig von den transportierten Inhalten, aufgrund der
medienspezifischen Veränderung der menschliche Erfahrung.
3.1.1 Massenmedien
Nach Maletzke
9
definieren sich Massenmedien über ihre öffentliche, indirekte und
einseitige Kommunikation, ihrer massenhaften Ansprache eines dispersen Publikums
5
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.39
6
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.39 Nach: Saxer, Das Buch der Medienkonkurrenz S.209f.
7
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.39 Nach: Saxer, Der Forschungsgegenstand der Medienwissenschaft S.14/19
8
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.33 Nach: McLuhan, The Global Village S.18
9
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.166f. Nach: Maletzke Psychologie der Massenkommunikation S.24/28f.
Theorie Seite:
10
und dem Aspekt
10
der technischen, massenhaft vervielfältigten und verbreiteten
Informationsvermittlung. Systemtheoretisch betrachtet ist, nach Luhmann
11
, das nicht
Sattfinden von Interaktion zwischen Sender und Empfänger grundlegend für
Massenkommunikation, was einen eigene Definition für die neuen, interaktiven
Medien erforderlich macht.
3.1.2 Neue, interaktive elektronische Medien
Um den weit gedehnten Begriff der ,neuen Medien' nicht all zu strapazieren, wird er
im folgenden mit dem Internet, also dem WWW und sämtlichen anderen
internetspezifischen Kommunikationsformen assoziiert.
Die von Maletzke erwähnten Merkmale eines Massenmediums treffen laut
Berghaus
12
auf das Internet nur bedingt zu, das es sämtliche dieser Eigenschaften
erfüllen kann, aber auch ebenso gut komplementäre, nicht massenmediale
Eigenschaften internalisiert. Daher kann das Internet nicht als Massenmedium,
sondern als ein Medium nach den Massenmedien, welches sämtliche klassischen
Massenmedien-Leistungen mit einschließt, oder als kommunikative Infrastruktur
13
zu
massenmedialen Vermittlung, bezeichnet werden. Dabei hat das Internet, aufgrund
der umfassend kulturprägenden Eigenschaften von Medien
14
, auch Einfluss auf das
traditionelle Mediensystem und beeinflusst Wahrnehmung, Wirkung und Inhalte der
alten Medien.
Ein weiteres typisches Merkmal der neuen Medien ist das Verschwinden oder die
Aufweichung des Sender-Empfänger Prinzips, wodurch sich der Rezipiente zum
Benutzer oder User wandet, und mittels Interaktivität die dargestellten Inhalte
selektieren oder verändern kann. Dieser Zugang zum Medium lässt beim Internet
eine gewissen hierarchie-abbauenden Tendenz erkennen. Überhaupt können, nach
10
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.35 Nach: Melezke, Psychologie der
Massenkommunikation S.32
11
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.36 nach Luhmann, Die Realität der
Massenmedien S.10f.
12
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.35
13
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.41. nach Langebucher, Ausbau des drucktechnischen
Kommunikationssystems, S.272
Theorie Seite:
11
Berghaus
15
, dem Internet jene gesellschaftskritischen
16
, emanzipatorischen
17
und
hierarchie-abbauenden
18
Funktionen zugeschrieben werden, die in der
Vergangenheit fälschlicherweise bereits den alten elektronischen Medien
unterstellten wurden. Allerdings muss hier Berghaus widersprochen werden, da das
Internet zwar in der Lage ist, das hierarchische Massenmedien-Modell zu
überwinden, aber bei weitem nicht all diese Funktionen zur Gänze erfüllen kann und
kein absolut hierarchieloses, demokratisches Medium ist. Das wäre auch gar nicht
möglich, da die reale, nach wie vor hierarchische, Gesellschaft innerhalb von
Computertechnologien repräsentativ abgebildet wird und so unmittelbar und
unverfälscht als eine Art Ikone der Gesellschaft betracht werden kann.
19
3.2 Wirkungsforschung
3.2.1 Symbolischer Interaktionismus
Die Wirkungsforschung beschäftigt sich mit den Wirkungen massenmedial
vermittelter menschlicher Kommunikation, welche nach Burkart
20
als symbolisch
vermittelte Interaktion begriffen werden kann. Die symbolisch vermittelte Interaktion
basiert auf einem Zeichenprozess, bei dem Zeichen in Form von Signalen oder
Symbolen, als, auf sozialen Interaktionen basierende Bedeutungsträger, fungieren
und das ,Verstehen' ermöglichen.
Das Gerüst des symbolisch vermittelten Kommunikationsprozesses
21
besteht aus
folgenden Faktoren:
· Kommunikator: Eine Person die ein Kommunikationsziel verfolgt.
14
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.34
15
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.38
16
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.37 nach Brecht, Radiotheorie, S.129
17
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.38 nach Enzensberger, Baukasten zu der
Theorie der Medien S.167/164/182
18
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.38 nach Meyrowitz Überall und nirgends
dabei, Bd. II S.54f
19
Winkler, Docuverse S.185f
.
20
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.42f.
21
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.61f.
Theorie Seite:
12
· Verständigung: Bedeutungsinhalte der medial verpackten Aussage, sowie das
Medium selbst.
· Rezipient: Eine Person an die die Botschaft gerichtet ist und deren Intention das
passive Verstehen der Mitteilung ist.
Die frühe Wirkungsforschung ging von einer instinktgesteuerten Wirkung der
Massenmedien aus und orientiert sich an den vom Kommunikator ausgesandten
Medienstimuli. Diese behavioristische Stimulus-Response-Theorie
22
wurde allerdings
widerlegt, woraufhin die Wirkungsforschung den Fokus weg vom Kommunikator
nahm und sich zu einer ,publikums'- oder ,rezipientenzentrierten' Perspektive
23
wandelte. Das Publikum wird ins Zentrum der Analyse gerückt und die Wirkung wird
mit der Nutzung der Medien durch die Rezipienten in Verbindung gebracht.
3.2.2 Nutzung der Massenmedien
3.2.2.1
Nutzenansatz bzw. der ,Uses-and-Gratifikation' Approach
Basierend auf dem Konzept des symbolischen Interaktionismus, geht der
Nutzenansatz davon aus, dass der Mensch die Massenmedien als
Gratifikationsinstanzen zur eigenen Bedürfnisbefriedigung benutzt.
24
Es wird der
Rezipient gemäß dem neobehavioristischem Stimulus-Organismus-Response Modell
als aktives, von Bedürfnissen gesteuertes, Wesen betrachtet, dass seine
Medienhandlungen vornehmlich nach persönlichen Nutzenerwägungen ausrichtet.
25
Auf der Suche nach Gratifikationen selektiert der Rezipient aktiv das vorhandene
Medienangebot und wählt, nach individuellen Kriterien, abhängig vom möglichen
Nutzen aus.
Dieses aktive Publikum definiert sich u.a. nach Rencksdorf
26
durch folgende
Eigenschaften:
22
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.192 Nach: Naschold, Kommunikationstheorien S.17
23
Rencksdorf, Neue Perspektiven In: der Massenkommunikationsforschung S.10f. In: Burkart, Kommunikationswissenschaft
S.217
24
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.219
25
Schweizer, Film als Marktleistung S.21
26
Renksdorf, Zum Modell zukünftiger Massenkommunikationsforschung S.15 In: Burkart, Kommunikationswissenschaft S.220f.
Theorie Seite:
13
· Das Publikum im Massenkommunikationsprozess zeigt ein aktives und
zielgerichtetes Handeln.
· Die Zielgerichtetheit resultiert nicht nur aus Prädispositionen, sondern vor allem
aus dem Ziel der massenmedialen Bedürfnisbefriedigung.
· Die Massenmedien stellen nur eine Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung dar
und stehen im Konkurrenzverhältnis zu anderen Gratifikationsinstanzen.
Medien bieten den potentiellen Rezipienten also lediglich Gegenstände, Handlungen
oder Ereignisse an, welche, abhängig von vorherigen Mediennutzung der
Rezipienten,
27
ihren Interessen, Bedürfnissen und Verwendungszusammenhängen
28
zur Rezeption angeboten werden. Ob und wie ein Rezipient diese Angebote nutzt,
hängt nur von ihm selbst ab, sodass jede Aussage in nahezu beliebiger Weise
interpretiert und benutzt werden kann.
29
3.2.2.2
Nutzung neuer Medien
Die neuen Medien, vor allem das Internets, als ein massenmedialer
Kommunikationsprozess betrachtet, hebt die hierarchische Struktur zwischen
Kommunikator und Rezipient auf und ermöglicht beiden Instanzen potentiell gleich
aktiv zu werden. Bei der Nutzung des Internets kann der Rezipient also die Rolle des
Kommunikators übernehmen und eigene Inhalte zur Rezeption anbieten.
Auf der Suche nach Gratifikationen selektiert der aktive Rezipient innerhalb des
gesamten, auch von Rezipienten produzierten, Medienangebotes und ordnet den
ausgewählten Inhalten mittels einem individuellen Interpretationsprozess
Bedeutungen zu.
30
Hinzu kommen beim Internet noch die durch die interaktive Nutzung ermöglichten
Gratifikationen, die durch die aktive Integration des Rezipienten in den
Kommunikationsprozess erreicht werden. Nach Schweizer
31
liegt eine aktive
27
Schweizer, Film als Marktleistung S.160
28
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.225 nach Rencksdorf, Zum Modell zukünftiger Massenkommunikationsforschung
S.174
29
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.224 nach Teichert, ,Fernsehen' als soziales Handeln, S.437f.
30
Berghaus, ,Alte' Theorien über ,neue' Medien In: Berghaus, interaktive Medien S.40
31
Schweizer, Film als Marktleistung S.31
Theorie Seite:
14
Integration nur dann vor, wenn der Rezipient gewisse Reaktionen auf die medialen
Stimuli zeitigt, die wiederum Einfluss auf die darauf folgenden medialen Stimuli
ausüben. Über Intensität und Ausmaß der nötigen interaktiven Möglichkeiten um
dem Rezipienten die nötige Gratifikation zu verschaffen, gibt es zwei Ansichten.
Während Schönbach
32
und Vorderer
33
meinen, bloße Selektion reiche bereits aus,
meint Rötzer
34
, partizipieren, eigenmächtig handeln und direkt angesprochen werden
wären der Wunsch der Nutzer beim aktiven Umgang mit den Medien und würde
ihnen erst die erwünschte Gratifikation liefern.
3.2.3 ,Opinion Leader' Theorie
In der klassischen soziologisch orientierten Wirkungsforschung
35
nimmt die
interpersonelle Kommunikation und somit der persönliche Beeinflussungsprozess
einen hohen Stellenwert ein und führt zu ,Opinion Leader' Theorie. Solche
Meinungsführer, gelten als besonders aktive Rezipienten die als Ratgeber oder
Vermittler mit der restlichen Bevölkerung fungieren und ein tragendes Element des
sogenannte ,two-step-flow of communication' darstellen.
36
Dieser vertritt die, bereits
falsifizierte, Theorie, dass die Massenmedien ausschließlich die Meinungsführer
ansprechen und beeinflussen und diese Meinungsführer daraufhin, mittels
interpersonaler Kommunikation, die restliche Bevölkerung mit dem massenmedial
vermittelten Inhalten vertraut macht.
Als typische Eigenschaften von Opinion Leaders
37
gelten:
· Starke und viele soziale Kontakte.
· Kommunikatives Verhalten, unter aktiver Anspruchnahme der Massenmedien.
· Sie kommen aus allen sozialen Schichten und erscheinen gegenüber ihrer
eingeschränkten sozialen Gruppe, als Experten, allerdings nur in einem
begrenzten Themenbereich.
32
Schönbach, Das hyperaktive Publikum S.280 In: Weischenberg, Interaktivität im Online-Journalismus
33
Vorderer, Will das Publikum neue Medien(-angebote)? S.503 In: Weischenberg, Interaktivität im Online-Journalismus
34
Rötzer, Interaktion - das Ende herkömmlicher Massenmedien S.67f. In: Weischenberg, Interaktivität im Online-Journalismus
35
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.206f. Nach Lazersfeld, Massenmedien und personaler Einfluss S.120
36
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.207 Nach Lazersfeld, The People´s Choice S.50f.
Theorie Seite:
15
· Sie haben ein überdurchschnittliches subjektives Interesse an dem betreffenden
Themenbereich.
Nach Lazersfeld
38
und Renckstorf
39
muss in Betracht gezogen werden, dass das
Erreichen der Rezipienten nicht auf eine unbedingte darauffolgende Beeinflussung
schließen lässt und gerade Meinungsführer sehr unabhängig und somit nur schwer
durch klassische Werbung erreichbar sind.
Neuere Studien
40
zur Opinion Leader Forschung widerlegen den zweistufigen
Diffusionsprozesse, da einerseits alle Rezipienten, also auch die wenig aktiven
Schichten, von den Massenmedien erreicht und beeinflusst werden und anderseits
die Meinungsführer kaum mit den wenig aktiven Schichten, sondern eher mit einer
dazwischenliegenden, am Thema interessierten bzw. ratsuchenden, Schicht
kommunizieren. Innerhalb dieser eingeschränkten Gruppe werden dann die
massenmedial vermittelten Inhalte thematisiert.
Massenmedium
,Opinion Leader'
Ratsuchende
Inaktive
Abb.1: Grefe/Müller 1976, S. 4028
37
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.208 Nach Eurich, Politische Meinungsführer
38
Stolle, Psychologisch Untersuchung der Filmwahrnehmung im Kino S.17 Nach Lazersfeld, The two-step-flow of
communication
39
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.209f. nach Rencksdorf, Die Hypothese des ,Two-Step-Flow' der
Massenkommunikation S.319
40
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.209f. nach Oberhauser, Interpersonale Kommunikation im
Massenkommunikationsprozess
Theorie Seite:
16
Man kann also davon ausgehen, dass die Diffusion von massenmedial vermittelten
Informationen direkt auch die inaktiven Schichten erreicht, diese potentiell in
zumindest interessierte Schichten umwandeln und so in den persuasiven
interpersonalen Kommunikationsprozess mit den Meinungsführern integriert. Der
Vorgang, wie nicht interessierte Schichten zu interessierten Schichten umgewandelt
werden, kann mittels der ,Agenda Setting'
41
Theorie erklärt werden, welche davon
ausgeht, dass Massenmedien nicht so sehr beeinflussen, wie wir denken, sondern
eher beeinflussen worüber wir nachdenken, also eine Thematisierungsfunktion
erfüllen. Haben die Massenmedien einmal diese Thematisierungsfunktion erfüllt,
werden die inaktiven Rezipienten zu interessierten Rezipienten und treten in den
interpersonalen Kommunikationsprozess mit den Meinungsführern ein. Im der obigen
Darstellung fehlen dem nach noch Verbindungslinien von den inaktivern zu den
ratsuchenden Rezipienten, welche die massenmedialen Einflüsse und
Zusammenhänge symbolisieren würden.
3.3 Semiotik
Die Semiotik, die Zeichenlehre, kann dabei helfen die Funktion von
Spielfilmwebseiten beschreibbar zu machen und dient auch als Grundlage der
Filmtheorie. Unterscheiden lassen sich die unterschiedlichen Zeichentypen nach
Eco
42
und Pierce
43
in:
· Ikonisches Zeichen. Weisen gemeinsame Merkmale mit dem Objekt auf und
sind am ehesten noch mit dem Wahrnehmungsmodell des Objektes
gleichzusetzen. (z.B. analoge Abbildungen, Fotografie)
· Indexikalisches Zeichen. Haben keine Gemeinsamkeiten mit dem Objekt,
stehen mit diesem allerdings in einer Kontiguitätsbeziehung.
(z.B. Thermometer als Index der Temperatur)
41
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.247
42
Eco, Einführung In: die Semiotik S.202f. In: Opl, Das filmische Zeichen S.58,59
43
Pierce, Collected Papers of Charles Sanders Pierce In: Nöth, Dynamik semiotischer Systeme S.13/14
Theorie Seite:
17
· Symbolische Zeichen, welche keine Gemeinsamkeiten mit dem Objekt
aufweisen und nur aufgrund einer Regel oder Konvention in Beziehung mit dem
Objekt gebracht wurde. (z.B. alle sprachlichen Zeichen)
3.3.1 Metaphern
Metaphern sind nach Gallas
44
Wörter, die aus dem eigenen
Bedeutungszusammenhang in einen anderen, im entscheidenden Punkt
vergleichbaren, aber doch ursprünglich fremden, übertragen werden. Diese
Überlappung an einen bestimmten Punkt führt zu einer eingeschränkten Ähnlichkeit
zwischen den Begriffen und kann mittels Substitution zur Definition einer Metapher
dienen. Lacan
45
beschreibt diesen Vorgang als Verdichtung, welche die Struktur der
Aufeinanderschichtung von Signifikanten beschreibt. Durch Verdichtung werden
Konnotationen akkumuliert, wodurch sich Metaphern an den einzelnen
Kontenpunkten der verschiedenen assoziativen Ketten bilden.
Untrennbar mit dem Begriff der Metapher verbunden ist die Metonymie, welche zwei
Begriffe aufgrund ihres nachbarschaftlichen Verhältnisses, also aufgrund von
Kontiguität, in Verbindung bringt. Diese beiden Begriffe sind nicht unabhängig von
einander, sondern die Metapher entsteht in Abhängigkeit von der Metonymie.
.
,,Der schöpferische Funke der Metapher entspringt zwischen zwei
Signifikanten, deren einer sich dem andern substituiert hat, indem er dessen
Stelle in der signifikanten Kette einnahm, wobei der verdeckte Signifikant
gegenwärtig bleibt und durch seine (metonymische) Verknüpfung mit dem
Rest der Kette. Ein Wort für eine anderes [substituieren] ist die Formel für die
Metapher."
46
Signifikate und Signifikanten verhalten sich laut Lacan so:
,,Der ersetzte, abwesende Signifikant wird unter der Sperre (barre) in den
Bereich des Signifikates gedrängt ,verdrängt' könnte man sagen -, aber
bleibt als ausgeschlossener, als abwesender Signifikant durch die
syntagmatische Beziehung zur übrigen Kette präsent."
47
44
Gallas, Das Textbegehren des ,Michael Kohlhaas' S.44
45
Lacan, Das Drängen der Buchstaben im Unterbewussten In: Winkler, Docuverse S.156f.f
46
Lacan, Das Drängen der Buchstaben im Unterbewussten In: Winkler, Docuverse S.159
47
Lacan, Das Drängen der Buchstaben im Unterbewussten In: Winkler, Docuverse S.159
Theorie Seite:
18
Umgelegt auf die Sprache umkreist diese die ausgelassene Stelle, welche sich hinter
der Sperre befindet und wird versuchen mittels Ersatzbildern die ausgelassene Stelle
zu markieren. Es gibt also eine Art Netz, das auch solche Elemente trägt, die in der
manifesten Kette keinen Platz haben, also solche die mittels Assoziationen die
Sperre überqueren, obwohl sie einem bewussten Zugriff nicht zugänglich sind.
3.3.2 Filmbild
Ein Filmbild stellt eine bestimmte, von vielen möglichen, ikonische Sichtweisen oder
ein Wahrnehmungsverhältnis eines Objektes dar, und niemals das Objekt selbst.
48
Ein Filmkader zeigt uns nicht nur, was dieser Betrachter sieht, somit auch wie er es
sieht, wodurch es zu einer Bedeutungskonstruktion durch das Filmbild kommt.
49
Denn Espe
50
wies nach, dass ikonische Bilder von identischen Objekten, mit
verschiedenen Kamerahandlungen aufgenommen, vom Rezipienten, anhand eines
Eindrucksdifferentials, verschieden beurteilt werden.
Zu beachten ist der Meta-Aspekt
51
von Filmbildern, da die Objekte die abgebildet
werden, bereits etwas für sich bedeuten, und es, aufgrund der
Bedeutungskonstruktion von Filmbildern, zu Verschiebungen kommt.
Standbilder als spezielle Form und Ikonographie suggerieren die Essenz des Filmes
zu kondensieren, und können dadurch auf diesen Hinweisen, werben und ihn im
Gedächtnis aufbewahren. Die Referenz des Standbildes auf das filmische Vorbild
funktioniert also nicht im exakten Bild-zu-Bild Bezug, sondern in der Relation des
Filmbildes zum ganzen Film.
52
3.3.3 Bilder am Computer
Da computergenerierte, synthetische Bilder keinen Abbildcharakter mehr aufweisen,
können sie das Reale nicht repräsentiert, sondern nur simulieren und interpretieren.
53
48
Opl, Das filmische Zeichen S.42
49
Opl, Das filmische Zeichen S.43 Nach: Balázs, Zur Kunstphilosophie des Films S.166
50
Espe,
Konnotationen als Ergebnisse fotografischer Techniken In: Opl, Das filmische Zeichen S.44
51
Opl, Das filmische Zeichen S.50
52
Sykora, Animation zum Bildermord In: Hemken, Bilder in Bewegung S.112
53
Winkler, Docuverse, S.191
Theorie Seite:
19
Computer stellen also Kontexte synthetisch her, indem sie vordefinierte
Grundelementen in syntagmatische Kombinationen bringen, während bei nicht
digitalen technischen Bildern, wie etwa Fotos oder dem Film, der Kontext immer
bereits vorhanden war.
54
Betrachte man Computer als die Infrastruktur einer mehrdimensionalen
Datenstruktur, so sieht Winkler
55
in zweidimensionale Bildern lediglich die visuelle
Oberfläche zur Interaktion mit diese Datenstruktur. Die Struktur der Bilder, und
natürlich auch anderer Darstellungsformen am Computer, ermöglicht demnach den
zeitlichen Zugriff auf semiotische Muster, welche sich unter der radikal konkreten
Oberfläche der Bilder verbergen. Gesteuert wird dieser Zugriff auf die Datenstruktur
über die Navigation, welche Manovich
56
mittels Semiotik beschreibt. Er kehrt dabei
das Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem um und verleiht dem Paradigma, in
Form einer Datenbank, eine reale Existenz. Durch individuelle Selektion der Daten,
dem einem rein virtuellen Vorgang der Navigation, entsteht dann ein syntagmatischer
narrativer Lesepfad durch die Datenstruktur. Dieser Ansatz ist grundlegend für die
Theorie der ,interaktiven Narration' welche im Kapitel 4.1.4, Narration und neue
Medien, näher beschrieben wird.
3.4 Mediendispostive
Das Dispositiv, die Wahrnehmungssituation, bezeichnet Foucault
57
als das Netz, das
zwischen den Elementen geknüpft werden kann. Dient das Dispositiv der
Strukturierung einer medienbedingten Rezeptionssituationen, kann man von einem
Mediendispositiv sprechen. Jedes Medium besitzt ein individuelles Dispositiv,
welches in seiner weitesten Auslegung, zum einen den äußeren Rahmen (z.B. Ort,
Zeit), in dem der Zuschauer Botschaften im jeweiligen Medium rezipiert beschreibt
und zum anderen kulturelle Traditionen und gesellschaftliche Konventionen als auch
spezifische Wahrnehmungsweisen der Zuschauer mit dem Medium verknüpft.
58
Es
54
Winkler, Docuverse, S.267
55
Winkler, Docuverse, S.187f.
56
Manovich, The Language of New Media S.229f.
57
Foucault, Dispositive der Macht S.119f. In: Hicketier, Film- und Fernsehanalyse S.19
58
Schweizer, Film als Marktleistung S.28
Theorie Seite:
20
wirken also technische Bedingungen, gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen,
normativ kulturelle Faktoren und mentale Entsprechungen zusammen.
59
Nach
Short
60
stellen Mediendispositive, bzw. Codierungsgrenzen ein System von Zwängen
dar, die sich nicht zuletzt als Beschränkung der verfügbaren kommunikativen
Ausdrucksvarianten und Handlungsmöglichkeiten manifestieren.
Die Bestimmung der Mediendispositive, also dem Wissen um die Mediensituation
61
des Mediennutzers, ist nötig, um kommunikative Handlung bewerten und analysieren
zu können. Dementsprechend ist zwar der Einfluss des Produzenten auf die Wahl
des Dispositives begrenzt, doch wird bei der Produktgestaltung aufgrund der
wechselseitigen Beziehung von Dispositiv und Produkt vielfach eine bestimmtes
Dispositiv vorausgesetzt.
62
Dem gegenüber steht der externe Faktor, der Rezipient,
63
dessen Programmentscheidung vom Dispositiv abhängig ist und der in den
Kommunikationsprozess integriert werden soll.
64
3.4.1 Webdispositiv
Das Wahrnehmungssituation des Internets kann aufgrund der flexiblen lokalen und
zeitlichen Verfügbarkeit als ein stark selbstbestimmtes Dispositiv
65
gesehen werden,
bei dem vielfältige Möglichkeiten der Selektion sowie der Simulation anderer
Mediendispositive besteht.
Vergleichbar mit dem Begriff des Dispositives, kann, immer dann wenn eine Medium
benutzt wird und damit eine gemeinsame Mediensituation hergestellt wird, von einem
Medienrahmen gesprochen werden. Im Fall des Computers von einem
computerbezogenen Medienrahmen, oder von einem Computerrahmen bzw.
Computerdispositiv.
66
Jede Kommunikationssituation impliziert bestimmte
59
Hicketier, Film- und Fernsehanalyse S.21
60
Short , The Psychology of Telecommunication S.43 In: Höflich, Computerrahmen und KommunikationS.1
61
Bonfadelli, Vom medienvermittelten zum multimedialen Lernen In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.136
62
Schweizer, Film als Marktleistung S.200
63
Schweizer, Film als Marktleistung S.155
64
Schweizer, Film als Marktleistung S.29
65
Schweizer, Film als Marktleistung S.68
66
Wetzstein, Datenreise S.14 In: Höflich, Computerrahmen und Kommunikation S.1
Theorie Seite:
21
Codierungen, die sämtliche Möglichkeiten als auch Grenzen beschreibt und sich
über das benutzte Medium definiert.
67
Bei der Rezeption von Spielfilmwebseiten gelten zunächst, wie auch sonst im
Internet, die Regeln und Konventionen die vom Computerrahmen vorgegeben
werden. Dazu kommen Einflusse der simulierten oder in die Webseite integrierten
Mediendispositive.
3.5 Computervermittelte Kommunikation
"This new, close relationship between authors and readers (or, more generally,
between producers of cultural objects and their users)[...] Rather, as we shift
from an industrial society to an information society, from old media to new me-
dia, the overlap between producers and users becomes significantly larger"
68
Als für die computervermittelte Kommunikation prägend erscheinen Faktoren wie
Feedback
69
, Interaktivität, Aufhebung der Sender-Empfänger-Prinzips und
Multimedialität. Ebenso dienen Hinweise, es handle sich um ein technisch
vermitteltes individuelles Massenmedium für Individual-, Gruppen- und
Massenkommunikation
70
oder um die bloße kommunikative Infrastruktur
71
dazu,
computervermittelte Kommunikation in seiner Vielschichtigkeit und theoretisch kaum
fassbaren Vielfalt zu beschreiben. Daher werden sich weitere Überlegungen auf jene
Aspekte der computervermittelte Kommunikation beschränken, die auch im Internet
Anwendung finden.
Die Aussagen, die radikalen Individualisierung
72
und Personalisierung der
Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, welche den Einzelnen selbst
bestimmen lässt, was und wie er kommuniziert und worüber er sich informiert oder
informieren lässt, dient ebenso wie der Annahme, alle Medien auf Netzwerk-Basis
67
Höflich, Computerrahmen und Kommunikation S.1
68
Manovich, The Language of New Media S.119
69
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.64
70
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.495
71
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.41. nach Langebucher, Ausbau des drucktechnischen
Kommunikationssystems S.272.
Theorie Seite:
22
würden einen Zugang zu konnektiver Informationsverarbeitung in Echtzeit
verschaffen, ohne den individuellen Input zu vernachlässigen oder zu eliminieren,
73
dem Verständnis dieses, die Grenzen der bisherigen Medien überschreitenden,
74
individuellen Multimediums.
3.5.1 Mensch-Mensch-Kommunikation
Betrachtet man die Kommunikation über das Internet beziehungsorientiert, also die
Kommunikation zwischen zwei Menschen vermittelt durch das Internet, so wird eine
Vielzahl von Faktoren evident. Nach Höflich
75
gilt die Zwischenschaltung eines
technischen Mediums in den Prozess der Kommunikation als grundlegend für
technisch vermittelte interpersonale Kommunikation, wobei das Potential des
Mediums, Interaktivität zu ermöglichen, wesentlich ist.
Dabei kommt es zu einer Art Entkontextualisierung
76
der virtuellen Räume, die
Kommunikation wird von den Zwängen der realen Orte befreit, zugleich aber auch
der gewohnten verbale und nonverbale Ausdrucksformen
77
als auch
Orientierungsmöglichkeiten beraubt. Durch das Fehlen derartiger
metakommunikative Hinweise, kommt es zwangsläufig zu Situationen in denen
offener und ehrlicher kommuniziert wird, aber auch zu Konstellationen mit
Verwechslungen und Täuschungen der Kommunikationspartners. Es wird also in
noch nicht alltäglichen Wirklichkeiten über alltägliche Wirklichkeiten kommuniziert.
78
Auch Aspekte der Anonymität
79
, der Deindividuation
80
, der Dehumanisierung
81
oder der Intersubjektivität
82
müssen Beachtung finden.
Entscheidend für den User ist, sich die Vorstellung, dass computerbasierte
Kommunikationsnetzwerke auch von anderen Netznutzern bevölkert sind
83
zu
72
Findte, Kommunikation im Internet S.15
73
Frindte. Kommunikation im Internet S.49 nach Vatimo, Medien-Welten-Wirklichkeit S.196
74
Frindte. Kommunikation im Internet S.25 nach Flusser, Die Schrift S.45
75
Höflich, Technisch vermittelte Interpersonale Kommunikation S.98 In:Frindte, Kommunikation im Internet S.179
76
Höflich, Computerrahmen und Kommunikation S.4
77
Goffman, Die Interaktionsordnung S.59 In: Höflich, Computerrahmen und KommunikationS.5
78
Findte, Kommunikation im Internet S.14
79
Lea , Love at first byte? S.202 In: Höflich, Computerrahmen und KommunikationS.5
80
Zimbardo, Psychologie S.717
81
Zimbardo, Psychologie S.718f.
82
Frindte. Kommunikation im Internet S.49 Nach Flusser, Kommunikologie S.213
83
Frindte. Kommunikation im Internet S.49
Theorie Seite:
23
versinnbildlichen und so dem stark reduzierten Gefühl der sozialen Anwesenheit,
auch ,social Presence'
84
genannt, welches auf die im Medium geringe Anzahl von
Kommunikationskanälen zurückzuführen ist, entgegenzuwirken.
84
Frindte, Kommunikation im Internet S.147 Nach Short, The social psychology of telecommunication S.55/65
Neue Medien / Internet
4 Neue Medien / Internet
Seite: 24
4.1 Neue Medien
Es gibt ein breites Spektrum von Funktionen und Anwendungen die man unter dem
Begriff ,,neue Medien" einordnen kann.
Diese Arbeit wird sich auf die Aspekte des Internets, des World Wide Web, dessen
Mulimediale Eigenschaften und den Zusammenhängen mit Spielfilmwebseiten
beschränken. Exakt betrachtet, sind Spielfilmwebseiten ein Teil des kommerziellen
Internets, angesiedelt in breitbandigen Netzwerken, mit zunehmendem Einfluss von
Offline-Medien wie PC und CD-Rom.
Das neue Medien Objekt ,Spielfilmwebseite' ist allgemein betrachtet ein Teil des
Marketings sowie der Präsentation von Produkten. Die Funktionen werden nach
Bauer
85
allerdings dem Offline Bereich zugeordnet, sodass Spielfilmwebseiten
sowohl Offline- als auch Online-Eigenschaften aufweisen.
,,[...] the computer media revolution affects all stages of communication, includ-
ing acquisition, manipulation, storage, and distribution; it also affects all types
of media texts, still images, moving images, sound, and spatial construc-
tions."
86
4.1.1 Multimedia
Der viel strapazierte Begriff ,Multimedia' etikettiert nach Burkart
87
eine Entwicklung,
die Fernsehgerät, Personalcomputer, Telefon und, aktuell betrachtet, auch
Videorekorder, HiFi-Anlage oder ähnliches, zu einer kommunikativen
Universalmaschine (Multi-Media-Station) in Form eines Personalcomputers,
vereinigt. Dadurch werden die technischen Voraussetzungen für die Realisierung von
Hypertextsystemen geschaffen
88
und sowohl Produzenten als auch Usern zur
85
Bauer, Electronic Commerce In: Berghaus, interdisziplinär vernetzt, S.89
86
Manovich, The Language of New Media S.19
87
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.357/358
88
Pfammatter, Hypertext das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.45
Neue Medien / Internet
Seite: 25
Verfügung gestellt. Burkart
89
nennt drei Merkmale die nötig sind um konvergente
Medien als multimedial bezeichnen zu können:
· Unterschiedliche Medientypen
· Digitalität
· Interaktivität
Ursprünglich als reines Präsentationsinstrument entwickelt, konnten sich
multimediale Anwendungen durch die Integration der Rezipienten, im Sinne von
Interaktivität, zu einem komplexen, aus Bild-Text-Ton zusammengesetzten,
Zeichensystem weiterentwickeln.
90
Dieses Zeichensysteme integriert eine Vielzahl
andere Medien, sodass es innerhalb eine Multimedia Anwendung zu Vermischungen
und Zitaten zwischen den unterschiedlichen Medientypen kommen kann.
91
Die
unterschiedlichen multimedialen Typen können sich ergänzen und Informationen
sowohl optisch, schriftlich und akustisch vermitteln, was zu einer verbesserten
Wahrnehmung beim Rezipienten führen kann. Allerdings besteht nach Hasenbrook
92
auch die Gefahr, dass die, von multimedialen Anwendungen ausgehenden multiplen
kognitiven Stimuli, durch die simultane Ansprache verschiedenster
Rezeptionskanäle, zu einer kognitive Überlastung der Rezipienten oder zu Effekten
negativer Interferenz führen. Diese Problem kann allerdings durch eine zielgerichtete
und den kontextuellen Anforderungen entsprechende Auswahl der
Kommunikationskanäle minimiert werden.
4.1.1.1 Hypertext
Um die unterschiedlichen Elemente und Eigenschaften von multimedialen
Anwendungen gemeinsam zu beschrieben, wird der Begriff ,Hypertext'
93
eingeführt,
welcher einen nicht-linearen, vom User durch Interaktion konstruierten, Gesamttext
bezeichnet. Gerade in Fällen wo die Datenmenge unüberschaubar scheint und das
89
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.357/358
90
Doelker, Multimedia ist Multikode In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.37
91
Manovich, The Language of New Media S.127
92
Hasebrook, Multimedia-Psychologie In: Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania
S.74
93
Doelker, Multimedia ist Multikode In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.38
Neue Medien / Internet
Seite: 26
Korpus zudem aus unterschiedlichen mulimedialen Dokumenten (Text, Bild, Audio,
Video) besteht, funktioniert laut Pfammatter
94
ein Hypertextsystem integrierend und
kann den Zugang erleichtern oder gar erst möglich machen, wobei er die explizite
Kontextualisierung von Informationen und die hohe Flexibilität im Zugriff auf Wissen
als das elementare Potential von Hypertext sieht. Dadurch werden
Fragmentierungen, Verknüpfungen, Intertextualität, nonlineare Strukturierungen und
perspektivische Rezeptionsangebote ermöglicht.
95
Gerade diese komplexe
assoziative Struktur von interaktiv miteinander verbundenen Verknüpfungen
96
ist
grundlegend für Hypertext und stellt eine Chance dar, die Informationsvermittlung
kreativ
97
zu unterstützen. Ebenso birgt diese Struktur die Gefahr in sich, dass
Zusammenhänge zu komplex oder assoziativ sind, um vom Rezipienten noch als ein
Gesamttext wahrgenommen zu werden und dieser nur noch fragmentarische, aus
dem Zusammenhang gerissene, Inhalte wahrnimmt.
Die typischen Charakteristiken von Hypertext sind laut Jonasson
98
:
1. Information fragments (Informationseinheiten/Content wie Text, Grafiken usw.)
2. Associate Links (Informationsverknüpfungen)
3. Paths (Vorgegebene oder variable Wege durch den Hypertext)
4. Network of Ideas (Dahinterstehender Grundgedanke; was will ich zeigen)
5. Organizational Structure (Struktur, wie zeige ich etwas)
6. Information Repräsentation (Mehrdimensionale Repräsentation)
7. Interactivity (Interaktive Navigation im Hypertext)
8. Dynamic control of Information (Kontrolle der Informationsfragmente durch
den User)
9. Idea generator (Lernen und Kreativität durch Hypertext)
10. Database (Speicherung des Contents)
11. Multi-Media-Information Environment (Unterschiedliche Medienarten,
Hypermedia)
94
Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.72
95
Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.48
96
Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.46
97
Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.47
98
Jonassen, Hypertext/Hypermedia In: Frindte, Kommunikation im Internet S.78
Neue Medien / Internet
Seite: 27
12. Software Environment (Technischer Hintergrund)
13. Multi-User-Access (Mehrere Benutzer gleichzeitig)
Nach Nelson
99
ist in der Hypertextforschung Nonlinearität das am häufigsten
angeführte distinktive Wesenmerkmal. Da das nonlineare Rezipieren, auch in
anderen, linearen Medien vorkommt, kann sie nur eine notwendige, nicht aber eine
hinreichende Bedingung für Hypertext sein. Es muss also eine nonlineare
Textstruktur auf inhaltlicher Seite, als auch eine physische (und virtuelle) Vernetztheit
des Computermediums vorliegen, um von Hypertext sprechen zu können.
4.1.1.1.1 Hyperlinks
,,Verknüpfungen (linking) ist die fundamentale Idee von Hypertext. Das in einer
Menge verknüpfter Objekte dargestellte Wissen ist komplexer als in der
Gesamtheit isolierter Objekte dargestellt."
100
Hyperlinks oder Verweise zwischen ,Nodes' bilden die makrostrukturellen
Grundelemente vom Hypertext und verbinden Multimedia-Elemente, also
Informationseinheiten oder ,Informationelle Einheiten'
101
. Diese interaktiven
hypermedialen Hyperlinks
102
zwischen Texten oder Textfragmenten, Tabellen,
Graphiken, Bildern, Videos, Sprache, Geräuschen, Musik oder anderen
hypertextinternen Applikationen, dienen grundsätzlich der Navigation im Hypertext,
wobei die chronologische Auswahl der Hyperlinks durch den Rezipienten Lesepfade
bildet und sich so für jeden Benutzungsvorgang und jeden Rezipienten
unterschiedliche Kontexte manifestieren.
103
Die Kontexte entstehen aufgrund der
Interpretation der individuell selektierten Inhalte durch den User. Der Einfluss des
Autors des Hypertextes beschränkt sich auf die Vorselektion der Inhalte und
Strukturierung der möglichen Verknüpfungen.
104
Darauf Aufbauend muss
99
Nelson, Getting it out of our system In: Schecter, Information retrival S.195 In: Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept
In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.49
100
Kuhlen, Hypertext S.99 In: Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.55
101
Kuhlen, Hypertext S.79f. In: Pfammatter, Hypertext-das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.54
102
Manovich, The Language of New Media S.38
103
Pfammatter, das Multimediakonzept In: Pfammatter, Multi-Media-Mania S.59
104
Gilster, Digital literacy S.127
Neue Medien / Internet
Seite: 28
angenommen werden, dass sich in der Struktur der Hyperlinks stets bestimmte
Intentionen des Autors manifestieren, welche auf individuellen Wegen rezipiert
werden können, aber durch Interpretation wahrgenommen werden. .
4.1.1.2
Mensch-Maschine-Kommunikation bzw. Interface
Der Vorgang des Interagierens oder Navigierens im Hypertext kann als eine Art
informationsorientierte Kommunikation des Menschen mit einer Maschine, in diesem
Fall einem Computer gesehen werden. Diese Art der Kommunikation steht
stellvertretend für die interpersonale Kommunikation
105
und zielt darauf ab, mittels
Feedback, eine Interaktion zwischen Mensch und Computer zu ermöglichen und
Informationen zu vermitteln. Daher ist es nötig, eine, an die Kommunikationsziele
und die Datenstruktur angepasste Schnittstelle mit dem Computer zu entwerfen. Ein
solches HCI
106
(Human-Computer-Interface) dient primär der Navigation durch den
Hypertext und beschreibt, wie Interaktivität zwischen User und Computer ablaufen.
Ein solches Interface regelt wie Daten selektiert, manipuliert und Maschinen
gesteuert werden.
107
Das primäre Interface der, für die Arbeit relevanten, Personal Computer, nimmt die
,Fenster' Metapher in Anspruch um den Usern Inhalte zu vermitteln. Auf einer
sekundären Ebene, also innerhalb der ,Fenster' Metapher, werden Webseiten
präsentiert, welche eigene Interfaces nutzen um dem User zugriff auf Daten zu
ermöglichen. Auch Webseiten benutzen Metaphern um den Zugriff auf
Datenstrukturen begrifflicher zu gestalten
108
und greifen dabei gerne auf, aus der
realen Welt bekannte, Konventionen zurück.
,,[...], HCI designers borrow ,conventions' of the human made pysical environ-
ment.[...]"
109
105
Frindte, Kommunikation im Internet S.142
106
Manovich, The Language of New Media S.69
107
Manovich, The Language of New Media S.72
108
Manovich, The Language of New Media S.69
109
Manovich, The Language of New Media S.89
Neue Medien / Internet
Seite: 29
4.1.2 Internet
4.1.2.1 TCP/IP
Ausgehend von der, ursprünglich militärischen Idee ein dezentrales
Computernetzwerk zu entwickeln entstand vor einigen Jahrzehnten das TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoll, welches die Grundlage
für das Internet bildet. Es ermöglich durch einen Zusammenschluss von regionalen,
nationalen und übernationalen Computernetzwerken
110
jedem an das Internet
angeschlossen Computer mit jedem anderen an das Internet angeschlossenen
Computer Verbindung aufzunehmen, zu kommunizieren und Daten auszutauschen.
4.1.2.2 HTML
Die Hypertext Markup Language, kurz HTML ist eine einfache, universelle,
abwärtskompatible, Betriebsystem und Browser-Übergreifende Programmiersprache
zur Anfertigung von Webdokumenten.
Sie kann von HTML-Browsern wie Internet Explorer oder dem Netscape
Communicator verstanden und dargestellt werden.
111
Die Identifikation von HTML-
Dokumenten im weltweiten Internet erfolgt über den einzigartigen ,Uniform Resource
Locator', kurz URL
112
, welche auch als ,Namen' der Webseite bezeichnet werden
kann.
Aufgrund seiner modularen Struktur, kann HTML ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Medientypen transportieren und anzeigen.
"Yet another example of modularity is the structure of an HTML document:
With the exemption of text, it consists of a number of separate objects Gif
and JPG images, media clips, Virtual Reality Modeling Language (VRML)
scenes, Shockwave and Flash movies which are stored independently, lo-
cally, and/or on a network."
113
4.1.2.3
World Wide Web
Das World-Wide-Web ist eine, auf HTML basierende Benutzeroberfläche des
Internets und wird oft verallgemeinernd als das ,Internet' betrachtet, auch wenn es
110
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.367
111
Jean-Richard, WebDesign in der Praxis S.75
112
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.363
Neue Medien / Internet
Seite: 30
nur ein Teil davon ist und auch Anwendungen wie Email oder ,ftp' dem Internet
zuzurechnen sind. Das WWW gilt als spezielle Anwendung eines Hypertextes, bei
dem über ein Netzwerk auf multimediale Elemente zugegriffen wird.
114
Das dabei
entstehende, weltweit verzweigte Hypertext-Informationssystem eröffnet jedermann
die Möglichkeit, Informationen ins Netz einzuspeisen und auf einer Webseite oder
Homepage zu präsentieren.
115
Wesentliche Eigenschaften und Vorteile des World-Wide-Web sind, wie der Name
schon sagt, seine weltweite Verfügbarkeit, die Möglichkeit das Online-Angebot
zeitlich autonom zu rezipieren und der Zugriff auf ein unerreicht breites Spektrum an
Informationen.
116
4.1.2.4 Connectivity
Die Internet Connectivity, also die ,Verbundenheit' mit dem Internet, stellt ein
wichtiges Maß über die potentiell erreichbaren Bevölkerungsschichten dar. Vor allem
die nötige technische Infrastruktur stellt eine große Hürde dar, zumal sich ein
Großteil der Weltbevölkerung diese nicht leisten kann.
117
Für das relevante
Österreich gelten nach Angaben der ORF Meinungsforschung
118
für das vierte
Quartal 2001 folgende Connectivity-Daten:
Die technischen Voraussetzungen zur privaten Internetnutzung erfüllen 42% aller
Österreicher, da sie über einen eigenen PC mit Internetzugang verfügen. Inklusive
allen anderen Möglichkeiten in das Internet einzusteigen, haben insgesamt 53% der
Österreicher über 14 Jahre Zugang zum Internet.
Für jeden Österreicher fallen dabei durchschnittlich 13 Internet-Sessions pro Monat
an, wobei die durchschnittliche Verweildauer im Internet 28 Minuten beträgt.
Die Zielgruppe der Internet-User kann generell als relativ jung, nach wie vor
männlich dominiert und gut ausgebildet bezeichnet werden.
113
Manovich, The Language of New Media S.30
114
Manovich, The Language of New Media S.38
115
Burkart, Kommunikationswissenschaft S.363
116
Weischenberg, Interaktivität im Online-Journalismus
117
Weischenberg, Interaktivität im Online-Journalismus
118
http://meinungsforschung.orf.at
Neue Medien / Internet
Seite: 31
Die Gruppe der intensiven Internetnutzer setzt sich aus 61% männlichen und 39%
weiblichen Personen zusammen, wobei das Bildungsniveau mit 38%
Matura/Universität und 43% mit zumindest einem Fachschul- oder Lehrabschluss
relativ hoch ist. Altersmäßig surfen, obwohl die Internet User laufend älter werden,
die 14 bis 29 jährigen am regelmäßigsten und häufigsten. Denn demografisch
gesehen, stellen die 14 bis 29 Jährigen 23% der Gesamtbevölkerung, machen aber
immerhin 37% aller intensiven Internetuser aus.
4.1.2.5 Flash-Technologie
Flash-Filme, Animationen, Spiele oder ähnliches sind, sofern sie auf Webseiten
eingesetzt werden, prinzipiell nur auf HTML basierende hypertextuelle Elemente die
entweder in Kombination mit anderen hypertextuellen Elementen oder für sich allein
stehen. Flash-Elemente dienen oft nur als interaktive, animierte und vertonte
Zusatzelemente zur ästhetischen Aufbesserung der HTML Seite. Die Flash-
Technologie
119
ermöglicht aber auch die Gestaltung kompletter Webseiten, mit
Hyperlinks, interaktiven Elementen, Datenbankzugriffen und anderen hypermedialen
Eigenschaften. Dabei ermöglicht es Flash, sämtliche Elemente interaktiv zu
gestalten, zu animieren und mittels weicher und harmonischer Bewegungen den
Besucher zu faszinieren.
Besonderst von Bedeutung ist, dass Flash, innerhalb bestimmter Grenzen, geeignet
erscheint Drehbücher zu realisieren und videoähnliche interaktive Sequenzen zu
ermöglichen. Diese Eigenschaft befähigt die Flash Technologie, film- oder
trailerähnliche Webseiten zu produzieren, den Film zu simulieren und im WWW zu
publizieren. Es ermöglicht also Inhalte, die zuvor nur auf CD-Rom möglich waren,
auch im Internet zu präsentieren, und kann daher als das Bindeglied zwischen der
CD-Rom und dem Internet gesehen werden. Das lässt sich, nach
Busche,
120
auf die multimedialen und interaktivern Eigenschaften zurückführen,
welche es ermöglichten, modellhafte Abbildungen der Wirklichkeit zu gestalten, sie
zu simulieren. Außerdem spricht Flash ein junges, dynamische Publikum an und
119
Busche, Das Einsteigerseminar Macromedia Flash 5 S.11f.
120
Busche, Das Einsteigerseminar Macromedia Flash 5 S.27f.
Neue Medien / Internet
Seite: 32
erlaubt den Einsatz dramatischer Momente und kommt so Multimedia und Film
bedeutend näher als dies HTML Seiten zustande bringen könnten. Aus diesen
Gründen ist die Flash-Technologie gerade für Spielfilmwebseiten besonders geeignet
und wird auch dementsprechend oft eingesetzt.
Ohne im Detail auf die technologische Spezifikationen eingehen zu wollen, baut
Flash auf kleinen Vektorgrafiken auf und ermöglicht so eine erhebliche
Datenreduktion gegenüber anderen Technologien, was den Einsatz im WWW erst
ermöglicht. Da Spielfilmwebseiten viel mit Fotos und Filmausschnitten arbeiten,
welche aber nicht als Vektorgrafiken gespeichert werden können, sind sie nur
bedingt in der Lage diesen Größenvorteil auszunützen, was dazu führt, das
Spielfilmseiten enorme Datenmengen benötigen und nur in breitbandigen Netzen
und auf schnellen Computern voll zur Geltung kommen.
4.1.2.5.1 Flash-Animationen/Trailer
Flash-Animationen setzen sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen,
wobei Vektorgrafiken, Bilder und Schriftzüge zu den wichtigsten zählen. Vor allem für
die Gestaltung von Flash Trailer sind typographisch gestaltete Schriftzüge mit
piktoraler Qualität oder Rolltitel wie in klassischen Filmtrailern, entscheidend für die
Nachgestaltung filmischer Realität.
121
Ähnliches wird der Bewegung der Schriftzüge, aber auch aller andren bewegten
Flash-Elemente zugeschrieben. Denn ihre Bewegungs-Qualitäten
122
exemplifizieren
den Film, denotieren diesem und das Erlebnis das dem Film zugeschrieben werden
soll.
123
,,So schafft das Zusammenspiel von Text und Bild semantische Redundanzen,
die dazu beitragen, dass die Mitteilung besser erinnert wird"
124
Bedeutung, vermitteln Animationen, und damit auch Flash-Animationen, nicht durch
die Zeichnungen, Schriften oder Bilder die sich bewegen, sondern sie entsteht
121
Hediger, Verführung zum Film S.28
122
Arns, Texte, die (sich) bewegen
123
Hediger, Verführung zum Film S.28
124
Schmitt, Texte und Bildrezeption bei Werbespots S.158f. In: Hediger, Verführung zum Film S.230
Neue Medien / Internet
Seite: 33
zwischen den Kadern, in den Zusammenhängen und Kontexten, und nicht im
jeweiligen Kader selbst.
125
Entscheidend ist also die Kunst, die unsichtbaren
Zwischenräume zwischen den Kadern mit Kontexten zu füllen, also deren
zielgerichtete narrative Montage.
4.1.2.6
Audiovisuelle Medien im Internet
4.1.2.6.1 Auditive
Elemente
Nach Nielsen
126
bieten auditive Elemente im Internet den großen Vorteil, unabhängig
von der Darstellung am Bildschirm kommunizieren zu können, wodurch ein weiterer
Wahrnehmungskanal aktiviert wird. Außerdem ist der Audiokanal dem bewegten
visuellen Kanal qualitativ noch überlegen und vermittelt daher eine besseren
Eindruck als die oft qualitativ minderwertigen Videos. Ton kann dazu genutzt werden
dem User Feedback auf eine Interaktionen zu geben, Stimmung oder Atomsphäre zu
verbreiten, musikalisch zu unterhalten oder zu informieren.
4.1.2.6.2 Video
Elemente
Die Entwicklung der bewegten Bilder am Computer vergleicht Manovich mit der
Historie des Kinos:
"It would be not entirely inappropriate to read this short history of the digital
moving image as a teleological development which replays the emergence of
cinema a hundred years earlier. Indeed, as computers' speed keeps increas-
ing, the CD-ROM designers have been able to go from a slide show format to
the superimposition of small moving elements over static backgrounds and fi-
nally to full-frame moving images. This evolution repeats the nineteenth cen-
tury progression: from sequences of still images (magic lantern slides presen-
tations) to moving characters over static backgrounds (for instance, in
Reynaud's Praxinoscope Theater) to full motion (the Lumieres' cinemato-
graph)."
127
Die Evolution der Bilder wiederholt sich also am Computerbildschirm, wenngleich die
Entwicklung bei weitem rasanter voranschreitet als bei der Entwicklung des Kinos.
125
Weibel, Zur Geschichte und Ästhetik des digitalen Bildes
In: Hemken, Bilder in Bewegung S.219
126
Nielsen, Web Design, S.154f.
127
Manovich, What is digital cinema?
Neue Medien / Internet
Seite: 34
"Thus, exactly a hundred years after cinema was officially `born', it was rein-
vented on a computer screen."
128
Es gibt eine Vielzahl von Videoformaten im Internet, die von verschiedenen
Herstellern (z.B. Quicktime, Real Networks, Windows Media u.v.a) sind und auf
unterschiedlichen, verlustbehafteter Komprimierungsalgorithmen
129
aufbauen.
Abhängig vom gewählten Videoformat und der Auflösung des Videos, lassen sich
unterschiedliche Videoqualitäten erzielen, wobei die Palette von sehr kleinen, kaum
erkennbaren bis zu bildschirmfüllenden, qualitativ an das Fernsehbild
heranreichende Videos reicht. Entscheidendes Kriterium bei der Selektion von
Qualitätsmerkmalen der Videodaten ist die Kombination von Dateigröße und
vorhandener Bandbreite. Deshalb werden Videos aller Formate oft in
unterschiedlichen Größen bzw. Qualitätsmerkmalen für unterschiedliche
Bandbreiten
130
zum ,download' oder ,streamen' angeboten. Beim Video ,download'
werden die kompletten Videos auf die Festplatte des Users heruntergeladen und dort
dauerhaft gespeichert, während beim Video ,streaming' das Video sofort am
Bildschirm startet und kontinuierlich abgespielt wird, und keine Kopie auf der
Festpatte entsteht. Zusätzlichen können noch videoähnliche Flash-Animationen zu
den Möglichkeiten der audiovisuellen Präsentation gezählt werden. Bei diesen
videoähnlichen Flash-Animationen handelt es sich, wie bereits kurz im Flash
Kapitel angedeutet, um Animationen, die zumeist aus einer kontinuierlichen Abfolge
von Standbildern, ähnlich einer Diashow, bestehen. Mittels einer hohen
Bildwechselfrequenz, Überblendungen, Ton und Schrifttiteln, lassen sich so narrative
Videos und trailerähnliche Bildsequenzen generieren und direkt in die Webseite
integrieren. Die einfachste Variante sind direkt auf der Webseite ablaufende
Videoschleifen, also Loops,
131
welche durch ihre sequenzielle Wiederholungen eine
kontinuierliches, narratives Ereignis bewirken.
128
Manovich, What is digital cinema?
129
Manovich, The Language of New Media S.54
130
Manovich, The Language of New Media S.39
131
Manovich, The Language of New Media S.316
Neue Medien / Internet
Seite: 35
Das Internet bietet zusätzlich die spezielle Eigenschaft Navigationselemente im, am
Computer dargestellte Videos, integrieren zu können, wodurch die Realisation von
interaktiven Videos möglich gemacht wird. Das ist ein wichtigen Bestandteil der
audiovisuellen, räumlich narrativen Kultur der Computertechnologie
132
und hat
erheblichen Einfluss auf die Wirkung von Webseiten, vor allem von
Spielfilmwebseiten.
4.1.3 Montage und neue Medien
Filmische Montage, als die handwerkliche Aneinanderreihung von Bild- und
Tonsegmenten, wird oft als Grundlage der Filmkunst
133
bezeichnet. Die
Verbindungen unterschiedlicher Ansichten eines einzelnen oder verschiedener
Objekte ermöglicht, mittels Einstellungsverkettungen
134
potentielle Zusammenhänge
herstellen und sichtbar zu machen, um so Bedeutungen zu vermitteln.
135
Als
Funktionen der Montage sieht Peach
136
die künstlerische Nachgestaltung der
Wirklichkeit (Mimesis), die Konstruktion von Bedeutung aber auch die Dekonstruktion
bestehender Zusammenhänge und ihre Auflösung in Elemente.
Montage bildet, als eine produktive Form der zeitlichen Gestaltung filmischer
televisueller Abläufe das Kernstück filmischer Narration.
137
Ohne auf die
vielschichtigen, unterschiedlichen, historischen und aktuellen, bereits ausführliche
von Gunning
138
, Schumm
139
, Eisenstein
140
, Monaco
141
und vielen anderen
beschrieben, zeitlichen Montageformen eingehen zu wollen, kann behauptet
werden, dass alle diese hintereinander ablaufenden Montageformen, mehr oder
weniger erfolgreich, auch im Internet, im Rahmen von Filmausschnitten oder Trailern,
aber auch in Flash-Filmen und Navigations-Pfaden, zu Bedeutungskonstruktion
eingesetzt werden können.
132
Manovich, The Language of New Media S.157
133
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.145f.
134
Schumm, die Macht des Cut In: Naumann, Vom Doppelleben der Bilder S.250f.
135
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.145
136
Paech, Literatur und Film S.129
In: Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.144
137
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.145
138
Gunning, Non-Continuity, Continuity, Discontinuity S.100f.
139
Schumm, Die Macht des Cut In: Naumann, Vom Doppelleben der Bilder S.250f.
140
Eisenstein, Schriften 2
141
Monaco, Film verstehen S.428
Neue Medien / Internet
Seite: 36
Im Internet kann durch Interaktion und Selektion vom Bild, Ton oder anderen
Multimedia-Elementen durch den User, eine andere Art der zeitlichen Montage, eine
individuelle ,interaktive Montage' beobachtet werden. Abhängig vom Leseweg des
Users werden unterschiedliche Inhalte und Medientypen montiert und so zueinander
in Verbindung gesetzt, sodass die Webseiten vom User individuell wahrgenommen
wird. Zum Teil vom User abhängig ist auch die ,innere Montage', die eigentlich ein
Teil der Bildkomposition ist und eine räumliche Montageform darstellt. Hickethier
142
bezeichnet, für den Film, collageartige übereinandergeschichtete Bilder als einen Teil
der inneren Montage, und bezieht die Bildbearbeitung von Einzelbildern oder
Einstellungen mit ein. Durch assoziatives Anspielen von konventionalisierten Bildern
und durch eine Aufsplitterung, eine Grafisierung der Abläufe und Formen, kommt es
zu einer Auflösung der kontinuierlichen Bildräume, wodurch die Grundlage für
interaktives Erzählen geschaffen wird. Diskontinuität und Parallelität im Film, also der
Wandel von, zumindest prinzipiell linearen Erzählstrukturen hin zu parallel
ablaufenden Erzählmustern, ist ein typisches Merkmal moderner Filmsprache und
wird von Hickethier
143
mit dem bisherigen Filmkonsums der
Rezipienten und der
daraus resultierenden Kenntnis filmischer Erzählmuster begründet. Manovich
144
hingegen geht einen anderen Weg und führt diesen Trend zur Räumlichkeit auf, vom
Internet geprägte, Rezeptionsstrukturen zurück. Derartige, auf Diskontinuitäten und
räumliche parallelen Darstellungen basierende, Wahrnehmungsstrukturen
bezeichnet er als räumliche Montage und erkennt darin eine Alternative zur
traditionellen, zeitlichen Montage.
145
,,[...] two images at once, side by side. This can be thought as the simplest
case of spatial montage. In general, spatial montage could involve a number
of images, potentially of different sizes and proportions, appearing on the
screen at the same time."
146
142
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.164f.
143
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.167
144
Manovich, The Language of New Media S.144f.
145
Manovich, The Language of New Media S.322
146
Manovich, The Language of New Media S.322
Neue Medien / Internet
Seite: 37
In der Präsentation von unterschiedlichen, nebeneinander auf dem Bildschirm
platzierten, Medieninhalten und Typen, erkennen sowohl Manovich
147
als auch
Hickethier
148
das Potential zu Generierung von Bedeutung und Kontext.
Jedes räumlich platzierte Element, trägt dem nach einen mehr oder weniger
ausgeprägten Kontext in sich. Betrachtet man nun alle räumlich angeordneten
Elemente als ein Ganzes, so wird ein kombinierter Gesamtkontext
wahrgenommen,
149
welcher mehr als die Summe der einzelnen Teile darstellt.
150
Das
allerdings unterscheidet die räumliche zwar nicht von der zeitlichen Montage, bietet
aber einen anderen Ansatz zur Interpretation, welcher nicht mehr von einem
einzelnen, die Projektionsfläche komplett ausfüllenden, Bild ausgeht sondern sich mit
räumlich gleichzeitigen und überlagerten Bildern auseinandersetzt.
Wenn also die zeitliche Montage als das Kernstück filmischer Narration gehandelt
wird, dann kann erwartet werden, dass die räumliche Montage, in Kombination mit
ebenso vorhandenen Elementen filmsicher Montage, das Kernstück der Narration im
Internet bildet.
Ersetzende räumliche
Montage (1)
Ersetzende räumliche
Montage (2)
Fensterbasierende räumliche
Montage
Abb.2: Arten räumlicher Montage (
http://www.thefastandthefurious.com/
, 26.1.2002;
http://www.clubmoulinrouge.com/
, 25.1.2002)
147
Manovich, The Language of New Media S.315
148
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.167
149
Manovich, The Language of New Media S.322f.
150
Schweiger, Werbung S.114 In: Schweizer, Film als Marktleistung S.78
Neue Medien / Internet
Seite: 38
Alle Arten der Montage werden im Internet am selben Bildschirm präsentiert und vom
User interaktiv selektiert und platziert, wodurch sie kollektiv wirken und sich
gegenseitig beeinflussen.
Da die meisten der auf Spielfilmwebseiten vermittelten Inhalte auf einer kontextuellen
Ebene, mehr oder weniger intensiv, mit dem Spielfilm zusammenhängt oder filmisch
montiert sind, kommt auf Spielfilmwebseiten eine weiterer Aspekt hinzu. Werden
diese filmischen, vormontierten Inhalte nun zusätzlich räumliche angeordnete und
interaktiv selektiert, einsteht eine ,Meta-Montage' bei der neue, narrative
Zusammenhänge zwischen den montierten filmischen Elementen entstehen. Das
unterscheidet Spielfilmwebseiten stark von anderen, nicht auf filmischem Material
basierenden Webseiten und ermöglicht das entstehen individueller Kontexte.
4.1.4 Narration und neue Medien
Das Narrative, das Zeigen und Erzählen, gilt nach Hickethier
151
als grundlegend für
Sinnstiftung und Sinnvermittlung beim Film, wobei Erzählen bedeutet, einen eigenen,
gestalteten (d.h. ästhetisch strukturierten) Kosmos zu schaffen, etwas durch Anfang
und Ende als etwas in sich Geschlossenes zu begrenzen und zu strukturieren.
Lacey
152
sieht in der klassischen Narration eine Informationsvermittlung, wobei
narrative Informationen durch eine logisch strukturierte Sequenz von
zusammengehörenden Ereignissen vermittelt werden. Bestehend aus zumindest
zwei zusammengehörenden, räumlich und zeitlich montierten Ereignissen, entsteht
Bedeutung aus der Summe der beiden Ereignisse.
,,Die technisch bedingten audiovisuellen Medien können in komplexer Weise
Raum und Zeit variieren und kombinieren."
153
Nach Hickethier
154
ist für die Erzählung, die Sukzession und das Nacheinander des
Erzählens bestimmend, während im Bild das Nebeneinander des Gezeigten in den
151
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.110f.
152
Lacey, Narrative and Genre S.13/14
153
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.112
154
Hickethier, Film- und Fernsehanalyse S.112
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832461294
- ISBN (Paperback)
- 9783838661292
- DOI
- 10.3239/9783832461294
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Human- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kino kommunikationswissenschaft webdesign interaktivität werbung
- Produktsicherheit
- Diplom.de