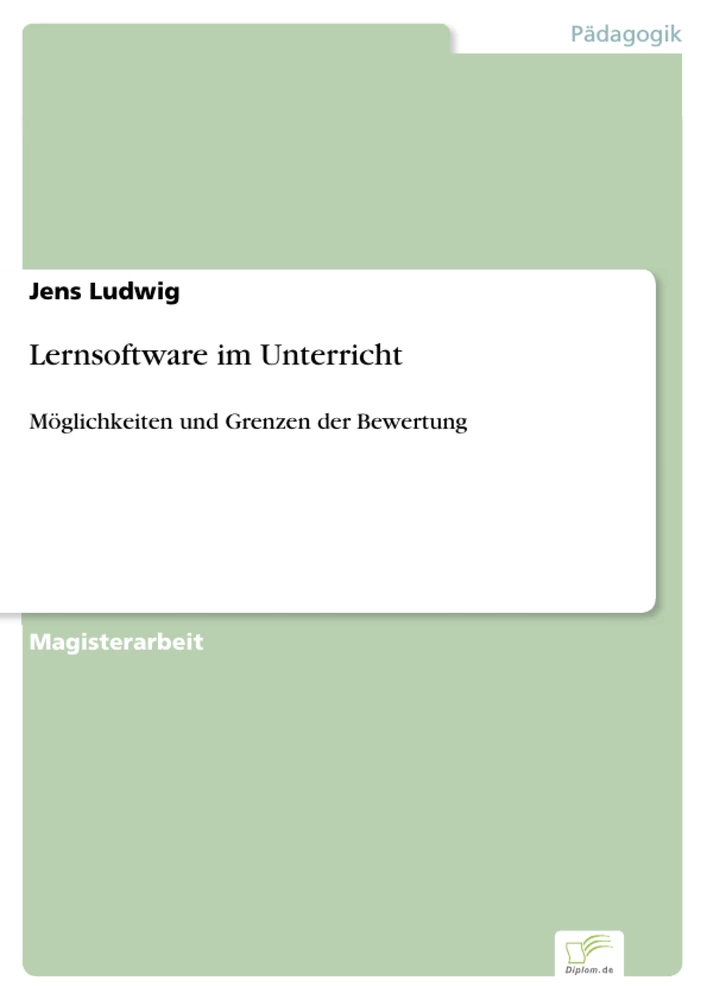Lernsoftware im Unterricht
Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung
Zusammenfassung
Die Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, können zu einer Vielfalt im Lernprozess beitragen, die das Aufnehmen und Verarbeiten von Wissen zusätzlich unterstützen. Es wird weniger das individuelle Lernen erleichtert, als die Gestaltungsmöglichkeiten einer Lernumgebung erweitert. Lernsoftware und andere Computer-Anwendungen ergänzen die Palette der Lernmittel. Lehrende können sie nutzen, um u.a. Sachverhalte anschaulich darzustellen oder motivationale Aspekte des Computers zu nutzen, die nicht nur durch das Neue dieses Mediums zum Tragen kommen.
Die Fragen die sich daraus für den Lehrenden ergeben, sind also bestimmt durch die sinnvolle Ergänzung des Unterrichts durch die vielfältigen Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten. Welche Software ist für welche Phase des Unterrichts am Besten geeignet?; Wie können die neuen Möglichkeiten, die sich mit den neuen Medien ergeben, die Lernphasen effektiv unterstützen?.
Kann ein Lehrer, der seinen Unterrichtsablauf bereits im Kopf hat, nach Lernsoftware suchen, die dann bestimmte Phasen in seiner Planung unterstützen? Das scheint mir mit den Kriterien der üblichen Kataloge schwer möglich, denn diese lassen meist nur Rückschlüsse zu, ob ein Unterricht und eine Lernsoftware im Allgemeinen zusammenpassen. Die Frage, die offen bleibt, ist die nach den konkreten Gebrauchsmöglichkeiten einer Software in bestimmbaren Einheiten des Unterrichts: Welche Software passt in die Experimentierphase des Physikunterrichts der Sekundarstufe II zum Thema Hebelwirkung? Mit welcher Software lassen sich die Vokabeln für den Englisch-Unterricht der 7. Klasse abwechslungsreich überprüfen?
Ziel meiner Magisterarbeit ist die Analyse der didaktischen und methodischen Kategorien in Kriterienkatalogen sowie bei Metadaten und die Erarbeitung einer neuen, systematisierten Kategorie zur Verwendung von Software im Unterricht unter der besonderen Berücksichtigung des Konstruktivismus. Diese Kategorie soll zeigen, welche Software welche Phasen des Unterrichts sinnvoll unterstützen kann und welche nicht. Daraus soll sich der Lehrkraft erschließen, welche Phasen mehr unterstützt werden müssen, um eine optimale Lernumgebung zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Einleitung4
1.Begriffsbestimmung9
1.1Medien, Kodierungen, Modalitäten9
1.2Der Begriff Multimedia10
1.3Der Begriff Hypermedia11
1.4Definition Lernsoftware/Bildungssoftware12
1.5Der Begriff […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Einleitung
1. Begriffsbestimmung: Lernsoftware
1.1 Medien, Kodierungen, Modalitäten
1.2 Der Begriff Multimedia
1.3 Der Begriff Hypermedia
1.4 Definition Lernsoftware/Bildungssoftware
1.5 Der Begriff Interaktivität
1.6 Zusammenfassung
2. Klassifikation von Lernsoftware
2.1 Didaktische Kriterien
2.2 Lerntheoretische Kriterien
2.3 Typologie von Lernsoftware
2.4 Zusammenfassung
3. Evaluation von Lernsoftware
3.1 Der Begriff Evaluation
3.2 Evaluationsarten
3.3 Evaluation von Lernsoftware
3.4 Beispiele für Empirische Methoden
3.5 Kriterienkataloge zur Evaluation
3.5.1 Beispiele für Kriterienkataloge
3.5.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kriterienkatalogen
3.5.3 Vor- und Nachteile der Kriterienkataloge
3.6 Zusammenfassung
4. Beschreibung von Lernsoftware durch Metadaten
4.1 Begriffsbestimmung und Funktion
4.2 Learning Objects Metadata (LOM)
4.2.1 Pädagogische Daten aus den LOM
4.3 Zusammenfassung
5. Neue Kriterien für die Beschreibung von Lernsoftware
5.1 Konstruktivistische Lernumgebungen
5.2 Die neue Kategorie „Unterrichtseinsatz“
5.3 Beispiele für bewertete Software in der Kategorie „Unterrichtseinsatz“
5.3.1 Beispiel: Textverarbeitungs-Programm Word (Microsoft)
5.3.2 Beispiel: Lexikon Encarta 2000 plus (Microsoft)
5.3.3 Beispiel: Lernsoftware Physikus (Heureka Klett)
5.4 Zusammenfassung
6. Fazit und Ausblick
Literatur
Links
Anhang
Einleitung
Die Euphorie der letzten Jahre beim Thema ‚Lernen mit dem Computer’ weicht der zunehmenden Ernüchterung, dass das Lernen nicht in dem Maße vereinfacht wird, wie es immer wieder prognostiziert wurde. Dass Lernsoftware mit seinen neuen Möglichkeiten andere Lernmittel ablöst und den bisherigen Unterricht und somit das Lernen revolutioniert, und alles schneller und einfacher macht, ist übertrieben. ‚Mit Spaß lernen’, ‚Nie wieder Langeweile im Unterricht’ – diese Aussagen werden heute etwas differenzierter betrachtet. Die erhoffte Erleichterung für den Einzelnen, sich Wissen anzueignen, ist wohl oftmals enttäuscht worden. Denn die Vielfältigkeit des Mediums alleine, vereinfacht nicht das Lernen. Es stellt vielmehr weitere Lernmöglichkeiten und -anlässe zur Verfügung. Konstruktivistische Lerntheorien seien hier genannt. Wenn schon nicht das Lernen des Einzelnen erleichtert wird, vielleicht ändern sich die Formen des institutionalisierten Lernens – des Unterrichts durch eine Lehrkraft. Eine Erwartung, die sich durch die zusätzlichen Lernmöglichkeiten und -anlässe ergeben hat, war, dass der Lehrende in Zukunft überflüssig werden könnte. Diese Frage lässt sich heute wohl mit einem klaren Nein beantworten. Trotzdem stecken noch sehr viele Erwartungen in den Neuen Medien. Potenziell positive Auswirkungen sind aber oft unabhängig von Medien zu sehen, denn entscheidender für den Lernerfolg sind andere Bedingungen, wie z. B. Vorwissen, Lernstrategie und Lernmotivation. Es wird also weniger das individuelle Lernen erleichtert, als die Gestaltungsmöglichkeiten einer Lernumgebung erweitert. Diese Möglichkeiten optimal auszuschöpfen, ist keine Software allein fähig. Hierfür ist eine Lehrkraft immer noch unerlässlich. Lernsoftware und andere Computer-Anwendungen ergänzen die Palette der Lernmittel. Lehrende können sie nutzen, um u.a. Sachverhalte anschaulich darzustellen oder motivationale Aspekte des Computers zu nutzen, die nicht nur durch das Neue dieses Mediums zum Tragen kommen.
Die Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, können zu einer Vielfalt im Lernprozess beitragen, die das Aufnehmen und Verarbeiten von Wissen zusätzlich unterstützen. Kerres ist der Meinung, dass „die Diskussion zu eingeschränkt [sei], wenn einzelne Mediensysteme als Alternativen aufgefasst werden, (...). Angesichts der Fülle medialer Informationsangebote in der Lebens- und Lernwelt ist die Medien-‚wahl’ nicht um die Auswahl, sondern um die Kombination von Medien zu zentrieren; es muss um deren Verzahnung und Integration in der Lernumgebung gehen.“[1]
Die Fragen die sich daraus für den Lehrenden ergeben, sind also bestimmt durch die sinnvolle Ergänzung des Unterrichts durch die vielfältigen Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten. „Welche Software ist für welche Phase des Unterrichts am Besten geeignet?“; „Wie können die neuen Möglichkeiten, die sich mit den neuen Medien ergeben, die Lernphasen effektiv unterstützen?“.
Möchte ein Lehrer eine Lernsoftware auswählen aus dem bestehenden, reichhaltigen Angebot, so ist er meist auf Empfehlungen Dritter angewiesen. Diese Empfehlungen können von Bekannten oder Kollegen sein, oder auch durch Institutionen, die Lernsoftware bewerten und auszeichnen. Hat sich der Lehrer dann entschieden, muss er erstens überlegen, ob die Software zu seinem konkreten Unterricht passt, und zweitens – wenn ja – wie diese eingebaut werden kann, sodass das Lernen unterstützt wird.
Die erste Frage lässt sich meistens mit heute üblichen Kriterienkatalogen[2] beantworten. Die Zweite hingegen bleibt dem Lehrer nach der Sichtung der Software überlassen. Denn wie ein Lehrer seinen Unterricht gestaltet und was er als sinnvoll erachtet, bleibt natürlich seine Aufgabe. In diesem Fall wird sich der Lehrer an den Eigenschaften der Software orientieren, um zu entscheiden, an welcher Stelle des Unterrichts er diese einbauen will. Die Unbekannten in dieser Gleichung sind einerseits das Lernmodell bzw. Unterrichtskonzept, das die Lehrkraft im Kopf hat, und andererseits das, auf dem die Lernsoftware beruht. Diese beiden müssen in Einklang gebracht werden. Dabei geht die Lehrkraft immer von der Software aus, um zu entscheiden, ob sie in den eigenen Unterricht passt.
Doch ist auch eine umgekehrte Suche nach Software möglich? Kann ein Lehrer, der seinen Unterrichtsablauf bereits im Kopf hat, nach Lernsoftware suchen, die dann bestimmte Phasen in seiner Planung unterstützen? Das scheint mir mit den Kriterien der üblichen Kataloge schwer möglich, denn diese lassen meist nur Rückschlüsse zu, ob ein Unterricht und eine Lernsoftware im Allgemeinen zusammenpassen: Gibt es ausreichend leistungsstarke Rechner (technische Voraussetzungen)? Entspricht die Software den Voraussetzungen meiner Schüler (anthropogene und soziale Voraussetzungen)? Welchen Inhalt hat die Software und welche Zielgruppe wird angesprochen (didaktische Voraussetzungen)? (Weitere Kategorien von Kriterienkatalogen werden weiter hinten dargestellt.)
Die Frage, die offen bleibt, ist die nach den konkreten Gebrauchsmöglichkeiten einer Software in bestimmbaren Einheiten des Unterrichts: Welche Software passt in die Experimentierphase des Physikunterrichts der Sekundarstufe II zum Thema Hebelwirkung? Mit welcher Software lassen sich die Vokabeln für den Englisch-Unterricht der 7. Klasse abwechslungsreich überprüfen? Es gibt in manchen Kriterienkatalogen bereits Ansätze, die diese Fragen beantworten wollen. Auch in Erfahrungsberichten von Lehrern, die mit Lernsoftware im Unterricht gearbeitet haben, lassen sich unter Umständen die genannten Fragen beantworten. Doch es gibt keine Kategorie in Prüflisten, die Fragen nach den konkreten Einsatzmöglichkeiten im Unterricht beantwortet. Zwar gibt es Kategorien, die didaktische, fach- und mediendidaktische Kriterien berücksichtigen – manche auch methodische –, doch sind diese Kriterien nicht einheitlich systematisiert. Es kommt noch hinzu, dass die verbreiteten Kriterienkataloge gerade die Lerntheorie am wenigsten berücksichtigen, die besonders durch das Lernen mit dem PC in den Vordergrund gerückt ist: den Konstruktivismus.
Ziel meiner Magisterarbeit ist die Analyse der didaktischen und methodischen Kategorien in Kriterienkatalogen und die Erarbeitung einer neuen, systematisierten Kategorie zur Verwendung von Software im Unterricht unter der besonderen Berücksichtigung des Konstruktivismus. Es soll gezeigt werden, welche Software welche Phasen des Unterrichts sinnvoll unterstützen kann und welche nicht. Daraus soll sich der Lehrkraft erschließen, welche Phasen mehr unterstützt werden müssen, um eine optimale Lernumgebung zu schaffen. Hierbei orientiere ich mich an dem Modell für konstruktivistische Lernumgebungen von Jonassen, da hier auch die verschiedenen Strömungen des Konstruktivismus Berücksichtigung finden, wie cognitive apprenticeship, cognitive flexibility theory und anchored instruction.
Meinen Begriff von Lernsoftware möchte ich dabei weit fassen. Ich werde nicht nur didaktisch konzipierte Software berücksichtigen, sondern auch u.a. sogenannte Werkzeuge wie z.B. Textverarbeitungsprogramme oder auch die verschiedenen Dienste des Internets. Im Folgenden werde ich allerdings in erster Linie von Lernsoftware sprechen, da hauptsächlich diese unter lerntheoretischen Aspekten eingeteilt und untersucht werden. Bei Programmen, die nicht didaktisch konzipiert sind, können diese Kategorien schwerlich angelegt werden. Da sie aber jederzeit zum Bestandteil des Unterrichts werden können, können sie in einen unterrichtstheoretischen Rahmen eingeordnet werden, was das Ziel dieser Arbeit ist. Weitere Begriffe, wie Unterrichtssoftware oder -programme, Lernprogramme und auch Bildungssoftware[3] werde ich in meinem Sinne als Synonyme verwenden.
Beginnen werde ich mit einer Begriffsbestimmung von Lernsoftware und den damit zusammenhängenden Begriffen, wie Multimedia, Hypermedia und Interaktivität. Auch wird hier Lernsoftware definiert und näher erläutert.
Bei der Klassifikation von Lernsoftware erläutere ich die üblichen Unterscheidungsmerkmale und stelle die vorherrschende Typologie zu Lernsoftware vor.
Ein entscheidendes Mittel um Lernsoftware für die eigenen Umstände als geeignet zu erkennen, ist die Evaluation von Lernsoftware. Diese kann verschiedene Bereiche einer Lernsoftware untersuchen und unter verschiedenen Bedingungen bewerten. Als Stichworte seien Nutzbarkeit, Lernzielkontrollen und lerntheoretische oder technische Merkmale genannt. Werkzeuge der Evaluation von Lernsoftware werden ebenso vorgestellt, wie konkrete Beispiele von Bewertungsverfahren. Deutlich sei an dieser Stelle noch gemacht, dass sich die überwiegende Zahl der Evaluationsverfahren auf die Lernsoftware beziehen und nicht auf den Einsatz dieser im Unterricht. Anschließend werden verschiedene Kriterienkataloge vorgestellt, verglichen und ihre Kategorien analysiert.
Eine weitere Beschreibungsmöglichkeit für Lernsoftware sind Metadaten. Um zu prüfen, was Metadaten zur Bewertung von Lernsoftware leisten und um deren eventuellen Vorteile zu nutzen, werden sie in einem Kapitel besonders betrachtet.
Im vorletzten Teil meiner Arbeit werde ich dann das Modell von Jonassen vorstellen und die Kriterien einer Kategorie erarbeiten, in der die Bereiche der Software erfragt werden, die zu der Lernumgebung von Jonassen gehören. Fehlende Bereiche sollten von der Lehrkraft bereitgestellt werden. Umgekehrt kann eine Lehrkraft anhand der Kriterien auch nach Programmen suchen, die diese Lücken abdecken.
Bei meiner Analyse wird reine Lernsoftware – also didaktisch komplett durchstrukturierte Programme – eher eine untergeordnete Rolle spielen. Denn ein Entwickler kann die vielfältigen Anforderungen und Voraussetzungen eines Klassenverbandes unmöglich vorhersehen. Je mehr Anforderung er mit einer Lernsoftware zu erfüllen versucht, desto weniger lässt sie sich in einem allgemeinen Rahmen nutzen. Das heißt, je komplexer eine Lernsoftware gestaltet wird, desto schwieriger wird es, diese vollständig in einen methodischen Unterrichtsverlauf zu integrieren. Eine Lehrkraft ist allerdings nicht gezwungen, komplette Programme in den Unterricht zu integrieren. Wie bei anderen Medien auch hat sie die Möglichkeit, aus Teilen des Programms auszuwählen. Aus einer fremdsprachlichen Zeitung wird auch lediglich ein Artikel genommen, aus einem Film nur ein Teil gezeigt und genauso kann lediglich der Übungsteil einer Lernsoftware im Unterricht genutzt werden oder eine Simulation zur Darstellung eines Prozesses.
Am Ende meiner Arbeit folgt ein Fazit und ein Ausblick auf die möglichen, kommenden Entwicklungen.
1. Begriffsbestimmung: Lernsoftware
Lernsoftware ist ein weitgefasster Oberbegriff, den ich im Folgenden genauer bestimmen werde. Ebenso werden die mit Lernsoftware im Zusammenhang stehenden Begriffen Multimedia, Hypermedia und Interaktivität erläutert.
1.1 Medien, Kodierungen, Modalitäten
„Der Begriff Medium meint in der Umgangssprache in der Regel ein Mittel oder einen Mittler bzw. etwas ‚Vermittelndes’.“[4] Somit kann so ziemlich alles ein Medium für etwas anderes sein. Hier ist eine genauere Klärung der Begrifflichkeit angebracht, um auch den Begriff der Multimedialität sauberer bestimmen zu können. Weidenmann ist denn auch der Meinung, dass „der Begriff ‚Multimedia’ … ebenso verbreitet [ist], wie für den wissenschaftlichen Diskurs ungeeignet.“[5]. Er fordert eine „differenziertere Begrifflichkeit“[6]. Tulodziecki und Steinmetz unterscheiden daher zwei weitere Kategorien – neben der des Mediums:
- die Darstellungsweisen der Medien (Kodierungen)
- und durch sie angesprochene Sinne (Modalitäten).
Das Medium beschreibt nur den Träger für kommunikative Inhalte; gemeint sind z.B. technische Geräte wie ein Tonband. Eine erweiterte Unterscheidung durch die Darstellungsform, die ein Medium bietet, und die durch ein Medium angesprochenen Sinne, erleichtert den Umgang mit dem Begriff Medium, und dient so dem besseren Verständnis. Die folgende Tabelle verdeutlicht die mögliche Unterscheidung in die genannten drei Kategorien[7]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1
1.2 Der Begriff Multimedia
„Vormals getrennt operierende Medientechniken wachsen zusammen: Durch die Digitalisierung kann auf dem Rechner jede der bekannten medialen Informationen verarbeitet werden: Es entstehen Multimedia-Systeme.“[8]
Kerres nennt zwei Charakteristika für Multimedia: Zum Einen das Verbinden verschiedener Medien auf der Basis der Digitaltechnik, z.B. Video, Aufnahme- und Wiedergabegeräte, Kommunikationsmöglichkeiten – eben Multi media. Zum Zweiten hebt Kerres die Interaktivität als ‚Medientechnik’ hervor, die sich aus den technischen Möglichkeiten des Computers und des Zusammenwirkens der verschiedenen Medien in einem Gerät ergeben. „Es entstehen neue Medientechniken: Zu nennen wären hier insbesondere die interaktiven Medien, bei denen das Zusammenwachsen von Medien-, Computer- und Kommunikationstechnik besonders deutlich wird.“[9]
„Die notwendigen und hinreichenden Merkmale eines Multimedia-Systems eindeutig bestimmen zu wollen“, so Kerres weiter, „ist angesichts der Vielfalt vorliegender Definitionen, aber auch der rasanten technischen Weiterentwicklung problematisch.“[10]
Die Interaktivität bei multimedialen Programmen wird auch von anderen betont: „Multimedia ist eine Technologie, welche dem Nutzer die computerunterstützte Interaktion mit einem multiplen Mediensystem ermöglicht.“[11], „Der Anwender ist aktiv beteiligt und kann den Ablauf nach seinen Wünschen gestalten.“[12]
Steinmetz wählt für die Definition des Begriffes Multimedia eine technische Sicht: Multimedia-Systeme sind bei ihm eine Kombination aus zeitabhängigen (kontinuierlichen) und zeitunabhängigen (diskreten) Informationen. Also ist z.B. eine computergesteuerte Dia-Show mit mehreren Projektoren (zeitunabhängig) und einer Tonbandeinspielung (zeitabhängig) ein Multimedia-System, wohingegen ein Film, bei dem Audio- und Bewegtbild-Informationen an eine Zeitachse gebunden sind, kein Multimedia-System. „Eine Multimedia-Anwendung muss demnach mindestens ein diskretes und ein kontinuierliches Medium verarbeiten können.“[13]
Rudolf Kammerl schlägt vor, „die einzelnen Dienste des Internet (...) auch als einzelne Medien zu betrachten.“[14] Da die Internetdienste verschiedene Schwerpunkte haben – im World Wide Web (WWW) sind es Bilder, Animationen und Texte; im Chat synchrone Kommunikation; bei E-Mails asynchrone Kommunikation; mit FTP der Datenaustausch – scheint diese Sichtweise sinnvoll.
1.3 Der Begriff Hypermedia
Um den Begriff Hypermedia zu erklären, beginne ich bei Hypertext. Im Gegensatz zu Hypertexten stehen lineare Texte. Ein Text zwingt einen komplexen Gedanken in eine lineare Reihenfolge. Und nur in dieser Reihenfolge kann der Gedanke wieder aufgenommen werden. Eine Bildbeschreibung verdeutlicht dies: Sie muss an einem Punkt des Bildes beginnen und dann, einem Schema folgend, die Teile des Bildes nacheinander schildern. Das lässt sich vergleichen mit dem Betrachten des Bildes im Dunkeln mit einer kleinen Taschenlampe. Das Bild als Ganzes wahrzunehmen, ist nur bei der direkten Betrachtung möglich.
„Ein Hypertext-System ist im wesentlichen durch die nichtlineare Verkettung der Informationen gekennzeichnet.“[15] Das heißt, dass innerhalb eines Textes, bestimmte Stellen auf andere Texte verweisen. Ein einfaches Beispiel sind Fußnoten in Büchern. Sie können erklärende Information zu einer Textstelle beinhalten oder Verweise auf andere Bücher. Der Unterschied beim PC ist die schnellere Zugriffsmöglichkeit auf die weiterführenden Informationen. Der Weg zur Bibliothek entfällt.
Der Begriff Hypermedia bedeutet nun, dass die weiterführenden Informationen nicht nur textlicher Art sind, sondern mit verschiedenen Medien dargestellt werden. Diese Medien können Tonaufzeichnungen oder Filme sein. Steinmetz verdeutlicht die Beziehung zwischen Multimedia, Hypertext und Hypermedia in der folgenden Abbildung[16]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2
1.4 Definition Lernsoftware/Bildungssoftware
Was ist nun Lernsoftware? Folgende Charakteristika werden von Baumgartner herausgestellt:[17]
- Es wurde ein bestimmtes didaktisches Konzept realisiert
- Es hat einen bestimmten Lerninhalt zum Gegenstand (z.B. eine Sprache)
- Es ist auf eine mehr oder weniger klar definierte Zielgruppe ausgerichtet
- Die didaktische Konstruktion wird von den Programm-Autoren bestimmt
Baumgartner versteht „unter Lernsoftware jene Programme, die speziell für Lernzwecke entwickelt und programmiert wurden.“[18]
Ein weitergefassterer Begriff dient der Unterscheidung von anderen Programmen: Bildungssoftware. Der Begriff beinhaltet auch Lernsoftware, spannt den Bogen aber weiter bis zu Software, die zum Lernen genutzt wird. „Bildungssoftware … ist kein bestimmter Typus von Software, sondern stellt eine Benutzungsart der Programme dar.“[19] Das bedeutet Bildungssoftware ist eher als Teil einer komplexen Lernumgebung zu sehen, z.B. als Bestandteil des Unterrichtaufbaus. Ein originärer Zeitungstext auf einer CD-Rom unterstützt im Rahmen des Fremdsprachen-Unterrichts das Lernen. Der Text an sich lehrt aber nicht; erst in der Lernumgebung erlangt der Text eine lernunterstützende Rolle.
In diesem Sinne können auch allgemeine elektronische Werkzeuge wie Textverarbeitungs-Programme oder auch das Internet mit seinen verschiedenen Diensten Bildungssoftware sein.
Inwiefern sich Bildungssoftware in den Unterricht lernunterstützend einbinden lässt, soll neben dem Lernsoftware-Einsatz im Weiteren dargestellt und durch die Beschreibung mit Kriterien deutlich gemacht werden.
1.5 Der Begriff Interaktivität
Interaktivität wird zunehmend als grundlegende Eigenschaft von multimedialen Lernprogrammen gesehen.
Der Begriff Interaktivität stammt ursprünglich aus der Sozialpsychologie und meint ein wechselseitiges, aufeinander bezogenes Verhalten von zwei oder mehr Personen. In Bezug auf Multimedia wird dieses Verständnis auf Computersysteme ausgedehnt. Interaktivität beschreibt die Eingriffsmöglichkeiten in den Programmablauf seitens des Nutzers. Somit ist der Nutzer nicht nur Rezipient, sondern er kann gestaltend in den Kommunikationsprozess eingreifen, verändern und seinen Bedürfnissen anpassen.
Interaktivität lässt sich durch folgende Merkmale realisieren, die hier nach zunehmender Interaktivität aufgeführt werden[20]:
- „Zugreifen auf bestimmte Informationen, Auswählen, Umblättern;
- Ja/Nein- und Multiple-Choice Antwortmöglichkeiten und Verzweigen auf entsprechende Zusatzinformationen;
- Markieren bestimmter Informationsteile und Aktivierung entsprechender Zusatzinformationen;
- Freier Eintrag komplexer Antworten auf komplexe Fragestellungen mit intelligentem tutoriellen Feedback (Sokratischer Dialog);
- Freier ungebundener Dialog mit einem Tutor oder mit Lernpartnern mit Hilfe von Multimedia- und Hypermediasystemen.“
Durch die Möglichkeiten der aktiven Kommunikation und des dadurch hervorgerufenen individuellen Wegs, ein Programm zu bearbeiten, wird ein frei gestaltetes, individuelles Lernen möglich. So ergibt sich die Möglichkeit, dass Motivation und Lernerfolg gesteigert werden können durch selbstgesteuertes und problemorientiertes Lernen. Dies sind Bestandteile des konstruktivistischen Lernparadigmas. Die Möglichkeiten der Neuen Medien scheinen die Bedingungen dieser Lerntheorie besonders gut erfüllen zu können. Später wird gezeigt, dass das Lernen mit dem Computer nicht nur die Interaktivität fördern kann, sondern ebenso weitere Bedingungen einer konstruktivistischen Lernumgebung (nach dem Modell von Jonassen) erfüllt.
1.6 Zusammenfassung
Die Begriffe Multimedia, Interaktivität und Lern- und Bildungssoftware werden im allgemeinen Sprachgebrauch nicht einheitlich benutzt. Eine exaktere Unterscheidung ist aber nötig, um die neuen Möglichkeiten der elektronischen Medien zu verstehen und in den schulischen Alltag zu integrieren. Ist eine genauere Bestimmung geglückt, so können die vielfältigen Angebote unterschieden, deren Potenziale erkannt und im Unterricht in ein Lernkonzept unterstützend eingebunden werden. Gerade die Möglichkeiten der interaktiven, hypermedialen Nutzung von Computer-Programmen ermöglichen es, konstruktivistische Lernmodelle zu unterstützen. Dem Lerner wird es ermöglicht, interaktiv das Programm seinen individuellen Lerngewohnheiten anzupassen. Die Lerngeschwindigkeit des Lerners bestimmt das Tempo, der Lerner bestimmt seinen Lernweg – kann also seine eigene Schwerpunkte setzen und somit selbst entscheiden, wie lange er welchen Bereich bearbeitet. Durch die hypermediale Verbindung der Lerninhalte hat der Lerner die Möglichkeit sein eigenes mentales Modell in der Struktur der Lerninhalte wiederzufinden und mit dessen Hilfe zu erweitern. Da der Lerninhalt auch multimedial angeboten wird, bedient ein solches Lernprogramm auch verschiedene Lernertypen, die sich mal durch audio-visuelle Darstellungen angesprochen fühlen oder andere Darstellungsformen.
2. Klassifikation von Lernsoftware
Es gibt unterschiedliche Ansätze, Lernsoftware in Klassen zu unterteilen. Im Folgenden werden die gebräuchlichsten Ansätze zur Klassifizierung von Lernsoftware dargestellt:
2.1 Didaktische Kriterien
Die didaktischen Kriterien helfen bei der Einschätzung, ob eine Lernsoftware allgemeinen didaktischen Kriterien entspricht und ob die Software für den jeweiligen Unterricht geeignet ist.
Didaktische Kriterien sind:
- Lernziele
- Lerninhalte (Unterrichtsfächer, Themen der beruflichen Weiterbildung, etc.)
- Interaktionsformen (siehe Punkt 2.3)
- Lerntheoretische Modelle (siehe Punkt 2.2)
- Anforderungsniveau an die Lernenden (Anfänger, Fortgeschrittenen, etc)
- Soziale Lernsituation (Schule, Weiterbildung, zu Hause, etc.)
- Technische Rahmenbedingungen (Leistungsniveau des PC, Übertragungsrate der Internetverbindung, etc.)
Diese Kriterien beschreiben die Eigenschaften einer Software. Sie helfen dem Lehrer bei der Einschätzung, ob eine Software für den eigenen Unterricht geeignet ist, bzw. welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um diese Software einzusetzen. In einem späteren Kapitel werde ich untersuchen, inwiefern diese Kategorien, den Lehrenden auch bei der Planung seines Unterrichts unterstützen; also abschätzen zu können, welche konkreten Lernphasen mit der Software unterstützt werden und welche durch den Lehrer abgedeckt werden müssen. Sehr eng an didaktischen Kriterien orientiert sich der Kriterienkatalog von Diepold[21].
2.2 Lerntheoretische Kriterien
Lernsoftware beruht immer auf einem theoretischem Lernmodell, ganz gleich, ob der Autor das beabsichtigt hat oder nicht. In der Struktur des Programms und der Gestaltung der Bedieneroberfläche wird festgelegt, wie der Lerner mit dem Programm umgeht.
Auch hier lässt sich keine absolute Übereinstimmung mit nur einem Kriterium finden. Teile eines Lernprogramms können eher konstruktivistisch gestaltet sein, wie z.B. eine Einführung, in der der Lerner durch selbstständiges Entdecken der Inhalte und Aufgaben entscheidet, welchen Lernweg er geht; wohingegen ein tutorbegleiteter Mittelteil eher auf dem kognitivistischen Ansatz beruht und die abschließenden Übungen auf dem Reiz-Reaktionsschema des Behaviorismus.
Im Folgenden werden die drei wichtigsten wissenschaftstheoretischen Ansätze dargestellt und mit kurzen Beispielen erläutert:
Behaviorismus
Der Behaviorismus beschränkt sich auf die Untersuchung von beobachtbaren und messbaren Verhalten und versteht den Lernprozess als assoziative Verknüpfung von Reiz und Reaktion. Problemsituationen werden durch Versuch und Irrtum gelöst. Nach Auffassung der Behavioristen lässt sich alles Verhalten in Reiz-Reaktions-Einheiten zerlegen. Das klassische Beispiel sind die Pawlowschen Hunde, bei denen der Reiz durch das Futter die Reaktion des Speichelflusses auslöst. Pawlow hat diesen Reiz ersetzt durch ein Tonzeichen, dass er vor der Fütterung ertönen ließ. Nach einer Weile reagierten die Hunde auf den akustischen Reiz mit der Reaktion des Speichelflusses, ohne das Futter überhaupt gesehen zu haben. Die Schulen und Auswirkungen des Behaviorismus sind vielfältig und weitreichend. Bekannte Vertreter sind Thorndike, Watson und Skinner.[22]
Für eine behavioristische Lernstrategie bedeutet das, dass dem Lernenden bestimmte Informationen und Aufgaben in medialer Form als Reize präsentiert werden müssen, um ein gewünschtes Verhalten auszulösen. Im Lernsoftwarebereich findet sich diese Auffassung in den sogenannten „Drill and Practise“-Modellen. Dem Lerner werden hier Reize präsentiert, wie bspw. im Sprachunterricht die Frage nach dem Befinden. Die Reaktion des Lerners wird ihm nun durch ständiges Wiederholen (practise) der Antwortmöglichkeiten „eingebohrt“ (drill) und durch positive Verstärkungen gefestigt. Die Lernwege sind in der Regel in viele kleine Lernschritte gegliedert. Dass diese Lernmethode sich eher für die Änderung spontaner Verhaltensmuster oder als Einübungsmethode motorischer Fähigkeiten eignet, lässt sich an der Nichtbeachtung der menschlichen Denkprozesse erkennen. Das menschliche Lernen ist in den meisten Fällen komplexer und erfordert komplexere Herangehensweisen.
In der Praxis sehen solche Programme meist so aus, dass das erfolgreiche Lösen von Aufgaben eine Belohnung nach sich zieht. Diese Belohnung kann ein kurzes Spiel sein, ein Zertifikat, das nur ab einer bestimmten Punktzahl vergeben wird oder der erste Platz in einer Besten-Liste. Oftmals beschränkt sich die Belohnung auf einen Fanfarenstoß oder eine kleine Animation, oder eine begonnene Geschichte wird erst nach dem erfolgreichen Lösen einer Aufgabe weitergeführt.
Diese Art von Lernprogrammen kann effektiv sein, wenn ein Lernstoff durch stetiges Wiederholen angeeignet werden kann: ein Schreibmaschinen-Lernprogramm beispielsweise, oder auch ein Vokabel- oder Mathematikaufgaben-Trainer. Durch die multimediale Umgebung kann solch ein Programm motivierender sein als ein Lehrbuch.
Bei einem Drill and Practise-Programm erhält der Lerner unmittelbar eine Reaktion auf seine Eingaben. Allerdings unterscheidet das Programm nur zwischen richtigem oder falschem Verhalten; ‚richtig Gemeintes’ wird nicht berücksichtigt. Auch die individuellen und sozialen Voraussetzungen finden keine Beachtung.
Außerdem ist natürlich zu bedenken, dass Vokabellernen nicht das Einzige ist, was man zum Fremdsprachen beherrschen braucht. Andere Kompetenzen lassen sich nicht mit einem Drill and Practise-Programm erlernen.
Kognitivismus
Der Kognitivismus ist auf die Theorien von Piaget und Brunner zurückzuführen. Der Kognitivismus beschäftigt sich im Gegensatz zum Behaviorismus mit den inneren Prozessen des Gehirns, nämlich mit dem Prozess der Informationsverarbeitung. Es geht also nicht nur um die Beherrschung von Regeln, sondern auch die Fähigkeit Problemstellungen zu analysieren, Hypothesen zu formulieren und zu prüfen. Der Lernende löst Probleme, indem er entweder vorhandenes Wissen neu kombiniert oder eine neue Regel aufstellt. Hierzu müssen Ausgangssituation und Ziel genau festlegt werden[23].
Der Kognitivismus geht davon aus, dass das Gehirn die Umwelt aktiv interpretiert; also auch Lernen ein aktiver Prozess ist. Ein bestimmter Reiz soll also nicht mehr ein gewünschtes Verhalten produzieren – wie beim Behaviorismus, sondern hier kommt es auf geeignete Problemlösungsverfahren an. Neues Verhalten wird durch eine intensive Auseinandersetzung mit den entsprechenden Situationen erlernt. In einer Rahmenbedingung mit bestimmten Faktoren werden Probleme vorgegeben, die dann durch den Lerner gelöst werden müssen. Hierbei steht nicht die richtige Lösung im Vordergrund, sondern das Finden eines geeigneten Lösungsverfahren. Das Programm wird also vom entscheidenden ‚Lehrer’ zum beobachtenden und helfenden Tutor. Sequenzen von Instruktion und Alternativ-Entscheidungen dienen als Methode eines kognitiv motivierten Programms.
Programme, die dem Kognitivismus folgen, bieten einen geführten Einstieg in ein Thema und zeigen Zusammenhänge und Vorgehensweisen auf. Dabei ist es oft eine Figur, ein Tutor, die den Lerner durch den Stoff führt und eine Vorbildrolle übernimmt. Der Stoff wird meist in authentischen Situationen vermittelt. Oftmals finden tutorielle Systeme ihre Anwendung als Einführung in die Bedienung komplexer Programme. Dem Lerner werden in der Originalumgebung des Programms einzelne Funktionen gezeigt und erklärt. Darauf folgen Problemstellungen, die der Lerner nun eigenständig lösen soll, indem er das Erklärte verknüpft und anwendet.
Die Nachteile eines kognitiv motivierten Lernprogramms sind zum einen der strenge Aufbau und Verlauf eines solchen Programms, welche dem Lerner keine Möglichkeit geben, assoziativ an das Thema heranzugehen; und zum Zweiten bleiben auch hier soziale Aspekte des Lernens unberücksichtigt.
Konstruktivismus
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass es keine Realität gibt, die vom Beobachter unabhängig sein kann. Das heißt, Realität wird von jedem einzelnen durch ständige Interpretation aktiv konstruiert. Der entscheidende Unterschied zum Kognitivismus liegt darin, dass der Konstruktivismus das Gehirn als ein geschlossenes System sieht, das sich selbst organisiert. In erster Linie ist es also mit sich selbst beschäftigt und nur zu einem geringen Teil mit der Verarbeitung von Informationen und Reizen aus der Umwelt. So nehmen bspw. menschliche Ohren keine Musik, sondern Schallwellen wahr. Diese Schallwellen werden erst vom Gehirn zu Musik ‚konstruiert’[24].
Das heißt, dass Lernen kein passives Aufnehmen und Abspeichern von Informationen und Wahrnehmungen ist, sondern ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion. Der Lernende stützt sich also auf bereits vorhandene Erfahrungen, wendet dieses Wissen an und generiert so neues Wissen. Somit steht nicht mehr ein autoritäres Lehrerbild – wie beim Behaviorismus –oder der beobachtende und helfende Tutor – wie beim Kognitivismus – im Vordergrund, sondern die individuelle Erfahrung des Lernenden. Am Rande seien hier drei Ansätze genannt, die die Gestaltung computerunterstützter Lernwelten betreffen[25]:
- ‚cognitive apprenticeship’: Hier ist das Lernen als Meister-Lehrlingsbeziehung konzipiert. Der Meister leitet den Schüler an und nimmt sich mehr und mehr zurück.
- ‚cognitive flexibility theory’: Ein komplexer Inhalt wird anhand eines authentischen Falls dargestellt, um verschiedene Herangehensweisen zu ermöglichen, und das Wissen so in anderen Situationen anwendbar zu machen.
- ‚anchored instructions’: Aufgaben werden in einem großen Kontext gestellt, z.B. in Form einer interessanten, komplexen und realistischen Geschichte. Auf diese Weise werden ‚Anker’ geschaffen; also Anknüpfpunkte zwischen bereits vorhanden Wissen und dem neuen Wissen
Ein Programm auf konstruktivistischer Grundlage bietet also weniger Führung und Anleitung, dafür aber Anlässe und Anregungen in einer komplexen Umgebung authentische Erfahrungen zu sammeln. Somit hat der Lerner viel Freiheit, aber auch sehr viel Eigenverantwortung für den eigenen Lernerfolg. Ein Beispiel für konstruktivistische Lernprogramme sind Simulationen von wirtschaftlichen Zusammenhängen in Betrieben oder natürlichen Zusammenhängen in Ökosystemen. Die Variablen können selbsttätig verändert werden und die Mechanismen erschließen sich dem Anwender aus der beobachtbaren Reaktion des Systems. Je komplexer ein solches System ist, desto undurchsichtiger sind die Reaktionen und damit die Mechanismen zu erkennen.
Das Lernen in einer konstruktivistischen Lernumgebung lässt daher manchen Anwender sich orientierungslos und überfordert fühlen. Der zusätzliche eigene Anteil an der Ergründung eines solchen Programms, das zudem noch sehr komplex ist, kann ohne Hilfestellung zu Verwirrung auf Seiten des Lerners führen, was einen Lernerfolg fraglich werden lässt.
2.3 Typologie von Lernsoftware
Die weitverbreitetste Unterscheidung von Lernsoftware ist die Einteilung in Typen. Auch hier ist kaum eine Lernsoftware nur einem Typ zugeordnet. Mehrere Typen können von einer Lernsoftware abgedeckt werden. Bei dieser Art der Typologie bietet sich an dieser Stelle an, auch auf Bildungssoftware Bezug zu nehmen. Dies war bei den vorangegangenen Einteilungen nicht möglich, da diese auf lerntheoretischen und didaktischen Kriterien beruhen; Bildungssoftware aber per Definition nicht didaktisch konstruiert sein muss.
Die folgende Unterteilung, erscheint in unterschiedlichen Akzentuierungen und Differenzierungen bei verschiedenen Autoren (Thomé 1989, Baumgartner/Payr 1994, Bodendorf 1993, Leufen 1996a, LSW 1994a).
Tutorials
„Tutorials stellen einen Lerngegenstand auf ein oder mehrere Arten dar und dienen der Einführung in ein Wissensgebiet“[26] oder in die Bedienfunktionen eines Programms. „Die Lernabschnitte sind in der Regel linear aufgebaut, die Lernenden werden dadurch relativ straff geführt.“[27]
Übungsprogramme (Drill and Practise)
Übungsprogramme prüfen vorhandenes Wissen durch Fragen. Auf die Antworten gibt es eine Rückmeldung. Am Ende des Programms erfolgt eine Gesamtauswertung. „Die beiden klassischen Anwendungsfälle (...) sind: (...) Einstufungstest (...) und (...) Abschlusstest.“[28]
Intelligente tutorielle Systeme (ITS)
Im Gegensatz zu Tutorials passt sich das ITS den Anforderungen des Lerners an. Lehrabschnitte und Dialoge werden flexibel erzeugt und je nach Eingaben des Anwenders zusammengestellt. Aufgrund der Komplexität solcher Programme, sind sie noch wenig verbreitet.
Simulationsprogramme
Simulationsprogramme stellen reale Prozesse oder Objekte in Modellform dar. Der Lernende hat die Möglichkeit in diesem Modell unterschiedliche Parameter zu verändern und die Reaktionen des Systems zu beobachten. Beispiele sind Flugsimulatoren oder die Veränderungen eines Ökosystems. Auch Planspiele fallen in diese Kategorie. Planspiele sind sehr komplexe Simulationsprogramme, die so angelegt sind, dass mit ihnen in Gruppen gearbeitet wird. Die Gruppe analysiert und plant ihr Vorgehen und überprüft die Auswirkungen dieser Schritte in dem Planspiel.
Spielerische Lernprogramme
In der Literatur erscheint auch diese Kategorie (Leufen 1996a, Bodendorf 1993, Hoelscher 1994), sie ist aber nicht klar eingegrenzt. Bodendorf betont „Herausforderung, Neugier und Phantasie“[29] als Motivationsanlässe und schließt, „Spielsysteme basieren deshalb sehr häufig auf Simulationsmodellen“.[30] Ganz kurz macht es Leufen: „Spielerische Lernprogramme enthalten neben den Lernelementen auch Spielsituationen.“[31]
Am Treffendsten erscheint mir eine allgemeinere Formulierung von Bodendorf: „Spielsysteme (...) benutzen das Spiel (...) als Verpackung eines didaktischen Konzepts. (...) Hierin liegt auch der wesentliche Unterschied (...) zu sogenannten Computerspiele[n], die reinen Unterhaltungswert besitzen.“[32]
An dieser Stelle ergänze ich Kategorien für Bildungssoftware, die keine Lernsoftware sind. Also Software, die nicht didaktisch aufbereitet wurde, aber als didaktisches Mittel in einer Lernumgebung dienen kann.
(Multimedia) Informationssysteme
Leufen (1996b) trifft hier noch eine Unterscheidung zwischen Datenbeständen/Datenbanken und Hypermedia-Arbeitsumgebungen. Datenbestände/Datenbanken enthalten Informationen zu bestimmten Themen. Um Datenbestände effektiv nutzen zu können, wird eine Suchfunktion und Werkzeuge für den Zugriff und die Weiterverarbeitung benötigt. Enthält die Datenbank Informationen auf verschiedenen Medien, so spricht man von multimedialen Informationssystemen. Ein Beispiel sind elektronische Kataloge in Bibliotheken.
„Hypermedia Arbeitsumgebungen präsentieren einen multimedialen, themenbezogenen Datenbestand. Dieser ist – in Abgrenzung zu Datenbeständen – nach Sach- und Sinnzusammenhängen vernetzt.“[33] Beispiele sind hier Multimedia-Lexika oder auch viele Stadtinformationssysteme.
[...]
[1] Kerres, M. (2000): Computerunterstütztes Lernen als Element hybrider Lernarrangements. In: Kammerl, R. (Hg.): Computerunterstütztes Lernen. München, S. 25f.
[2] s. Link-Liste im Literaturverzeichnis dieser Arbeit
[3] vgl. Baumgartner, P. (1995): Didaktische Anforderungen an (multimediale) Lernsoftware. In: Issing, L.; Klimsa, P. (Hg.): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim, S. 244
[4] Tulodziecki, G. (1997): Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. 3. Aufl., Bad Heilbrunn, S. 33
[5] Weidenmann, B. (1995): Multicodierung und Multimodalität im Lernprozess. In: Issing, L.; Klimsa, P. (Hg.): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim, S. 65
[6] ebda. S. 65
[7] ebda. S. 67
[8] Kerres, M. (1998): Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München, S. 81
[9] ebda. S.81
[10] ebda. S.81
[11] Issing, L.J. (1994): Von der Mediendidaktik zur Multimedia-Didaktik. Unterrichtswissenschaft 22. S.267
[12] Börner, W.; Schnellhardt, G. (1992): Multimedia. Grundlagen, Standards, Beispielanwendungen. München. S. 18
[13] Steinmetz, R. (1993): Multimediatechnologie. Berlin. S. 17
[14] Kammerl, R. (2000): Mediendidaktische und medienerzieherische Perspektiven des Lernens mit dem Internet. In: Kammerl, R. (Hg.): Computerunterstütztes Lernen. München. S. 133
[15] Steinmetz, R. (1993): Multimediatechnologie. Berlin. S. 357
[16] ebda. S. 356 Abb. 11-6
[17] vgl. Baumgartner, P. (1995): Didaktische Anforderungen an (multimediale) Lernsoftware. In: Issing, L.; Klimsa, P. (Hg.): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim, S. 241-252
[18] ebda. S. 244
[19] ebda. S. 245
[20] Haack, Johannes (1995): Interaktivität als Kennzeichen von Multimedia und Hypermedia. In: Issing, L. J.; Klimsa, P. (Hg.): Information und Lernen mit Multimedia, S. 151-166. Weinheim. S. 153.
[21] vgl. www.educat.hu-berlin.de/mv/criteria.html
[22] vgl. Thissen, F. (1999): Lerntheorien und ihre Umsetzung in multimedialen Lernprogrammen – Analyse und Bewertung. In: BIBB Multimedia Guide Berufsbildung. Berlin.
[23] vgl. Kammerl, R. (2000): Computerunterstütztes Lernen – Eine Einführung. In: Kammerl, R. (Hg.): Computerunterstütztes Lernen. Oldenbourg. S. 13.
[24] vgl. Thissen, F. (1999): Lerntheorien und ihre Umsetzung in multimedialen Lernprogrammen – Analyse und Bewertung. In: BIBB Multimedia Guide Berufsbildung. Berlin.
[25] vgl. Law, L.-C. (1995): Constructivist Instructional Theories and Acquisition of Expertise Research Report. No. 48, March. München.
[26] Leufen, S (1996b): Software-Angebot für Unterricht und Schule. In: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hg.): Neue Medien in den Schulen. Projekte – Konzepte – Kompetenzen. S. 25.
[27] Rudolf, C. (1999): Traditionelle Unterrichtsformen, computerunterstütztes Lernen und Lernen mit dem Internet im Vergleich. In: INBAS: Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken: Lernsoftware und Lernen mit dem Internet. Frankfurt/M. S. 16.
[28] Bodendorf, F. (1993): Computer in der betrieblichen Weiterbildung. München. S. 73.
[29] ebda. S. 77
[30] ebda. S. 77
[31] Leufen, S (1996b): Software-Angebot für Unterricht und Schule. In: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hg.): Neue Medien in den Schulen. Projekte – Konzepte – Kompetenzen. S. 27
[32] Bodendorf, F. (1993): Computer in der betrieblichen Weiterbildung. München. S. 77.
[33] Leufen, S (1996b): Software-Angebot für Unterricht und Schule. In: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hg.): Neue Medien in den Schulen. Projekte – Konzepte – Kompetenzen. S. 27
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832460105
- ISBN (Paperback)
- 9783838660103
- DOI
- 10.3239/9783832460105
- Dateigröße
- 696 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin – Philosophische Fakultät IV
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Oktober)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- schule computer lernen kriterienkataloge metadaten
- Produktsicherheit
- Diplom.de