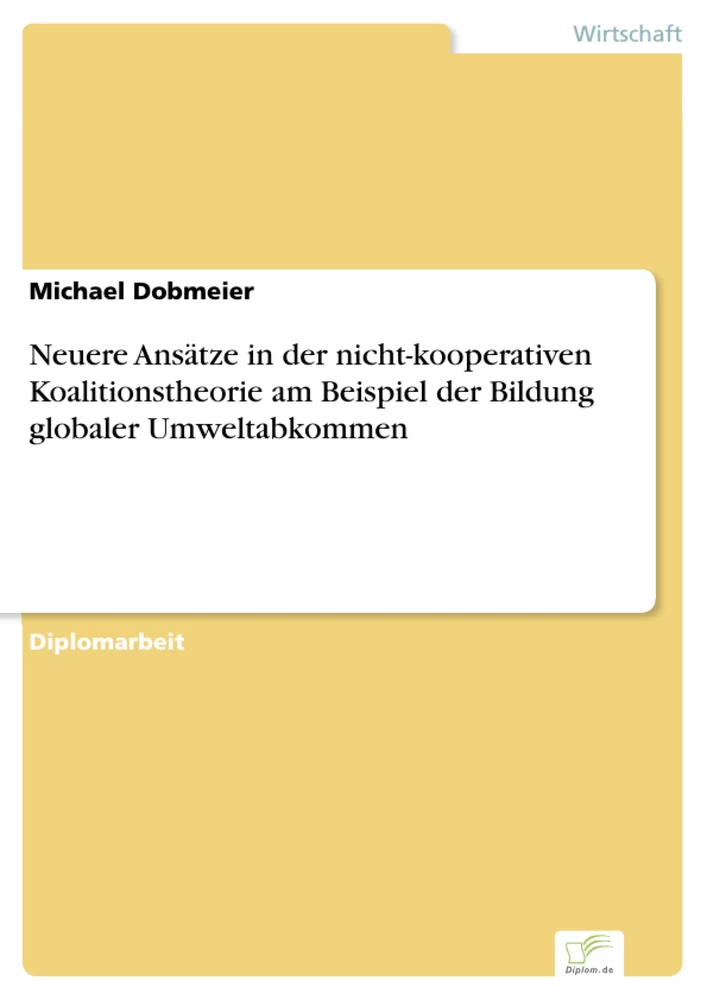Neuere Ansätze in der nicht-kooperativen Koalitionstheorie am Beispiel der Bildung globaler Umweltabkommen
©2002
Diplomarbeit
66 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Umwelt ist ein öffentliches Gut. Umweltressourcen wie Luft und Wasser stehen jedem zur Verfügung und niemand kann von ihrem Ge- bzw. Verbrauch ausgeschlossen werden. Neben der nonexcludability gilt bei deren Nutzung auch das Prinzip der Nichtrivalität. Weil es einen freien Zugang zu diesen Ressourcen gibt, geht jeder auf unterschiedliche Art und Weise mit ihnen um. Die Folgen des jeweiligen Verhaltens treffen dabei nicht immer ausschließlich den Verursacher. So haben Entscheidungen bzgl. dem Einsatz von Ressourcen oder einem bestimmten Handeln oder Unterlassen seitens souveräner Staaten Auswirkungen auf Nachbarstaaten oder gar weltweite Folgewirkungen und erzeugen somit externe Effekte: Was auf nationaler Ebene als die beste Handlungsempfehlung für ein Land angesehen wird, entpuppt sich auf internationaler Ebene durch entstehende Wechselwirkungen nur noch als suboptimale Lösung.
Die Zusammenarbeit zwischen Staaten soll dazu beitragen, Externalitäten zu internalisieren. International Environmental Agreements (IEAs) stellen ein Instrument dar, solch eine Internalisierung herbeizuführen: The IEA allows domestic decision makers to coordinate their resource management decisions across national boundaries. Dieser Koordinationsfunktion von Umweltabkommen stehen entscheidende Hürden entgegen: Warum sollten souveräne Staaten Rücksicht auf andere Länder nehmen? Warum sollten sie sich mit anderen Ländern zusammenschließen und ihre Handlungen mit anderen Ländern im Rahmen eines IEA koordinieren, wenn doch die eigenständige Problemlösung innerhalb des eigenen Landes zu einem befriedigenden Ergebnis führt? Schließlich wirkt ein IEA durch die darin eingegangenen Verpflichtungen unmittelbar auf den Handlungsspielraum eines Staates zurück: Die im IEA vereinbarten Ziele müssen innerhalb jedes teilnehmenden Landes durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.
Um internationale Problemstellungen lösen zu können, müssen souveräne Staaten demnach freiwillig miteinander kooperieren, die gemeinsamen Maßnahmen im Konsens verabschieden und selbst für deren Umsetzung sorgen. Die Formen solch einer Zusammenarbeit können vielfältig sein, jedoch bilden bi- oder multilaterale Abkommen zwischen den Ländern meistens die formale Grundlage einer Kooperation. Die zentrale Frage dabei ist: Welche Koalitionen werden eingegangen? Die Koalitionstheorie versucht, mit Hilfe der Spieltheorie die sich in Abhängigkeit von den jeweils zugrunde gelegten […]
Die Umwelt ist ein öffentliches Gut. Umweltressourcen wie Luft und Wasser stehen jedem zur Verfügung und niemand kann von ihrem Ge- bzw. Verbrauch ausgeschlossen werden. Neben der nonexcludability gilt bei deren Nutzung auch das Prinzip der Nichtrivalität. Weil es einen freien Zugang zu diesen Ressourcen gibt, geht jeder auf unterschiedliche Art und Weise mit ihnen um. Die Folgen des jeweiligen Verhaltens treffen dabei nicht immer ausschließlich den Verursacher. So haben Entscheidungen bzgl. dem Einsatz von Ressourcen oder einem bestimmten Handeln oder Unterlassen seitens souveräner Staaten Auswirkungen auf Nachbarstaaten oder gar weltweite Folgewirkungen und erzeugen somit externe Effekte: Was auf nationaler Ebene als die beste Handlungsempfehlung für ein Land angesehen wird, entpuppt sich auf internationaler Ebene durch entstehende Wechselwirkungen nur noch als suboptimale Lösung.
Die Zusammenarbeit zwischen Staaten soll dazu beitragen, Externalitäten zu internalisieren. International Environmental Agreements (IEAs) stellen ein Instrument dar, solch eine Internalisierung herbeizuführen: The IEA allows domestic decision makers to coordinate their resource management decisions across national boundaries. Dieser Koordinationsfunktion von Umweltabkommen stehen entscheidende Hürden entgegen: Warum sollten souveräne Staaten Rücksicht auf andere Länder nehmen? Warum sollten sie sich mit anderen Ländern zusammenschließen und ihre Handlungen mit anderen Ländern im Rahmen eines IEA koordinieren, wenn doch die eigenständige Problemlösung innerhalb des eigenen Landes zu einem befriedigenden Ergebnis führt? Schließlich wirkt ein IEA durch die darin eingegangenen Verpflichtungen unmittelbar auf den Handlungsspielraum eines Staates zurück: Die im IEA vereinbarten Ziele müssen innerhalb jedes teilnehmenden Landes durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.
Um internationale Problemstellungen lösen zu können, müssen souveräne Staaten demnach freiwillig miteinander kooperieren, die gemeinsamen Maßnahmen im Konsens verabschieden und selbst für deren Umsetzung sorgen. Die Formen solch einer Zusammenarbeit können vielfältig sein, jedoch bilden bi- oder multilaterale Abkommen zwischen den Ländern meistens die formale Grundlage einer Kooperation. Die zentrale Frage dabei ist: Welche Koalitionen werden eingegangen? Die Koalitionstheorie versucht, mit Hilfe der Spieltheorie die sich in Abhängigkeit von den jeweils zugrunde gelegten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5661
Dobmeier, Michael: Neuere Ansätze in der nicht-kooperativen Koalitionstheorie am Beispiel der
Bildung globaler Umweltabkommen / Michael Dobmeier -
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Hagen, Universität - Gesamthochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis
I
Abkürzungsverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
V
1.
Einleitung
1
2.
Klassifizierung der spieltheoretischen Basis
2
2.1
Kooperative versus nicht-kooperative Spielsituation
3
2.2
Dynamische Spielmodelle contra reduzierte Spielstufenmodelle
4
2.3
Die Bedeutung von externen Effekten
6
2.3.1
Negative Externalitäten
6
2.3.2
Positive Externalitäten
7
2.4
Die Arten des Freifahrerverhaltens
8
3.
Konventionelle Konzepte im Rahmen der reduzierten Spielstufenmodelle 10
3.1
Konzept des Kerns
10
3.2
Konzept der internen & externen Stabilität
11
3.3
Vergleich und Kritik der beiden konventionellen Konzepte
11
4.
Neuere Ansätze in der Koalitionstheorie
13
4.1
Gleichgewichtskonzepte
13
4.1.1
Nash Gleichgewicht (NE)
14
4.1.2
Strenges Nash Gleichgewicht (SNE)
15
4.1.3
Koalitionsgeprüftes Nash Gleichgewicht (CPNE)
15
4.2
Spielregeln als Grundlage von Koalitionsspielen
16
4.2.1
Anzahl der möglichen Abkommen
16
4.2.2
Modalitäten für den Beitritt zu einem Abkommen
17
4.2.3
Mitwirkungsrechte anderer Koalitionäre
17
4.3
Koalitionsspiele
18
4.3.1
Open Membership Single Coalition Game (OM-SCG)
18
4.3.2
Open Membership Multiple Coalition Game (OM-MCG)
19
4.3.3 Exclusive
Membership-
Multiple Coalition Game (EM
-MCG)
20
4.3.4 Exclusive
Membership-
Multiple Coalition Game (EM
-MCG)
21
II
Seite
5.
Darstellung einer einheitlichen Beurteilungsgrundlage zur Ermittlung
gleichgewichtiger Koalitionsstrukturen
22
5.1
Allgemeine Definitionen und Annahmen
23
5.2
Die allgemeine Auszahlungsfunktion
24
5.3
Die Rolle der Emissionen
25
5.4
Die Eigenschaften des Global Emission Games
26
5.5
Generelle Eigenschaften zur Charakterisierung von Koalitionsstrukturen 27
6.
Interpretation der Ergebnisse bei Anwendung des Global Emission Games 28
6.1
Gleichgewichtige Koalitionsstrukturen
28
6.2
Einfluss von Spielregeln auf die Bildung von Koalitionen
32
6.2.1
Einzelnes gegenüber mehreren Abkommen
32
6.2.2
Offene versus exklusive Mitgliedschaft
32
6.2.3
Grad der notwendigen Zustimmungspflicht
33
6.2.4
Konzeptbezogene Schlussfolgerungen
34
7.
Diskurs der vorgestellten Theorien und Modelle
34
7.1
Kritische Würdigung der Annahmen
34
7.2
Evaluierung des Global Emission Games und der neueren Koalitionsansätze 39
8.
Praktische Anwendungen
43
8.1
Politische Abkommen und Verträge
43
8.2
Internationale Umweltabkommen
46
9.
Fazit
49
Literaturverzeichnis
51
Erklärung
55
Anhang 1. Politische Abkommen und Verträge
56
2. Internationale Umweltabkommen
58
III
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
ASEAN
Association of South East Asian Nations
Aufl.
Auflage
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
CITES
Convention in International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora
COMECON
Council for Mutual Economic Assistance
CPNE
Coalition-Proof Nash Equilibrium
d.h.
das
heißt
EFTA
European Free Trade Association
EG
Europäische
Gemeinschaft
EM
-MCG
Exclusive
Membership-
Multiple Coalition Game
EM
-MCG
Exclusive
Membership-
Multiple Coalition Game
etc.
et
cetera
EU
Europäische
Union
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
Hrsg.
Herausgeber
i.d.R.
in der Regel
IEA
International Environment Agreement
Jg.
Jahrgang
Kap.
Kapitel
KSZE
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
MERCOSUR
Mercado Común del Cono Sur
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NAFTA
North American Free Trade Agreement
NE
Nash
Equilibrium
No.
Nummer
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
IV
OM-MCG
Open Membership Multiple Coalition Game
OM-SCG
Open Membership Single Coalition Game
OSZE
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
RGW
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
S. Seite
s.a.
siehe
auch
SNE
Strong Nash Equilibrium
u.a.
unter
anderem
UNEP
United Nations Environment Programme
UNO
United Nations Organization
v.a.
vor
allem
vgl.
vergleiche
Vol.
Volume
WTO
World Trade Organization
z.B.
zum
Beispiel
V
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1:
Konventionelle Koalitionskonzepte im Vergleich
12
Abb. 2:
Koalitionsspiele in reduzierten Spielstufenmodellen
22
Abb. 3:
Gleichgewichtige Koalitionsstrukturen für spezifische
Auszahlungsfunktion
31
Abb. 4:
Koalitionsstrukturen bei Nash-Annahme und ,,rational conjecture" 38
1
1.
Einleitung
Die Umwelt ist ein öffentliches Gut. Umweltressourcen wie Luft und Wasser stehen
jedem zur Verfügung und niemand kann von ihrem Ge- bzw. Verbrauch ausgeschlossen
werden. Neben der ,,nonexcludability" gilt bei deren Nutzung auch das Prinzip der
Nichtrivalität (Cornes/Sandler 1986, Holler/Illing 2000). Weil es einen freien Zugang
zu diesen Ressourcen gibt, geht jeder auf unterschiedliche Art und Weise mit ihnen um.
Die Folgen des jeweiligen Verhaltens treffen dabei nicht immer ausschließlich den
Verursacher. So haben Entscheidungen bzgl. dem Einsatz von Ressourcen oder einem
bestimmten Handeln oder Unterlassen seitens souveräner Staaten Auswirkungen auf
Nachbarstaaten oder gar weltweite Folgewirkungen und erzeugen somit externe Effekte:
Was auf nationaler Ebene als die beste Handlungsempfehlung für ein Land angesehen
wird, entpuppt sich auf internationaler Ebene durch entstehende Wechselwirkungen nur
noch als suboptimale Lösung. Die Zusammenarbeit zwischen Staaten soll dazu
beitragen, Externalitäten zu internalisieren. International Environmental Agreements
(IEAs) stellen ein Instrument dar, solch eine Internalisierung herbeizuführen: ,,The IEA
allows domestic decision makers to coordinate their resource management decisions
across national boundaries". (Swanson/Johnston (1999), S. 85). Dieser Koordinations-
funktion von Umweltabkommen stehen entscheidende Hürden entgegen: Warum sollten
souveräne Staaten Rücksicht auf andere Länder nehmen? Warum sollten sie sich mit
anderen Ländern zusammenschließen und ihre Handlungen mit anderen Ländern im
Rahmen eines IEA koordinieren, wenn doch die eigenständige Problemlösung innerhalb
des eigenen Landes zu einem befriedigenden Ergebnis führt? Schließlich wirkt ein IEA
durch die darin eingegangenen Verpflichtungen unmittelbar auf den Handlungsspiel-
raum eines Staates zurück: Die im IEA vereinbarten Ziele müssen innerhalb jedes
teilnehmenden Landes durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Um
internationale Problemstellungen lösen zu können, müssen souveräne Staaten demnach
freiwillig miteinander kooperieren, die gemeinsamen Maßnahmen im Konsens ver-
abschieden und selbst für deren Umsetzung sorgen (Finus 2001b). Die Formen solch
einer Zusammenarbeit können vielfältig sein, jedoch bilden bi- oder multilaterale
Abkommen zwischen den Ländern meistens die formale Grundlage einer Kooperation.
Die zentrale Frage dabei ist: Welche Koalitionen werden eingegangen? Die
Koalitionstheorie versucht, mit Hilfe der Spieltheorie die sich in Abhängigkeit von den
2
jeweils zugrunde gelegten Spielregeln und Gleichgewichtskonzepten ergebenden
Koalitionsstrukturen zu definieren. Im Folgenden werden zunächst einige spieltheore-
tische Grundlagen dargelegt (Kapitel 2), um danach auf verschiedene konventionelle
Koalitionskonzepte einzugehen (Kapitel 3). Daran schließt sich die Erörterung neuerer
Ansätze in der Koalitionstheorie sowie einiger Koalitionsspiele an (Kapitel 4). Hierauf
gehe ich auf das Global Emission Game als einen Modellrahmen ein, der eine einheit-
liche Grundlage für die Bestimmung gleichgewichtiger Koalitionsstrukturen bietet
(Kapitel 5). In Kapitel 6 werde ich die Ergebnisse der Anwendung des Global Emission
Games auf die verschiedenen neueren Koalitionsansätze interpretieren, wobei der
Auswirkung zuvor definierter ,,Spielregeln" auf die potentiellen Koalitionsstrukturen
eine besondere Bedeutung zukommt: Erstens die Möglichkeit, statt eines einzelnen
Abkommens auch mehrere Abkommen zu etablieren. Zweitens die Rolle der
Zutrittsmöglichkeiten zu einem Abkommen (offene oder exklusive Mitgliedschaft).
Drittens die Mitwirkungsrechte der Koalitionäre hinsichtlich dem Grad der notwendigen
Zustimmungspflicht bei Aufnahme neuer Mitglieder. Dem schließt sich in Kapitel 7
eine kritische Betrachtung der untersuchten Koalitionsmodelle sowie ihrer Annahmen
und Ergebnisse an. In Kapitel 8 werden einige praktische Anwendungen realer
Abkommen vorgestellt und erörtert, um schließlich im neunten und letzten Kapitel ein
Fazit der Anwendbarkeit der Koalitionstheorie für die Praxis zu ziehen.
2.
Klassifizierung der spieltheoretischen Basis
Nachdem es sich bei der Umwelt um eine öffentliche Ressource handelt, die alle Länder
gemeinsam bewirtschaften, und somit zwischen Staaten ein hohes Maß an
Interdependenz vorliegt (Barrett 1990, Carraro 2000, Finus 1997), eignet sich die
Spieltheorie besonders gut, die Anreizstruktur der Akteure im Bereich globaler
Umweltprobleme zu untersuchen (Endres/Finus 2000, Finus 2001b). Nicht zuletzt weil
die Spieltheorie strategische Entscheidungssituationen analysiert (Holler/Illing 2000),
liefert sie den theoretischen Rahmen, in dem die Frage nach der gleichgewichtigen
Anzahl und Größe von Koalitionen beantwortet werden kann. Um die spieltheoretischen
Implikationen zu verstehen, müssen zunächst einige Grundlagen definiert werden. Die
folgenden Kapitel (2.1 bis 2.4) gehen auf einer recht aggregierten Ebene auf
ausgewählte Elemente des umfangreichen Gebiets der Spieltheorie ein. Die Klarstellung
3
einiger Begriffe und die Entscheidung in eine bestimmte spieltheoretische Richtung soll
es dem Leser erleichtern, die weiter unten präsentierten Ergebnisse nachzuvollziehen.
2.1
Kooperative versus nicht-kooperative Spielsituation
Die Spieltheorie unterscheidet zwei Arten von Spielsituationen: Bei einer kooperativen
Spielsituation können sich die einzelnen Spieler absprechen und ihre Strategien
koordinieren. Dies geht soweit, dass zwischen den Spielern bindende Abmachungen
getroffen oder Verträge geschlossen werden. Darüber hinaus existieren exogene
Instanzen, welche die Einhaltung solcher Verträge durchsetzen (Holler/Illing 2000).
Die kooperative Spieltheorie verwendet zur Analyse der Koalitionsbildung eine
charakteristische Funktion, ,, ... that assigns to each coalition a worth, which is the
aggregate payoff a coalition can get irrespective of the behaviour of other players".
(Finus/Rundshagen (2002), S. 11). Die Koalitionsmitglieder maximieren dabei gemein-
sam die Wohlfahrt ihrer Koalition. Die Strategien der Nichtmitglieder oder mögliche
Koalitionsstrukturen im Umfeld der eigenen Koalition haben dabei keinen Einfluss auf
die potentielle Auszahlung bzw. den Wert der Koalition: Sie kann sich selbst eine
bestimmte Wohlfahrt sichern bzw. die Gegenspieler können eine gewisse Auszahlung
nicht verhindern (Bloch 1996, 1997, Holler/Illing 2000).
Solch eine Sichtweise ist natürlich wenig geeignet, um den eigentlichen Prozess der
Koalitionsbildung mit seinen unbestreitbar vorhandenen Wechselwirkungen zu
erklären, weil ,, ... cooperative game theory ... fail to capture the effects of externalities
among coalitions". (Bloch (1996), S. 91). Deshalb ging man im Rahmen der
Koalitionstheorie zur Anwendung einer nicht-kooperativen Spieltheorie über, die in der
Lage ist, ,, ... the issue of competition between coalitions which was ignored in
traditional cooperative game theory" (Bloch (1997), S. 311) zu berücksichtigen.
Die nicht-kooperative Spieltheorie setzt voraus, dass Spieler bei ihrer Entscheidung
über eine Mitgliedschaft in einer Koalition sich vornehmlich an der für sich selbst
erzielbaren Auszahlung orientieren (Finus 2002
)
. Diese muss im Fall der Kooperation
höher sein als im nicht-kooperativen Status quo, d.h. die Kooperation muss individuell
rational sein (Finus 2001b). Zudem negiert die nicht-kooperative Spieltheorie die
Möglichkeit, dass sich unabhängige Spieler untereinander absprechen können: ,,Eine
Kommunikation ... , die eine Koordinierung der Strategien ermöglichen könnte, oder
4
gar der Abschluss von bindenden Vereinbarungen ... sind nicht zugelassen".
(Holler/Illing (2000), S. 3). Sie bedient sich der ,, ... partition function, which assigns a
value to each coalition in a coalition structure as a function of the entire coalition
structure, not just the coalition in question". (Yi (1997), S. 202). Trotzdem besteht auch
in der nicht-kooperativen Spieltheorie eine Möglichkeit zur Kooperation zwischen den
Ländern, obwohl keine exogenen Autoritäten existieren, die solche Abmachungen
verbindlich durchsetzen könnten (Finus 1997). Dazu müssen sich die Spieler jedoch auf
ein Vertragsdesign einigen, das selbst-durchsetzend ist (Barrett 1990). Da seitens eigen-
ständiger Spieler jede Selbstverpflichtung hinsichtlich einer Kooperation unglaub-
würdig ist, besteht der einzige Anreiz, einem Abkommen beizutreten, in einem
wirtschaftlichen Vorteil durch solch eine Kooperation (Carraro 2000). ,,Da es auf inter-
nationaler Ebene keine ... Institutionen gibt, die in der Lage sind, internationale
Umweltabkommen per Gesetz durchzusetzen, scheint es sinnvoll, internationale
Umweltprobleme mit Hilfe der nicht-kooperativen Spieltheorie zu analysieren". (Finus
(1997), S. 244). Dieser Einschätzung folgend konzentriere ich mich bei den weiteren
Ausführungen (bis auf das Konzept des Kerns) auf die nicht-kooperative Spieltheorie.
2.2
Dynamische Spielmodelle contra reduzierte Spielstufenmodelle
In der einschlägigen Literatur werden zwei Spielmodelle herangezogen, um inter-
nationale Umweltabkommen zu untersuchen. Diese unterscheiden sich vornehmlich
durch den zugrundegelegten Zeithorizont: Entweder modelliert man ein statisches (one
shot game) oder ein dynamisches Spiel (Finus 1997). In einem dynamischen Spiel-
modell können Spieler ihre Handlungen von Informationen abhängig machen, die sie in
der Vergangenheit erhalten haben. Meist wird die Dynamisierung dadurch erreicht, dass
ein Grundspiel beliebig oft wiederholt wird, wobei entweder von vornherein feststeht,
wie viele Wiederholungen es gibt (endliches Spiel) oder die Anzahl der Wieder-
holungen im Voraus nicht bekannt ist (unendliches Spiel). Zwischen den Spielern
werden dadurch strategische Interaktionen (Kooperation, Drohung, Vergeltung etc.)
ermöglicht (Holler/Illing 2000). Ein endliches Spiel hat den Nachteil, dass das
Spielende und somit das Verhalten der Spieler in der Schlussrunde feststeht und man
durch einen retrograden Rückschluss von der letzten bis zur ersten Spielrunde eine
Aussage über den Ausgang des gesamten Spiels treffen kann. Deshalb werden, wenn
5
man den dynamischen Rahmen wählt, internationale Umweltabkommen vorwiegend als
unendliche Spiele modelliert (Endres/Finus 2000). Ein einmal ausgehandelter Vertrag
muss dann in den folgenden Spielrunden mittels glaubwürdiger Drohungen durchgesetzt
werden. Die Glaubwürdigkeit der Sanktionen wird in diesem Fall durch ein
renegotiation-proof equilibrium gewährleistet (Barrett 1994).
Im statischen Kontext wird oftmals ein reduziertes Spielstufenmodell angewendet. Es
zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Spielstufen, die unterschiedliche Entschei-
dungen zum Inhalt haben (z.B. Mitgliedschaft in einem Abkommen, Festlegung des
eigenen Emissionsniveaus bzw. der eigenen Vermeidungsanstrengungen, Aufteilung der
erreichbaren Wohlfahrt in einer Koalition), durch ,,backwards induction" zu einer Stufe
reduziert werden können. Dies ist möglich, da das Verhalten in den späteren Stufen
exogen vorgegeben ist und die zeitliche Struktur der Stufen nicht explizit modelliert
wird (Endres/Finus 2000, Finus 2001b, Finus/Rundshagen 2001). Meist geht man im
Zusammenhang mit einem globalen Umweltproblem von zwei Stufen aus: In der ersten
Stufe (coalition game) entscheiden die Länder nicht-kooperativ ob sie einem
Abkommen beitreten oder nicht. In der zweiten Stufe, dem emission game, treten die
Koalitionäre wie ein Spieler auf und teilen sich die erzielten Wohlfahrtsgewinne nach
einem vereinbarten Verteilungsschlüssel untereinander auf (Bloch 1997, Carraro 2000).
Innerhalb des Abkommens geht man also zu einem kooperativen Verhalten über. Den
Nichtmitgliedern des Abkommens gegenüber verhält sich die Koalition, ebenso wie
vice versa auch die Nichtmitglieder gegenüber der Koalition, weiterhin nicht-
kooperativ. Alle Informationen, die ein Land für die Entscheidung über seine Mitglied-
schaft in einer Koalition benötigt, spiegeln sich in seiner Auszahlung wider, die es bei
einer bestimmten Koalitionsstruktur, gegeben die Entscheidungen der anderen Länder,
erwarten kann. Da bei einem reduzierten Spielstufenmodell ferner angenommen wird,
dass sich Länder im Gleichgewicht unverzüglich einer möglichen Änderung innerhalb
der Koalitionsstruktur anpassen und somit kein temporärer Freifahrergewinn erzielt
werden kann (Finus 2001b, Finus/Rundshagen 2001), entscheiden alle Länder
gleichzeitig über ihren Status, den sie aufgrund der vorliegenden Informationen
anstreben. Da wiederholte Spiele vorwiegend der Analyse des zweiten Typs von
Freifahrerverhalten dienen (siehe Kapitel 2.4) und somit nicht geeignet sind, die
grundsätzliche Frage nach der Mitgliedschaft in einem Abkommen zu beantworten,
6
wird im Folgenden ausschließlich das reduzierte Spielstufenmodell herangezogen, um
das Zustandekommen möglicher Koalitionen zu diskutieren.
2.3
Die Bedeutung von externen Effekten
Abkommen haben in erster Linie Auswirkungen auf die Vertragsparteien. Diese er-
hoffen sich dadurch eine gemeinsame Lösung eines für sie relevanten Problems. Neben
solchen internen und durchaus gewollten Effekten können aber auch externe
Nebeneffekte entstehen, sofern das eigene Handeln bei anderen zu Auswirkungen führt,
die man bei der Entscheidung über die Qualität und das Ausmaß der eigenen Handlung
nicht berücksichtigt (Endres 2000). Wenn Länder, ihrer individuellen Anreizstruktur
folgend, durch die Bildung einer Koalition zur kooperativen Nutzung einer gemein-
samen Ressource eine höhere Wohlfahrt erzielen können als mit der Verfolgung einer
anderen Strategie, so bleibt das für die Nichtmitglieder nicht folgenlos. ,,In international
games ... the formation of coalitions creates externalities". (Carraro/ Marchiori (2002),
S. 4). Yi (1997) spricht im Zusammenhang mit Externalitäten von einem ,, ... useful
organizing principle in examining economic games of coalition formation". (Yi (1997),
S. 202). Ob diese Folgen für Nichtkoalitionäre angenehm oder unangenehm ausfallen,
hängt davon ab, zu welchem Zweck sich jeweils einige Länder zusammenschließen:
,,Depending on wether the formation of a coalition is beneficial or harmful to external
players, the two concepts of positive or negative spillovers can be defined". (Bloch
(1997), S. 317).
2.3.1 Negative
Externalitäten
Wenn die Bildung einer Koalition bzw. die vereinbarten Aktionen der Koalitions-
mitglieder zu Nachteilen für die Nichtmitglieder führen, so spricht man von einem
negativen externen Effekt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn man durch eine
Koalition eine gewisse Exklusivität erreichen möchte und den Kreis der Mitglieder
beschränkt: ,,Members of club good agreements often exhibit a negative externality on
outsiders". (Finus (2001b), S. 64). Hier partizipiert der Außenstehende nicht nur nicht
vom Inhalt des Abkommens, sondern kann auch noch von unvorteilhaften Maßnahmen
betroffen sein, welche die Mitglieder gegenüber Nichtmitgliedern in Kraft setzen.
Lediglich die Koalitionsmitglieder profitieren von der vereinbarten Kooperation: ,,A
7
club is a voluntary group deriving mutual benefit from sharing .. a good characterized
by excludable benefits". (Cornes/Sandler (1986), S. 159). Yi (1997) definiert für die
per-member partition function (siehe auch Kapitel 5.4) im Rahmen negativer
Externalitäten explizit folgende Eigenschaften:
a)
Wenn Koalitionen fusionieren, um gemeinsam eine größere Koalition zu bilden,
so sind Koalitionen, die nicht Teil dieser Fusion sind, nach einer Fusion
schlechter gestellt. Dies ist die ,, ... defining feature of coalition formation with
negative external effects across coalitions". (Yi (1997), S. 209).
b)
Diejenigen Koalitionsmitglieder, deren Koalition mit einer gleichgroßen oder
größeren Koalition fusioniert, sind nach der Fusion besser gestellt.
c) Wenn ein Mitglied seine bisherige Koalition verlässt, um einer größeren oder
gleichgroßen anderen Koalition beizutreten, dann erfährt dieser Spieler einen
Vorteil aus seiner Entscheidung.
Somit führt sowohl eine Vergröberung als auch eine Konzentration der Koalitions-
struktur (siehe auch Kapitel 5.1) zu Vorteilen bei den Mitgliedern der jeweils kleineren
Koalition. Yi (1997) hebt aber ausdrücklich hervor, dass die unter b) und c) genannten
Vorzüge nicht auf alle Beteiligten zutreffen. Mitglieder der jeweils größeren Koalition
profitieren nicht notwendigerweise von solchen Aktionen. Es ist offensichtlich, dass
kein Spieler freiwillig einer Koalition fernbleiben möchte, wenn ihm durch seine
Verweigerungshaltung Nachteile entstehen. Ohne mathematischen Beweis ist intuitiv
klar, dass die große Koalition (alle Spieler kooperieren und werden Teil eines einzigen
Abkommens) bei Vorhandensein negativer externer Effekte und bei keinerlei Zugangs-
beschränkungen zu einem Abkommen die einzig stabile Koalitionsstruktur wäre. Somit
ist verständlich, dass die Zugrundelegung negativer externer Effekte für die Erklärung
von Koalitionsbildungen wenig geeignet ist. Nach diesem Konzept wäre immer mit
einem einzigen Abkommen zu rechnen, dem alle Länder der Erde beitreten wollen.
Deshalb wird im Folgenden zur Definition gleichgewichtiger Koalitionsstrukturen bei
globalen Umweltproblemen von positiven externen Effekten ausgegangen.
2.3.2 Positive
Externalitäten
Positive externe Effekte entstehen dort, ,, ... where the formation of a coalition increase
the payoff of agents ... who are not members of the coalition". (Bloch (1997), S. 313).
8
Außenstehende profitieren vor allem dann von einer Koalitionsbildung durch andere,
wenn diese sich auf die Bereitstellung eines öffentlichen Guts bezieht, von dem
Nichtkoalitionsmitglieder nicht ausgeschlossen werden können. Der positive externe
Effekt zeichnet sich dadurch aus, dass ,,external members enjoy the public good without
supporting its cost". (Bloch (1997), S. 333). Carraro/Marchiori (2002) geben eine gute
Erklärung, warum besonders Spiele mit positiven Externalitäten zur Untersuchung
gleichgewichtiger Koalitionsstrukturen geeignet sind: ,,The case of positive spillovers is
also one in which coalitions are most likely to be unstable. Hence, it provides a
benchmark for all other possible assumptions on coalition spillovers. (Carraro/
Marchiori (2002), S. 8). Und noch einen Vorteil haben diese Spiele. An ihnen kann man
besonders gut das sogenannte Freifahrerverhalten studieren. Sobald positive externe
Effekte vorhanden sind, wird es immer einige geben, die von den Anstrengungen
anderer profitieren wollen, ohne selbst etwas zur Verbesserung der Situation beitragen
zu müssen: ,,The existence of positive spillovers creates an incentive to free-ride on the
coalition decision action". (Carraro/Moriconi (1998), S. 7).
2.4
Die Arten des Freifahrerverhaltens
Wenn man davon ausgeht, dass ein internationales Umweltabkommen in Ermangelung
einer supranationalen Institution, welche die Umsetzung eines solchen Vertrags
garantieren könnte, selbstdurchsetzend (self-enforcing) sein muss, so besteht die größte
Bedrohung eines Abkommens in einem potentiellen Freifahrerverhalten durch einzelne
Staaten. ,,Weil ein öffentliches Gut auch ohne eigenen Zahlungsbeitrag genutzt werden
kann, ist es individuell rational, sich als Trittbrettfahrer (Free Rider) zu verhalten".
(Holler/Illing (2000), S. 8). Somit wird das Freifahrerverhalten sogar zum generellen
Problem jedweder Zusammenarbeit: ,,The main problem of cooperation is free-riding".
(Finus (2002), S. 1). Dabei werden zwei Arten des Freifahrerverhaltens unterschieden.
Der erste Typ von Freifahrerverhalten zeichnet sich dadurch aus, dass ein Land einem
Abkommen nicht beitritt und als Außenstehender von den Vermeidungsanstrengungen
der Koalitionsmitglieder profitiert. Dabei kann diese Vorteilsnahme anhand der
Reaktionsfunktion der Spieler noch feiner differenziert werden. Wenn die Außen-
stehenden, aufgrund einer hohen Wechselwirkung mit der Koalition, die Möglichkeit
besitzen, die Emissionsreduktionen seitens der Koalitionsmitglieder dadurch zu
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832456610
- ISBN (Paperback)
- 9783838656618
- DOI
- 10.3239/9783832456610
- Dateigröße
- 577 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Juli)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- spieltheorie externalität freifahrer kooperation nash
- Produktsicherheit
- Diplom.de