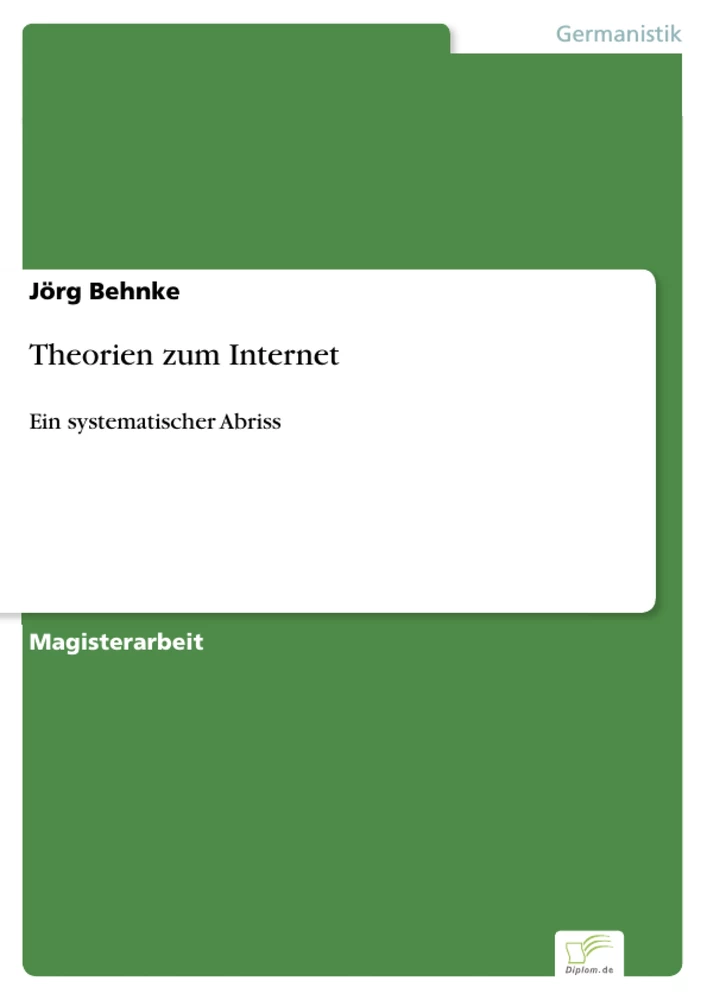Theorien zum Internet
Ein systematischer Abriss
©2001
Magisterarbeit
126 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Über das Internet ist jede Menge gedacht und geschrieben worden. Die Arbeit führt eine Bestandsaufnahme der Fakten und Fiktionen, um die herum sich das neue Medium entwickelt, durch.
Zuerst prophezeiten einige umfassende Medientheorien angesichts der Fortschritte in der Entwicklung medialer Vernetzung einen globalen Umschwung. Vor allem Marshall McLuhan und Vilém Flusser betonten deutlich die Ablösung linearer Denkstrukturen. Die Argumentationskette wird an dieser Stelle durch die Ansätze von Friedrich Kittler und Paul Virilio, sowie dem Denkbild des Rhizoms von Gilles Deleuze und Félix Guattari und dem Projekt der MEMEX von Vannevar Bush Raum vervollständigt.
Als sich die weitere Verbreitung des Mediums durch Benutzeroberflächen wie das WWW abzeichnete, begann die Metaphorisierung des Neuen als preformierendes Element, wodurch soziales und wirtschaftliches Selbstverständnis des Internet implementiert wurden. Neben der wichtigsten Diskurslinie, die durch den Gedanken des Cyberspace versus Datenautobahn charakterisiert ist, werden die Metaphern der Digitalen Stadt, des Globalen Dorfes und der Virtuellen Gemeinschaft betrachtet.
Das dritte Kapitel zeigt auf, wie die Schwächen der kommunikationswissenschaftlichen Theoriebildung soziale Utopien als Möglichkeit des Umgangs mit der neuen Technologie stark machen. Diese werden anhand der paradoxen Ideologie der virtuellen Klasse und des Zugangs durch die Netzkritik betrachtet.
An die Stelle der Pionierphase, mit deren zuversichtlichen Gründerideologien, tritt ein Netzalltag, der soziale, politische und ökonomische Probleme aufzeigt. Das Internet unterliegt nun starken Kontrollmechanismen, wie Kapitel vier beschreibt. Vor allem die Wirtschaft bekundet großes Interesse, das Potential globaler Netzwerke zu nutzen, um bereits bestehende Herrschaftsgebiete auszubreiten. Diesem Bestreben, das Internet als Wirtschaftsgut zu etablieren, stehen Hoffnungen auf soziale Leistungen gegenüber.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
2.Metaphern im Kontext des Internet4
2.1Datenautobahn5
2.2Cyberspace und Datenmeer9
2.3Digitale Stadt12
2.4Globales Dorf14
2.5Virtuelle Gemeinschaft16
Zusammenfassung19
3.Allgemeine Medientheorien zur medialen Vernetzung21
3.1Marshall McLuhan22
3.1.1Das Medium ist die Botschaft22
3.1.2Die Ausweitungen des menschlichen Körpers23
3.1.3The Global Village24
3.2Friedrich A. Kittler26
3.2.1Aufschreibesysteme26
3.2.2Das Verschwinden […]
Über das Internet ist jede Menge gedacht und geschrieben worden. Die Arbeit führt eine Bestandsaufnahme der Fakten und Fiktionen, um die herum sich das neue Medium entwickelt, durch.
Zuerst prophezeiten einige umfassende Medientheorien angesichts der Fortschritte in der Entwicklung medialer Vernetzung einen globalen Umschwung. Vor allem Marshall McLuhan und Vilém Flusser betonten deutlich die Ablösung linearer Denkstrukturen. Die Argumentationskette wird an dieser Stelle durch die Ansätze von Friedrich Kittler und Paul Virilio, sowie dem Denkbild des Rhizoms von Gilles Deleuze und Félix Guattari und dem Projekt der MEMEX von Vannevar Bush Raum vervollständigt.
Als sich die weitere Verbreitung des Mediums durch Benutzeroberflächen wie das WWW abzeichnete, begann die Metaphorisierung des Neuen als preformierendes Element, wodurch soziales und wirtschaftliches Selbstverständnis des Internet implementiert wurden. Neben der wichtigsten Diskurslinie, die durch den Gedanken des Cyberspace versus Datenautobahn charakterisiert ist, werden die Metaphern der Digitalen Stadt, des Globalen Dorfes und der Virtuellen Gemeinschaft betrachtet.
Das dritte Kapitel zeigt auf, wie die Schwächen der kommunikationswissenschaftlichen Theoriebildung soziale Utopien als Möglichkeit des Umgangs mit der neuen Technologie stark machen. Diese werden anhand der paradoxen Ideologie der virtuellen Klasse und des Zugangs durch die Netzkritik betrachtet.
An die Stelle der Pionierphase, mit deren zuversichtlichen Gründerideologien, tritt ein Netzalltag, der soziale, politische und ökonomische Probleme aufzeigt. Das Internet unterliegt nun starken Kontrollmechanismen, wie Kapitel vier beschreibt. Vor allem die Wirtschaft bekundet großes Interesse, das Potential globaler Netzwerke zu nutzen, um bereits bestehende Herrschaftsgebiete auszubreiten. Diesem Bestreben, das Internet als Wirtschaftsgut zu etablieren, stehen Hoffnungen auf soziale Leistungen gegenüber.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
2.Metaphern im Kontext des Internet4
2.1Datenautobahn5
2.2Cyberspace und Datenmeer9
2.3Digitale Stadt12
2.4Globales Dorf14
2.5Virtuelle Gemeinschaft16
Zusammenfassung19
3.Allgemeine Medientheorien zur medialen Vernetzung21
3.1Marshall McLuhan22
3.1.1Das Medium ist die Botschaft22
3.1.2Die Ausweitungen des menschlichen Körpers23
3.1.3The Global Village24
3.2Friedrich A. Kittler26
3.2.1Aufschreibesysteme26
3.2.2Das Verschwinden […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5352
Behnke, Jörg: Theorien zum Internet: Ein systematischer Abriss / Jörg Behnke - Hamburg:
Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Marburg, Universität, Magister, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Seite 1
2. Metaphern im Kontext des Internet
4
2.1. Datenautobahn
5
2.2. Cyberspace und Datenmeer
9
2.3. Digitale Stadt
12
2.4. Globales Dorf
14
2.5. Virtuelle Gemeinschaft
16
Zusammenfassung
19
3. Allgemeine Medientheorien zur medialen Vernetzung
21
3.1. Marshall McLuhan
22
3.1.1.
Das
Medium
ist
die
Botschaft
22
3.1.2. Die Ausweitungen des menschlichen Körpers
23
3.1.3. The Global Village
24
3.2. Friedrich A. Kittler
26
3.2.1. Aufschreibesysteme
26
3.2.2. Das Verschwinden des Subjekts
27
3.2.3. Die Sphäre des Symbolischen
29
3.3. Vilém Flusser
31
3.3.1. Nachgeschichte
31
3.3.2. Technische
Bilder
32
3.3.3. Krise der Linearität
34
3.4. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Vannevar Bush
36
3.4.1. Wunschmaschine
36
3.4.2.
Rhizom
38
3.4.3.
MEMEX
38
3.5. Paul Virilio
40
3.5.1. Die
Dromologie
40
3.5.2. Die Ästhetik des Verschwindens
42
3.5.3.
Eroberung
des
Körpers
45
Zusammenfassung
46
4. Medientheoretische Defizite und die Entwicklung sozialer Utopien
48
Exkurs: Die technische Geschichte des Internet
48
4.1. Theorie-Objekt Internet
52
4.1.1. Zur Topographie des Netzes
52
4.1.1.1. Distribuiertes Netzwerk
4.1.1.2. Sammelbecken von Informationen
52
4.1.1.3. Wahrnehmung des Internet
53
4.1.1.4. Die ökonomische Topographie des Internet
54
4.1.2. Kommunikationstheoretische
Herausforderungen
55
4.1.2.1.
Abgrenzungen
55
4.1.2.2.
Ein neues Konzept der Massenkommunikation ist
notwendig
56
4.1.2.3.
Push- oder Pull-Medium?
58
4.2. Die Entwicklung sozialer Utopien
59
4.2.1. Die virtuelle Klasse
61
4.2.1.1.
Der Wille zur Integration
61
4.2.1.2.
Die neue linke Ideologie
62
4.2.1.3.
Die neue rechte Ideologie
63
4.2.2. Die Netzkritik Ein europäischer Zugang
66
4.2.2.1.
Der Cyberspace ist nicht unabhängig
66
4.2.2.2. Skeptizismus
67
4.2.2.3.
Eine neue Umgangsform
68
4.2.2.4. Inhaltliche
Aspekte der Netzkritik
68
4.2.2.5.
Elektronischer Widerstand
70
Zusammenfassung
71
5. Wirtschaft und Politik: Wer kontrolliert das Internet?
73
5.1. Einwirkungen auf den Cyberspace
74
5.1.1. Die Kluft zwischen den Vorstellungen des Cyberspace
als
Sozial-
oder
Wirtschaftsraum
74
5.1.2. Der Glaube an die Demokratie
75
5.1.3. Die Herrschaft des Kapitalismus
77
5.2. Kontrolle im Internet
79
5.2.1. Technische
Kontrollmechanismen
79
5.2.2.
Kontrolle
des
Zugangs
81
5.2.3. Rechtliche
Kontrolle
83
5.3. Das Internet in der massenmedialen Umwelt
88
5.3.1. Abgrenzung der Begriffe Multimedia und Interaktion
88
5.3.2. Konvergenz der Medien
90
Zusammenfassung
93
6. Ausblick
95
Abkürzungsverzeichnis
101
Glossar
102
Abbildungen
110
Forschungsliteratur
118
1
1. Einleitung
Über das Internet ist schon jede Menge gedacht und geschrieben worden. Eine
Bestandsaufnahme der Fakten und Fiktionen, um die herum sich das neue Medium
entwickelt, ist angebracht. Es gilt, die Theoriediskussion, welche sich im deutschen
Sprachraum um das globale Netz entwickelt hat, nachzuzeichnen. Das Internet ist eine
intellektuelle Herausforderung: ,,Wie bei jeder Technologie knüpfen sich auch an die
elektronisch-digitalen Netzwerke vielfältige soziale Phantasien, welche die Potentiale
der Technik erst zur Praxis werden lassen."
1
Erzählpraktiken und Erzählgenres spielen
eine wichtige Rolle im Prozeß der Konstruktion sozialer Wirklichkeit im Denken rund
um die neue Technik. Diese Erzählpraktiken sind erkennbar in Topoi, Metaphern,
Szenarien und Diskursen, die letztendlich als Leitbilder wirken. Was sich davon
bewahrheitet hat, was sich ins Reich der Cybermythen verflüchtigt hat und welche
Denkansätze dem Internet letztendlich dazu verhalfen, seinen Platz in der
massenmedialen Umwelt einzunehmen, wird im Einzelnen betrachtet.
Das ARPANET als Grundtechnologie des Internet ging 1963 in Entwicklung, der sich ab
1972 sich mehr und mehr Forschungseinrichtungen weltweit anschlossen. 1994 erfolgte
die Öffnung des World Wide Web für eine breite Nutzerschaft. Technisch funktioniert
das Internet als Datenaustausch zwischen einem Empfänger und einer Quelle, Der von
Übertragungsprotokollen geregelt wird. Zugang zum Internet erhalten Interessierte mit
einem Heimcomputer, einem Modem, einem Telefonanschluß einem Service-Provider
und der entsprechenden Software. Heute werden verschiedene Begriffe synonym
verwendet, um diese Technologie zu beschreiben. Im Folgenden treten Internet,
Cyberspace, Netz oder Netzwerk auf.
Am Anfang, als die Nutzung der elektronisch-digitalen Netze von abenteuerlicher
Exklusivität geprägt war, bevor das Internet durch das World Wide Web (WWW) für
größere Benutzergruppen zugänglich wurde, stand die anarchistische Blütezeit.
2
Diese
allererste Pionierphase bis Anfang der 90er Jahre ist kaum durch Publikationen in
konventioneller schriftlicher Form dokumentiert. Doch es gab einige umfassende
Medientheorien, die angesichts der Fortschritte in der Entwicklung medialer Vernetzung
einen globalen Umschwung prophezeiten. Vor allem Marshall McLuhan und Vilém
Flusser betonten deutlich die Ablösung linearer Denkstrukturen. Ihre Prognosen
bewegen sich im Bereich der Technikutopien, deren Argumente den aufkommenden
1
Neverla, Irene: Das Medium denken. Zur sozialen Konstruktion des Netz-Mediums. In: Das Netz-Medium. Hg.
von Irene Neverla. Opladen/Wiesbaden 1998. S.18.
2
Vgl. Rötzer, Florian: Die Telepolis. Urbanität im digitalen Zeitalter. Mannheim 1995. S.94.
2
Netzdiskurs maßgeblich prägten. Diese frühen Hoffnungen und Prophezeiungen werden
im zweiten Kapitel der Arbeit diskutiert. Um die Argumentationskette zu schließen,
finden die Ansätze von Friedrich Kittler und Paul Virilio, sowie das Denkbild des
Rhizoms von Gilles Deleuze und Félix Guattari und das Projekt der MEMEX von
Vannevar Bush Raum.
Nach dieser ersten Pionierphase begann ein zweiter Abschnitt im Übergang zur
Implementierungsphase, als sich schon die weitere Verbreitung des Mediums durch
Benutzeroberflächen wie das WWW abzeichnete. Hier kommt vor allem eine
Metaphorisierung des neuen Mediums als präformierendes Element zum Zuge, wodurch
soziales und wirtschaftliches Selbstverständnis des Internet implementiert wurden. Es
lassen sich deren wichtigste Diskurslinien grob unter den Gedanken des Cyberspace
versus Datenautobahn charakterisieren. Um der Fülle des Verständnisses über das
Internet Herr zu werden, sind im ersten Kapitel des weiteren die Metaphern der
Digitalen Stadt, des Globalen Dorfes und der Virtuellen Gemeinschaft betrachtet.
Durch die Entwicklung des WWW, dessen graphische Benutzeroberfläche es dem
Internet ermöglicht, multimediale Anwendungen mit einzubeziehen, setzte eine stetig
zunehmende Nachfrage ein. Weltweit haben immer mehr private Nutzer und öffentliche
oder kommerzielle Einrichtungen das Bedürfnis, ans Netz zu gehen. Da der bestehenden
Infrastruktur eine ständige Überlastung droht, die aus staatlichen Haushalten nicht mehr
finanziert werden kann, wird das Internet zum Territorium der Privatwirtschaft erklärt.
Dieser Ausbreitung begegnen kommunikationswissenschaftliche Theorien mit
Problemen. Vor allem die Einordnung des Internet ins System der Massenmedien
erfordert eine Reorientierung. Es entsteht Bedarf, etablierte Begriffe neu zu definieren
oder deren Grenzen im Angesicht globaler Vernetzung neu auszuloten. Das dritte
Kapitel zeigt auf, wie diese Schwächen der Theoriebildung eine weitere Perspektive des
Umgangs mit der neuen Technologie stark machen: Die Bildung sozialer Utopien. Diese
werden anhand der paradoxen Ideologie der virtuellen Klasse und des Zugangs durch
die Netzkritik betrachtet.
Viele Vorstellungen haben sich in der Realität der Netzwerke nicht bewahrheitet. An die
Stelle der Pionierphase, mit deren zuversichtlichen Gründerideologien, tritt ein
Netzalltag, der soziale, politische und ökonomische Probleme aufzeigt. Der Glaube, im
Cyberspace einen von der Welt unabhängigen Sozialraum errichten zu können, ist
kurzsichtig. Das Internet unterliegt starken Kontrollmechanismen, wie Kapitel vier
beschreibt. Vor allem die Wirtschaft bekundet großes Interesse, das Potential globaler
3
Netzwerke zu nutzen, um bereits bestehende Herrschaftsgebiete auszubreiten. Diesem
Bestreben, das Internet als Wirtschaftsgut zu etablieren, stehen Hoffnungen auf soziale
Leistungen gegenüber. Die Aufgabe der Regulation haben nationale Regierungen, trotz
massiver Durchsetzungsprobleme im globalen Raum, dringender als vorher zu
übernehmen.
4
2. Metaphern im Kontext des Internet
Die Multimedia-Revolution überraschte die Menschheit genauso wie viele andere
technologische Revolutionen der Neuzeit. Das ist ebensowenig ein Novum, wie die
Tatsache, daß umwälzende Neuerungen noch immer zwei ganz verschiedene
Reaktionen ausgelöst haben. Berechenbarer Enthusiasmus der Innovations-Freaks steht
den düsteren Unkenrufen der Unheilkünder gegenüber.
3
Anfänglich war unklar, wohin
die digitale Revolution führen würde. Die Betreiber konnten nicht erkennen, welche
Gewinnaussichten sich ihnen bieten würden, und die Endbenutzer rätselten noch, was
ihnen der Computer eigentlich alles an brauchbaren Erleichterungen bringe.
4
Allen
menschlichen Erfindungen wohnt eine doppelte Tendenz zum Guten und zum Bösen
inne, womit es der Mensch in der Hand hat, das rechte Mischungsverhältnis zu
bestimmen.
5
Da sich kein neues Medium von selbst etabliert, hängt die Akzeptanz und Durchsetzung
desselben ,,vielmehr von Leitbildern ab, an denen und über die sich die Kommunikation
organisiert und stabilisiert."
6
Erst die Metaphern geben dem Medium nämlich eine
anschauliche, allgemeinverständliche Form und sorgen für Akzeptanz in breiten
Bevölkerungskreisen.
7
Wo die Aussicht auf richtige Worte fehlt, wuchern Metaphern.
,,Denn Metaphern überbrücken [...] die Kluft zwischen Wissen und (Noch-)
Nichtwissen."
8
Noch nie zuvor in der Geschichte wurde eine neue Technologie mit soviel
Medienbegleitung, Werbung und neuen Wortgebilden versehen, wie dies bei der
vernetzten Datenkommunikation der Fall ist. Die Kontexte der neuen Medien sind zu
komplex, um verläßliche Daten über ihre Effekte gewinnen zu können. Wohl eben
deshalb, so Hörisch, produziere kaum ein zweites Wortfeld so viele Metaphern wie das
der neuen Medien.
9
Die Beschäftigung mit den Metaphern für die neuen
Kommunikationsnetze der Zukunft ist schon deshalb bedeutsam, da sie als Leitbilder der
3
Vgl. Sommer, Theo: Multimedia Fluch oder Segen? In: Bertelsmann Briefe 135. Frühling/Sommer 1996. S.4.
4
Vgl. Ebd. S.4.
5
Vgl. Ebd. S.4.
6
Bickenbach, Matthias; Maye, Harun: Zwischen fest und flüssig. Das Medium Internet und die Entdeckung seiner
Metapern. In: Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen Web Werk. Hg. von Lorenz Gräf, Markus Krajewski.
Frankfurt/Main, New York 1997. S.82.
7
Vgl. Bühl, Achim: Die virtuelle Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Sozialer Wandel im digitalen Zeitalter. 2. Aufl.
Wiesbaden 2000. S.21.
8
Hörisch, Jochen: Medienmetaphorik. In: Universitas 600. Schwerpunkt: Schlimme Neue Medien? 1996. S.529.
9
Vgl. Ebd. S.529.
5
maßgeblich an diesem Technikprojekt beteiligten mitbestimmen, wohin die technische
Reise geht.
10
Aus der Flut sprachlicher Figuren rund um das Internet werden im folgenden Abschnitt
fünf zentrale Metaphern einer näheren Analyse unterzogen. Es handelt sich um die
Sinnbilder Datenautobahn, Cyberspace und Datenmeer, digitale Stadt, globales Dorf
und virtuelle Gemeinschaft.
2.1. Datenautobahn
Im Bereich der neuen Kommunikationstechniken dürfte es keine prominentere
Begriffsschöpfung als die der Datenautobahn geben. Die Wortschöpfung von der
Datenautobahn oder dem Infohighway geht auf eine Regierungserklärung des
ehemaligen US-amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore und des Handelsministers Ron
Brown zurück. Sie kündigten im September 1993 eine Initiative zum Ausbau einer
nationalen Informationsinfrastruktur (NII) an und legten einen Aktionsplan vor.
11
In
Anlehnung an diese seitens der Regierung Clinton eingeleitete Initiative wurde auf der
europäischen Ebene 1994 der sogenannte Bangemann-Report für den Rat der
Europäischen Union erarbeitet.
12
Hier wird die Metapher Datenautobahn gebraucht, um
Vorschläge zu den Bereichen Home-Shopping, Tele-Banking, Video on Demand,
elektronische Post und weltweit vernetzte Datenbanken zu unterbreiten.
Bühl weist darauf hin, daß die Metapher der Daten- oder Infobahn vor allem von der
Telekom in Werbefilmen benutzt werde, um Akzeptanz seitens der Bevölkerung zu
schaffen.
13
Die neue Technologie verspricht demnach ,,24 produktive Stunden".
Microsofts Werbung: ,,Where do you want to go today?" prophezeit einen
vorgegebenen Weg. Es handelt sich hier explizit um das Gehen als die zu wählende
Form der Fortbewegung. Es sei eine Bewegung, die auf Geschwindigkeit beruht, auf
10
Vgl. Canzler, Weert; Helmers, Sabine; Hoffmann, Ute: Die ,,Datenautobahn". Sinn und Unsinn einer populären
Metapher. In: Forum Wissenschaft 1/1995. S.10.
11
Al Gore veranschaulichte das Projekt vor dem nationalen Presseclub mit folgenden Worten: ,,One helpful way is to
think of the National Information Infrastructure as a network of highways much like the Interstates begun in the `50s.
These are highways carrying information rather than people or goods. And I'm not talking about just one eightlane
turnpike. I mean a collection of interstates and feeder roads made up to a different materials in the same way that roads
can be concrete or macadam or gravel. Some highways will be made up of fiber optics. Others will be built out of
coaxial or wireless. But a key point they must be and will be two way roads. These highways will be wider than today's
technology permits. This is important because a television program contains more information than a telephone
conversation; and because new uses of video and voice and computers will consist of even more information moving at
even faster speeds. These are the computer equivalents of wide loads. They need wide roads. And these roads must go
in both directions." Quelle: Canzler, Weert; Helmers, Sabine; Hoffmann, Ute: Die ,,Datenautobahn". Sinn und Unsinn
einer populären Metapher. In: Forum Wissenschaft 1/1995. S.10.
12
Bangemann, Martin u.a.: Europa und die globale Informationsgesellschaft. Empfehlungen für den Europäischen Rat.
In: Kursbuch Neue Medien. Hg. von Stefan Bollmann. Mannheim 1995.
13
Vgl. Bühl (Anm. 7) S.23.
6
Transport basiert, und zugleich weitgehend blind gegenüber dem ist, was transportiert
wird.
14
,,Alles ist erreichbar, wörtlich und metaphorisch, der amerikanische Traum steht
Pate."
15
Dabei deutet die Metaphorik auf einen festen Untergrund hin, worauf sich der
potentielle Benutzer bewegt. Das Bild der Autobahn hakt nahtlos ein, es impliziert
geregelten, zielgerichteten Verkehr, Ordnung statt Freiheit.
16
Mit dem Denken an
Geradlinigkeit geht das an Effizienz und Schnelligkeit einher. Datenautobahn ist primär
als Geschwindigkeits-Metapher zu verstehen. Nebenbei soll sie aber auch Vertrauen
erwecken, indem sie eine aus der Industriegesellschaft stammende Technologie analog
auf die Informationsgesellschaft überträgt.
17
Bickenbach und Maye weisen auf den Prozeß der Umorientierung vom Bild des
dynamischen Datenmeeres zur starren Straßenmetapher hin. Das Offene, Ambivalente
und Mehrdeutige werde in festere Formen gebannt, was Möglichkeiten einschränke,
aber Verläßlichkeit und Dauer verspräche. Das hat politisch weitreichende
Implikationen und führe zu heftigen Debatten um den Status des Internet und die Rechte
seiner User.
18
Wer Werte wie Demokratie und Freiheit der Information ins Feld führe,
lehne die Straßenmetapher folglich als Symbol einer Überwachungsordnung und eines
global capitalism ab.
19
Und tatsächlich steht der Begriff der Datenautobahn vor allem
der kommerzialisierten Ausrichtung der Informationsverwendung sehr nahe:
Anders als bei der Cyberspace-Variante geht es bei der Infobahn um die Bereitstellung möglichst
leistungsfähiger Leitungen [...]. Infobahn ist Big Business und Infobahn ist Ausdruck von
Gesellschaften, in denen es keine sozialen Visionen mehr gibt, nur noch Vorstellungen von neuer
Technik.
20
Zur gleichen Einsicht gelangt Bühl, wenn er von der Reduktion des Prozesses der
umfassenden Informatisierung der Gesellschaft auf technische Aspekte und der
Ausblendung sozialer Dimensionen und Folgen spricht. ,,Die Metapher der
Datenautobahn entspricht so dem herrschenden Technologieverständnis, welches in
14
Vgl. Jones, Steven: Kommunikation, das Internet und Elektromagnetismus. In: Mythos Internet. Hg. von Stefan
Münker, Alexander Roesler. Frankfurt/Main 1997. S.131.
15
Bickenbach, Maye (Anm. 6) S.91/92.
16
Vgl. Ebd. S.92.
17
Bühl (Anm. 7) S.23.
18
Vgl. Bickenbach, Maye (Anm. 6) S.93.
19
Vgl. Ebd. S.93.
20
Glaser, Peter: Unfaßbare Nähe neuester Welt. In: Spiegel special 3 Abenteuer Computer. 1995. S.82.
7
technizistischer Betrachtungsweise letztendlich auf Gewinnspannen und Profitraten
hinausläuft."
21
Wie aber versteht sich die neue Technik mit dem Bild der Datenautobahn? Kann der
Vergleich zwischen der festen Struktur einer Autobahn und einer ortsungebundenen
Welt der Datenkommunikation aufrecht erhalten werden?
Der wichtigste Unterschied liegt in der Raumwahrnehmung der Benutzer. Denn in
elektronischen Netzen werden nicht nur Informationen transportiert, vielmehr kann man
sich in sie hineinbegeben, um dort zu wohnen, zu arbeiten oder zu leben.
22
Der
Assoziation einer Autobahn als bloßes Instrument purer Raumüberwindung steht die
Bewegung des Datenreisenden in den virtuellen Räumen der Netze gegenüber, die zur
Kommunikation einladen. Schwerer als die unpassende Analogiebildung wiegen aber
die Konnotationen und Assoziationen, die aus der Begriffsschöpfung hervorgehen:
Der Begriff Datenautobahn ist [...] ambivalent. Er appelliert an die positiven Attribute der
erfolgreichen Verbreitung einer technischen Infrastruktur [...]. Gleichzeitig verbinden sich mit dem
Begriff skeptische und ablehnende Assoziationen: Die Autobahn ist zum Symbol des ökologisch,
sozial und funktional problematisch gewordenen Automobilismus geworden.
23
Ebenfalls werden durch die Begriffsanalogie der Datenautobahn wichtige Unterschiede
zwischen der verkehrs- und informationstechnischen Vernetzung verdeckt. Bill Gates
kritisiert, der Vergleich mit einer Datenautobahn, die geographische Räume
miteinander verbindet, würde den zentralen Aspekt der Vernetzung, den der
Enträumlichung, des Verlustes des realen Raumes, geradezu verdrehen.
24
So wird es
schwierig, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zwischen beiden Bahnen zu erkennen.
,,Die Nutzerin oder der Nutzer sitzt unbewegt an einem vernetzten Rechner, während
die ausgelösten Impulse durch das Netz flitzen."
25
Die geographische Entfernung ist in
einer virtuellen Netzwelt bedeutungslos, sie spielt eine viel geringere Rolle als die
Qualität der Transportwege. Deshalb richten sich Datenreisen anders als
Autobahnfahrten nicht nach der kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten.
21
Bühl (Anm. 7) S.25.
22
Vgl. Canzler, Helmers, Hoffmann (Anm. 10) S.13.
23
Ebd. S.12.
24
Vgl. Gates, Bill: Der Weg nach vorn. Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Hamburg 1995. S.21.
25
Canzler, Helmers, Hoffmann (Anm. 10) S.12.
8
Zwischen dem Lesen eines Hypertextes dem ,Reisen in Hypertexträumen` auf einem einzigen, lokalen
Rechner und einem solchen ,Text` auf mehreren vernetzten Rechnern besteht kein Unterschied,
vorausgesetzt, die Übertragungsgeschwindigkeiten sind in Ordnung.
26
Sogar die Verkehrsadern selbst unterscheiden sich voneinander. Bolz spricht von einer
Art Bewußtsein, die Netzwerke besäßen, da sie sich dem Verkehrsaufkommen im
Gegensatz zu Straßen anzupassen wüßten.
27
Auch Gilder und Toffler führen das Argument der Entmaterialisierung des
elektronischen Datenverkehrs an. Das Bild der Datenautobahn ist wenig hilfreich, um
den epochalen Wandel zu vermitteln:
Feste Dinge unterliegen unwandelbaren Erhaltungsgesetzen was auf der Autobahn nach Süden fährt,
muß nach Norden zurückkehren, sonst haben wir am Ende eine Autohalde in Miami. Ebenso müssen
Produktion und Konsum ausgeglichen sein. Bei der Information verhält es sich anders. Sie kann fast
ohne Kosten repliziert werden so daß theoretisch jedes Individuum den gesamten Output einer
Gesellschaft konsumieren kann.
28
Das zentrale Ereignis des 20. Jahrhunderts, der ,,Sturz der Materie"
29
ist durch den
Begriff des Datenhighways nicht adäquat erfaßt.
Statt dessen formiert sich über diese Metaphorik ein Kommunikationscode, der sich
letztendlich an der Leitunterscheidung fester und flüssiger Form von Informationen zu
orientieren hat.
30
Die preformierende und zielstrebige Highway-Metapher verschweigt
ihre Herkunft aus dem Weißen Haus nicht. Sie unterstellt dem Internet eine Ordnung,
die es wirtschaftlich interessant erscheinen läßt, da Gedanken aus dem technischen
Umfeld, wie Effizienz und Geschwindigkeit sowie Klarheit und Sicherheit der
Vorstellung von Freiheit im Cyberspace gegenüberstehen. Die Metapher des
Datenmeeres oder Cyberspace begreift das Internet als ein System eigener
Potentialität.
31
Sie ist im Folgenden zu betrachten.
26
Vgl. Canzler, Helmers, Hoffmann (Anm. 10) S.12.
27
Vgl. Bolz, Norbert: Tele! Polis! Das Designproblem des 21. Jahrhunderts. In: Stadt am Netz. Ansichten von
Telepolis. Hg. von Stefan Iglhaut u.a.. Mannheim 1996. S.148.
28
Gilder, George; Keyworth, George A.; Toffler, Alvin (u.a.): Magna Charta für das Zeitalter des Wissens. In:
Kursbuch Internet. Anschlüsse an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. Hg. von Stefan Bollmann,
Christiane Heibach. Hamburg 1998. S.111.
29
Ebd. S.104.
30
Vgl. Bickenbach, Maye (Anm. 6) S.95.
31
Vgl. Ebd. S.92.
9
2.2. Cyberspace und Datenmeer
Im Unterschied zur Metapher der Datenautobahn als primär bewegungsorientierter
Metapher handelt es sich bei der Cyberspace-Metapher um eine raumorientierte
Metapher. Der Begriff Cyberspace wurde erstmals vom Science-Fiction-Autor William
Gibson in der Erzählung Chrom brennt benutzt.
32
Bei ihm ist es eine Metapher für den
virtuellen Raum. Er beschreibt den Cyberspace als einen Ort, in den man mittels
technischer Immersion eintauchen kann, stellt diesen Vorgang als eine
Bewußtseinserweiterung mit zerstörerischer Kraft, eine psychedelische Droge dar. Eine
düstere Vision, die gleichwohl viele Personen nach ihm inspirierte. Eine Erinnerung an
die Ursprünge des Begriffes ist von Interesse, da es in der Debatte um Cyberspace und
Virtual Reality (VR) immer um Zukunftsentwürfe geht, um gesellschaftliche
Szenarien.
33
Der Begriff Cyberspace ist ein Kunstwort. Der erste Teil Cyber stammt aus dem
Griechischen und bedeutet soviel wie navigieren, steuern.
34
Der zweite Teil bedeutet auf
englisch Raum und leitet sich vom lateinischen spatium (Raum, Weite) ab.
William Gibson eröffnete in seinem Roman Neuromancer
35
nicht nur SF-Fans den
Kosmos hinter dem Bildschirm, sondern begründete zugleich den Cyberpunk, eine
literarische Bewegung in den USA der 1980er Jahre. Sie ,,einte die Präsentation einer
negativen Utopie moderner Informationsgesellschaften, eines dreidimensionalen
Menschen, welcher der Technik ausgeliefert ist und Technik als Droge konsumiert."
36
Das ,System`, bei Gibson die Herrschaft multinationaler, globaler Konzerne, dominiert
die ,einfachen Leute`. Die Systeme sind mit modernen Informationstechnologien
gekoppelt, die für die Manifestation von Herrschaft sorgen. Diese Technologien dehnen
sich auf die Menschen aus. Die Direktverbindung zwischen menschlichem Gehirn und
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, wird zur Verkörperung systemischer
Extension, der Mensch zum Bestandteil der Maschine.
Heute ist Cyberspace weitgehend zu einem Synonym für weltweite Computernetze
geworden, insbesondere für das größte, das Internet. Der Begriff wird häufig auch für
computererzeugte virtuelle Entwicklungsumgebungen benutzt.
37
32
Vgl. Gibson, William: Cyberspace. München 1994.
33
Vgl. Bühl, Achim: Cyberspace und Virtual Reality. Sozialwissenschaftlicher Forschungsbedarf. In: Forum
Wissenschaft 1/95. S.16.
34
Kybernetike = Steuermannskunst, folglich auch der Begriff Kybernetik oder im Englischen cyberbetics bzw.
cyberneticism.
35
Gibson, William: Neuromancer. München 1987.
36
Bühl (Anm. 33) S.16.
37
Vgl. Ebd. S.16.
10
Die Cyberspace-Metapher markiert damit einen fundamentalen Paradigmenwechsel in
der Informatik, eine neue Epoche in der Mensch-Maschine-Kommunikation.
Bislang bildete der Bildschirm die Grenze zwischen Anwendern und Maschine. Diese Grenze wird
nun aufgelöst. Anwender navigieren interaktiv in einem Raum hinter dem Bildschirm; ein Raum, in
dem menschliche Kommunikation und Interaktion rechnergesteuert abläuft.
38
Die zentrale Form des neuen Umgangs mit Datennetzen wird häufig als das Surfen
bezeichnet. Dadurch erscheint das Bild des Wassers, insbesondere das des Meeres. Daß
jedoch das Internet ein Datenmeer ist, wird selten wörtlich angeführt,
39
wodurch die
Wassermetaphorik im Hintergrund steht. Doch das ,im Internet surfen` scheint
allgegenwärtig zu sein, ,,die Wendung ist so modisch wie die Sportart, der sie entlehnt
ist [...]. Man surft dank Wind, Wasser und Wellen."
40
Diese Abhängigkeit verlangt dem
Benutzer wiederum Geschicklichkeit, Training und Erfahrung ab. Surfen setzt
gründliche Kenntnisse und die eingehende Beobachtung der Umgebung voraus. Es läßt
sich folgern: ,,Wer im Internet surft [...], der kennt die Materialien ebenso wie die besten
Zeiten und Tarife."
41
Die Metapher steht für eine Form des Umgangs mit Informationen, die sich deutlich von
bisher institutionalisierten Formen des Wissenserwerbs unterscheidet. ,,Surfen als
geschickten und reibungslosen, quasi spielerischen Umgang mit Daten setzt die
Flüssigkeit der Information, wie sie digitale Datenverarbeitung anbietet, voraus."
42
Den
Zusammenhang bildet hier das Element Wasser.
Die linearen Informationsflüsse der Buchdrucktechnologie können als
Bewässerungswirtschaft eines Kanalsystems verstanden werden. Die Information fließt
nur in eine Richtung von einer Quelle zum Auffangbecken namens Lesern oder
Bibliotheken.
43
Beim Internet liegt hingegen der Vergleich zum Meer nahe. Das Denken
ist von der weltumspannenden Ausdehnung und der unergründlichen Tiefe des Meeres
geprägt. Dabei handelt es sich hier um eine sekundäre Metaphorisierung, die nicht
38
Bühl (Anm. 7) S.30.
39
Vgl. Bickenbach, Maye (Anm. 6) S.86.
40
Hörisch (Anm. 8) S.529.
41
Bickenbach, Maye (Anm. 6) S.86.
42
Ebd. S.86.
43
Vgl. Giesecke, Michael: Der Buchdruck der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt/Main 1991. S.157f.
11
einfach das Meer als Metapher aufgreift, sondern die Metapher vom Meer als einem
Möglichkeitsraum.
44
Hier entsteht die unmittelbare Analogie zum Bild des Cyberspace als ungreifbaren
virtuellen Raum, in dem man alles oder nichts finden kann. Es ist ein Raum, der
Orientierungskunst erfordert, ein Vorgang, der mit der nautischen Operation der
Navigation als einer auf Technik und Erfahrung gleichermaßen rekurrierenden Kunst
der Orientierung im unübersichtlichen und grenzenlosen Medium
45
umschrieben wird.
Navigieren bedeutet, daß in computergenerierten Erlebnisräumen Bewegungs- und
Rotationsfunktionen realisiert sind. Mehr noch: ,,Im Cyberspace können physische
Erfahrungen gemacht werden, die in realen Umgebungen so ohne weiteres nicht
erlebbar sind."
46
Es geht um ein Eintauchen in eine virtuelle Umgebung, wodurch, im
Gegensatz zur Datenautobahn-Metapher, ein wesentliches Phänomen des aktuellen
Prozesses erfaßt wird: Die Doppelung der Wirklichkeit in reale und virtuelle Realität
sowie die sich aus der Doppelungsstruktur ergebenden sozialen, kulturellen und
subjektbezogenen Konsequenzen.
47
Ein weiter gefaßtes Verständnis des Cyberspace präsentieren die Autoren der Magna
Charta für das Zeitalter des Wissens. Sie heben den Cyberspace aus der Umgebung des
Computers heraus, indem sie ihn als eine bioelektronische Umwelt, die buchstäblich
universal ist, beschreiben. ,,Es gibt sie überall, wo Telefonleitungen, Koaxialkabel,
Glasfaserleitungen oder elektromagnetische Wellen vorhanden sind. Diese Umwelt wird
von Wissen ,bewohnt`, das in elektronischer Form existiert."
48
Das Wissen ist mit der
physischen Umwelt durch Tore verbunden, die es den Menschen erlaubt, nachzusehen,
was sich im Inneren befindet. Es gibt die Unterscheidung zwischen Toren, die nur in
einer Richtung passierbar sind, wie etwa Fernsehgeräte, und solchen, die in zwei
Richtungen durchlässig sind, etwa Telefone oder Computer-Modems. Die
Digitalisierung von Daten kommt dort ins Spiel, wo Menschen das Wissen, welches
meistens nur kurzfristig im Cyberspace existent ist, über längere Zeit speichern wollen.
Eine sicherlich fragwürdige Annäherung an das Verständnis des Cyberspace, die sich
eher mit den Vorstellungen McLuhans von einer durch Elektrizität vernetzten Welt
einen läßt.
44
Vgl. Bickenbach, Maye (Anm. 6) S.87.
45
Vgl. Ebd. S.89.
46
Bühl (Anm. 7) S.30.
47
Vgl. Ebd. S.31.
48
Gilder, Keyworth, Toffler (Anm. 28) S.107.
12
2.3. Digitale Stadt
Die Metapher der digitalen Stadt oder Telepolis betont, daß dezentrale Datennetze wie
etwa das Internet in ihrer Komplexität urbanen Systemen vergleichbar sind. Die
Verdichtung von Informationen innerhalb der dauerhaften Bauwerke einer Stadt, die
den ,menschlichen Verkehr` beschleunigt, ist dabei ein zentraler Aspekt
49
In Analogie
dazu steht das Ziel der Informationsgesellschaft, durch Computerumgebungen, die
immer komplexer werden, letztendlich überall erreichbar zu sein. Der Zwang wird
größer, ans Netz angeschlossen zu sein, um schneller erreicht werden zu können, um mit
anderen zu kommunizieren, Daten gleich welcher Art zu senden oder Zugriff auf
aktuelle Informationen zu haben.
50
Das Vorbild sind die räumlichen Strukturen der
Städte als zentrale Knoten in einer territorial verankerten gesellschaftlichen Hierarchie.
Sie gewährleisten die schnelle Kommunikation und Interaktion von möglichst
komplexen, ausdifferenzierten und hochgradig vernetzten Systemen, die
ineinandergreifen.
51
Die Telepolis wird aus Daten gebaut und damit zu einer digital
erzeugten und virtuellen Informationsumwelt. In ihr läßt sich vieles machen und
erfahren, wozu man bislang die gebaute Kommunikations- und Interaktionsumwelt der
Städte benötigte.
52
Es war üblich, urbane Räume als soziale Netze zu betrachten. Jetzt
gibt es gute Gründe, den Vergleich umzukehren und elektronische Netze als urbane
Sammelpunkte zu analysieren.
53
Für diese neue Ausrichtung des Vergleiches sprechen zahlreiche elektronische Projekte,
die ihre Inspiration durch die Stadtmetapher in der Namensgebung zum Ausdruck
bringen. Internet Cities wie beispielsweise das Amsterdamer Projekt De Digitale Stad
54
stellen nicht nur den Bezug zwischen dem Internet und einer realen Stadt her, sondern
bieten als symbolische Städte im elektronischen Raum vielfältige neuartige
Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten.
Historisch-soziologisch betrachtet erscheint Blank das Leben einer Ansiedlung um so
städtischer zu sein, je stärker die Polarität und die Wechselbeziehung zwischen
öffentlicher und privater Sphäre ausgeprägt ist.
55
Er überträgt die Beschreibung der
49
Vgl. Rötzer (Anm. 2). S.14.
50
Vgl. Ebd. S.41.
51
Vgl. Ebd. S.55.
52
Vgl. Ebd. S.42.
53
Vgl. Bühl (Anm. 7) S.31.
54
Vgl. Fuchs, Kurt; Purgathofer, Peter: Die digitale Stadt. Demokratische Potenzen eines alternativen Projekts. In:
Forum Wissenschaft 2/1995. S.70f.
55
Vgl. Blank, Joachim: Die Städtemetapher im Datennetz. Elektronischer Text. Quelle: http://www.hgb-
leipzig.de/theorie/stadtmetapher/htm (Stand 20.08.01)
13
Stadt als Ort der Polarisierungstendenzen von Öffentlichkeit und Privatsphäre auch auf
Datennetze. Im Unterschied zu urbanen Städten dehnen sich die Internet Cities räumlich
jedoch nicht aus, da ihre Grenzen allein im Bereich der Netzwerkressourcen liegen.
Rötzer betont ebenfalls diese Tendenz zur Enträumlichung der Telepolis. Er sieht die
elektronische Stadt überall und nirgends.
56
Der Eintritt in die Telepolis ist an einen
partiellen Austritt aus dem wirklichen Raum gebunden. ,,Die Menschen werden sich
immer stärker mit der paradoxen Situation konfrontiert sehen, an zwei Orten
gleichzeitig anwesend zu sein: an dem Ort, wo sich der Körper befindet, und an jenem
virtuellen Ort, an dem man im Netz präsent ist."
57
Für die Vertreter stadtorientierter Metaphern stellen Internet Cities wie die Digitale Stad
in Amsterdam einen öffentlichen Raum dar, der für alle zugänglich sein sollte. Zugänge
müssen kostenlos oder doch zumindest kostengünstig sein. Zwischen kommerziellen
Interessen und dem Recht der Bürger auf informelle Grundversorgung muß eine klare
Grenze gezogen werden.
58
Die Stadtmetapher wird also mit dem Aspekt der
öffentlichen Versorgung in Zusammenhang gebracht.
Wird diese Grundversorgung gewährleistet, so eine nicht seltene Position der
Protagonisten der Stadt-Metapher, lassen computergestützte Netze die Funktion der
realen Städte als Netzwerke für schnelle Kommunikation erodieren. Der Cyberspace ist
ein virtueller Raum, in den viele Funktionen abwandern, die einst urbane
Ballungszentren erforderten.
Diese totale Programmierung der Umwelt beendet das romantische Kapitel ,Natur`. [...] Deshalb kann
man schon heute sagen: Die Materialien der neuen Architektur sind eigentlich ,Immaterialien`. An
ihrem Horizont erscheint die kybernetische Stadt, die von einer Feedback-Architektur organisiert
wird.
59
Dabei spielt der einnehmende Charakter virtueller Orte, deren Nutzung eine
Ausblendung der Nahumgebung erfordert, eine wichtige Rolle.
60
Die Tele-Existenz im
Cyberspace benötigt einen hohen Grad der Aufmerksamkeit und kann gleichzeitig auf
räumliche Verdichtung verzichten. Der Schluß lautet:
56
Vgl. Rötzer (Anm. 2) S.42.
57
Ebd. S.42.
58
Vgl. Blank (Anm. 55)
59
Bolz (Anm. 27) S.146.
60
Vgl. Rötzer (Anm. 2) S.42.
14
Je zügiger innerhalb der Städte der Ausbau des Datenhighways erfolgt und je mehr Arbeits- und
Freizeittätigkeiten in diesen abwandern, desto größer wird der Trend zur Dezentralisierung. Die Städte
als Pioniere der Netze untergraben mit deren Ausbau ihre eigene [...] Existenzberechtigung.
61
Die Stärken der Metapher liegen vor allem in der Beachtung der Konsequenzen einer
funktionalen Abwanderung für den geographischen und architektonischen Raum. Es
handelt sich um eine vielfältige Analyse des Ineinandergreifens, der Übergänge,
Koppelungen und Brüche, die sich zwischen dem realen und dem virtuellen Raum
ergeben.
62
Idealisierte Vorstellungen, wie die Forderung nach dem Recht auf informelle
Grundversorgung, verdeutlichen jedoch die Kurzsichtigkeit der Metapher. Die Analogie
zur Stadt vernachlässigt gesamtgesellschaftliche und globale Aspekte des Internet.
Ökonomische Macht- und Herrschaftsverhältnisse werden in Analysen des
Kurzschlusses zwischen realem und virtuellem Raum zwar nicht gänzlich übersehen.
Sie spielen in den Gedanken über eine Errichtung der Telepolis aber keine zentrale
Rolle. Das bringt die Stadtmetapher in die Nähe der Vorstellungen des globalen Dorfes.
2.4. Globales Dorf
Im Vordergrund des Sinnbildes vom globalen Dorf stehen die Veränderungen der
sozialen Beziehungen im Zeitalter moderner Massenmedien. Die Vision des global
village stammt von Marshall McLuhan
63
, der sie bereits im Jahr 1967, längst vor der
Existenz des World Wide Web, formulierte. ,,Wir leben in einer brandneuen Welt der
Gleichzeitigkeit. Die Zeit hat aufgehört, der Raum ist dahingeschwunden. Wir leben
heute in einem globalen Dorf, in einem gleichzeitigen Happening."
64
Die elektronische
Schaltungstechnik, so McLuhan, verstricke die Menschen tief ineinander, die
elektronische Interdependenz forme die Welt zu einem globalen Dorf um.
Der Begrifflichkeit des Wortes village können zwei Bedeutungsinhalte zukommen. Im
engeren Sinne wird das Bild mit einem ,kleinen Raum` oder ,Nähe` in Verbindung
gebracht. McLuhan suggeriert mit seiner Metapher, daß durch die Entwicklung
moderner elektronischer Medien Ereignisse, auch wenn sie noch so weit voneinander
entfernt stattfinden, erlebt werden, als ob sie sich in der Nachbarschaft befänden.
In einem weiteren Sinne bedeutet village soviel wie ,Gemeinschaft`.
61
Rötzer (Anm. 2) S 14.
62
Vgl. Bühl (Anm. 7) S.33.
63
Siehe: 3.1. Marshall McLuhan.
64
McLuhan, Marshall; Fiore, Quentin: Das Medium ist Massage. Frankfurt/Main 1969 und 1984. S.63.
15
McLuhan: Elektrisch zusammengezogen ist die Welt nun mehr ein Dorf. Die elektrische
Geschwindigkeit, mit der alle sozialen und politischen Funktionen in einer plötzlichen Implosion
koordiniert werden, hat die Verantwortung des Menschen in erhöhtem Maß bewußt werden lassen.
Dieser Faktor der Implosion ist es, der die Lage der Schwarzen, der Teenager und einiger anderer
Gruppen verändert. Sie lassen sich nicht mehr zurückhalten im Sinne begrenzter Einbeziehung in die
Gemeinschaft. Sie sind jetzt dank der elektrischen Medien in unser Leben miteinbezogen wie wir in
das ihre.
65
Die elektronische Schaltungstechnik, so McLuhan, überschütte uns sekundenschnell
und in einem fort mit den Angelegenheiten aller anderen Menschen. Sie habe den
Dialog im globalen Maßstab wieder ermöglicht.
66
Diese idealistische Sichtweise ist einer der entscheidenden Gründe der erneuten
Popularität des Mediensoziologen im Kontext des Internet. Es scheint McLuhans
Gedanken einer globalen Gemeinschaft zu stützen. Viele Enthusiasten des Internet sind
mit dem Glauben angetreten, eine Gemeinschaft auf integrierter Basis mit geteilter
Verantwortung zu etablieren.
Im Zusammenhang einer wachsenden Kommerzialisierung des Internet wächst die
Kritik an der Metapher des globalen Dorfes. Macht- und Herrschaftsverhältnisse in
internationalen Netzen bleiben unterbelichtet. Das Bild des Dorfes verfliegt angesichts
des Regionalismus, Separatismus und lokaler Konflikte.
67
Anstelle der Vorstellung von
gleichberechtigten Weltbürgern tritt die Frage nach den wahren Besitzern des Global
Village. Es werden bevorzugt diejenigen sein, welche die immensen Möglichkeiten der
Vernetzung voll ausnutzen können. Vor allem die kapitalkräftigsten Anbieter und
Nachfrager profitieren von der fast schrankenlosen Ausdehnung und Verflechtung der
Märkte für viele Dienstleistungen. Der Einsatz von Telekommunikation fördert ein
weiteres Mal regionale Unterschiede und bedroht die lokalen wirtschaftlichen
Beziehungen weit stärker als bisher.
68
Einer blinden Technologiebegeisterung, in deren
Mittelpunkt ein wertfreier Glaube an den Fortschritt steht, tritt Pessimismus entgegen.
Er verdammt die technische Entwicklung als eine weitere Form sozialer, politischer und
65
McLuhan, Marshall: Die magischen Kanäle. Understanding Media. Dresden, Basel 1995. S.17.
66
Vgl. McLuhan, Fiore (Anm. 64) S.16.
67
Vgl. Kerckhove, Derrick de: Jenseits des Globalen Dorfes. 1996. Elektronischer Text. Quelle:
http://www.heise.de/tp/deutsch/html/result.xhtml?url=/tp/deutsch/inhalt/te/1073/2.htmlwords=globales%20DORF
(Stand: 31.07.01)
68
Vgl. Nahrada, Franz: Globales Dorf oder Globale Stadt? 1996. Elektronischer Text. Quelle:
http://www.heise.de/tp/deutsch/html/result.xhtml?url=/tp/deutsch/special/sam/6010/3.htmlwords=globales%20DORF
(Stand: 31.07.01)
16
letzten Endes psychologischer Kolonialisierung der Informationsärmeren durch
diejenigen, die einen Informationsvorsprung besitzen. Die Kritiker, die den Gedanken
an ein Dorf mit Frieden und Harmonie verbinden, verdrießt die Vorstellung, die Welt
könne sich selbständig erfolgreich um ihr eigenes Gleichgewicht bemühen.
Kerckhove setzt entgegen, daß die Vorstellung des Globalen Dorfes nur die
bedeutungsvolle Verallgemeinerung meint. Durch diese finden oder schaffen wir alle
eine sinnvolle Ordnung in verschiedenartigen Beispielen und Handlungen menschlicher
Sinnstiftung und Kommunikation.
Genauso wie die Stadt nicht auf der Grundlage einheitlichen Handelns, sondern aufgrund ihrer Lage
zu einer Einheit wird, so ist mit dem Begriff des ,globalen Dorfes` zum ersten Mal die Erdkugel als
Kommunikationsgemeinschaft bezeichnet worden. Darin erscheint die Ansicht des Planeten aus dem
Raum und die Regionen der Erde auf dem Fernsehschirm, so daß gleichzeitig die Vorstellung der
,Globalität` und die eines ,Dorfes` vermittelt wird.
69
In einem Dorf herrscht weniger Bewegungsfreiheit als in der Stadt oder auf dem Land.
Es ist die Vorstellung, daß Kommunikation einer erzwungenen Beziehung unterliegt.
Menschliche Gemeinschaften, deren Erfahrungen im sozialen Zusammenleben auf weit
entfernten Ebenen liegen, werden ohne das nötige Training in sozialem oder
gesellschaftskonformem Verhalten konfrontiert. ,,Je bewußter wir uns der globalen
Zusammenhänge werden, desto eifriger sind wir dabei, unsere regionale Identität zu
wahren daher das paradoxe am globalen Dorf."
70
2.5. Virtuelle Gemeinschaft
Die Metapher der virtuellen Gemeinschaft (,virtual community`) wurde hauptsächlich
von Howard Rheingold geprägt. Er stellt in seiner Studie Virtuelle Gemeinschaft.
Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers die Menschen als die eigentlichen
Träger der modernen Kommunikationstechnologien in den Vordergrund. Rheingold
versucht nachzuweisen, daß die computervermittelte Kommunikation (CMC, ,computer
mediated communication`) virtuelle Gemeinschaften konstruiert, die sich durch enge,
vielfältige Kultur auszeichnen. ,,In virtuellen Gemeinschaften (VG) versammelte
Menschen tun fast alles, was Menschen im wirklichen Leben auch tun, aber sie sparen
69
Kerckhove (Anm. 67)
70
Ebd.
17
ihre Körper aus [...]. Trotz dieser Beschränkung kann eine Menge passieren."
71
So
verknüpfen sich die über CMC gebildeten virtuellen Gemeinschaften zu einem
engmaschigen Netz.
Eine virtuelle Gemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die miteinander kommunizieren, die sich
zu einem gewissen Grad untereinander kennen, in gewissem Maß Wissen und Information teilen und
sich zu einer gewissen Grenze als menschliche Wesen umeinander kümmern, sich treffen und in erster
Linie über Computernetzwerke miteinander kommunizieren.
72
Rheingold sieht in ihnen ein Entstehungspotential für wirkliche Gemeinschaften. Er
grenzt sie aber auch von reinen Interessengemeinschaften, deren vornehmliches Ziel es
ist, nur Informationen auszutauschen, ab. Beide Formen zählt er zum Gesamtspektrum.
Da solche Gemeinschaften in den letzten Jahren durch die Existenz globaler Netze
explosionsartig gewachsen sind, entstand über das Internet eine neue Art von Kultur.
.
Das Netz ist ein nicht näher definierter Begriff, um die lose miteinander verbundenen Computernetze
zu bezeichnen, welche die CMC-Technologie verwenden, um Menschen auf der ganzen Welt zu
öffentlichen Diskussionsrunden zusammenzuschließen. Virtuelle Gemeinschaften sind soziale
Zusammenschlüsse, die im Netz entstehen, wenn genug Leute diese öffentliche Diskussionen lange
genug führen und dabei ihre Gefühle einbringen, so daß im Cyberspace ein Geflecht persönlicher
Beziehungen entsteht.
73
Der Cyberspace ist für Rheingold ein imaginärer Raum, in dem sich für die Menschen,
welche die CMC-Technologie nutzen, Wörter, zwischenmenschliche Beziehungen,
Daten, Reichtum und Macht manifestieren.
74
Er stellt sich den Cyberspace bildhaft als
eine Art elektronischer Agora
75
vor. Das Internet dient als Nährboden, auf dem virtuelle
Gemeinschaften als Kolonien gedeihen. Das geschieht auf der Basis einer
Verwirklichung direkter Demokratie in allen gesellschaftlichen Institutionen. ,,Jede
dieser kleinen Kolonien von Mikroorganismen die Gemeinschaft im Netz stellt ein
soziales Experiment dar, das niemand geplant hat, das aber dennoch stattfindet."
76
71
Rheingold, Howard: Virtuelle Gemeinschaft. Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers. Bonn/Paris 1994.
S.14.
72
Rheingold, Howard: Lernen, damit umzugehen. In: Kursbuch Internet. Anschlüsse an Wirtschaft und Politik,
Wissenschaft und Kultur. Hg. von Stefan Bollmann, Christiane Heibach. Hamburg 1998. S.271.
73
Rheingold (Anm. 71) S.16.
74
Vgl. Ebd. S.16/17.
75
Siehe: 4.2.1. Die virtuelle Klasse
76
Rheingold (Anm.71) S.17.
18
Menschen die Zugang zu CMC-Technologien erhalten, gründen, so Rheingold,
unweigerlich virtuelle Gemeinschaften.
Anderen Autoren zufolge liegt die Bedeutung virtueller Gemeinschaften vor allem im
Bewußtsein des Verlustes sozialer Gemeinsamkeiten. Sie konstituieren im virtuellen
Raum Gemeinschaften neu, die im realen Raum verlorengegangen sind. Auf diese
Weise wird der soziale Verlust kompensiert.
Entgegen den ursprünglichen militärischen Absichten verwendet man, so Rheingold, die
Kommunikationseigenschaften der Netze heute dazu, mit Computerkonferenzen über
die Grenzen von Raum und Zeit hinweg soziale Beziehungen herzustellen. Virtuelle
Gemeinschaften beruhen im Unterschied zu natürlichen Gemeinschaften nicht auf
verwandtschaftlichen Verhältnissen oder räumlicher Nachbarschaft, sondern allein auf
gemeinsamen Interessen im Netz. Die Netze verfügen über ein großes
Kommunikationspotential, das Menschen über nationale und ideologische Grenzen
hinweg miteinander verbindet.
Die Stärken dieser Metapher liegen in der Schilderung globaler sowie
subjektorientierter Prozesse. Autoren, die sich dieses Sinnbildes bedienen, gehen von
Rückkopplungen aus, die vom Cyberspace in den realen Raum geschehen. Turkle
beispielsweise räumt der Computertechnologie ein, nicht nur ein Mittel zur Erledigung
von Aufgaben zu sein, sondern auch ein Medium zum Durchdenken und Durcharbeiten
von persönlichen Angelegenheiten. Der vernetzte Computer nimmt die Funktion eines
evokativen Objektes an, was die Einstellung gegenüber Gemeinschaften angeht.
,,Virtuelle Realität ist nicht ,real`, aber sie steht in Beziehung zum Realen. Da sie
irgendwo zwischendrin liegt, wird sie zu einem Spielplatz, um über die wirkliche Welt
nachzudenken. Sie ist ein exemplarisches, evokatives Objekt."
77
77
Turkle, Sherry: Identität in virtueller Realität. Multi-User Dungeons als Identity Workshops. In: Kursbuch Internet.
Anschlüsse an Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. Hg. von Stefan Bollmann, Christiane Heibach.
Hamburg 1998. S.323.
19
Zusammenfassung
Die Metapher der Datenautobahn ist eine Geschwindigkeitsmetapher. Sie verspricht
einem neu entstehenden Netzwerk Attraktivität durch Leistungsfähigkeit. Mit ihr
geht technischer Reduktionismus einher, der das Ziel der Akzeptanzbeschaffung
verfolgt und die Kommerzialisierung der Netze nahelegt. Das Bild der
Datenautobahn erfaßt weder die Virtualisierung, noch verdeutlicht dessen Analogie
zur Verbindung zwischen mehreren Orten die entstehende Enträumlichung und
Aufhebung der Entfernungen durch digitale Datennetze.
Der Cyberspace ist eine raumorientierte Metapher. Das Bild beschreibt die
qualitativ neue Schnittstelle in der Mensch-Maschine-Kommunikation, die erstmals
ein Eintauchen in virtuelle Welten ermöglicht. Dadurch werden die Verdoppelung
der Realität in reale und virtuelle Realität und die sich daraus ergebenden Gefahren
thematisiert. Der sinnvolle Umgang mit den vorhandenen Daten im Cyberspace
erfordert die Navigationskunst, da die Vorstellung von einer fluiden Form derselben
ausgeht. Das Datenmeer wird durch Surfen als Fortbewegung erschlossen. Durch
ihren historischen Ursprung aus der Cyberpunk-Literatur tendiert die Metapher
dazu, lediglich die Gefahren der kommunikationstechnologischen Entwicklung
darzustellen und die Chancen auszublenden.
Die Metapher der digitalen Stadt oder Telepolis geht von der Vorstellung aus,
Computernetzwerke erodieren die Funktion der Städte. Sie eröffnen einen
Lebensraum, in dem viele Funktionen der urbanen Umgebung abwandern. Es
entsteht eine virtuelle Stadt in den Netzen, die sich nicht durch Konzentration,
sondern durch Dezentralisation auszeichnet. Die Metapher weist dabei auf
vielfältige raumsoziologisch, architektonisch und kulturell relevante Aspekte hin.
Gesamtgesellschaftliche, ökonomische und globale Aspekte bleiben weitgehend
unberücksichtigt. Das kommt durch idealisierte Forderungen, wie der nach der
Gewährleistung informeller Grundversorgung zum Ausdruck.
Elektronische Abhängigkeitsbeziehungen verwandeln die Welt in ein globales Dorf.
Durch die elektronischen Schaltungstechniken wird der Dialog im globalen Maßstab
ermöglicht. Die Metapher verläßt die Ebene des Nationalstaates und betont globale
Auswirkungen der Vernetzung. Dadurch werden diverse Globalisierungsaspekte in
die Debatte mit eingebracht und globale Abhängigkeiten betont. Die Macht- und
Herrschaftsverhältnisse der Netze bleiben unberücksichtigt, wodurch das Bild vom
globalen Dorf die Komplexität der Welt idealistisch zu verkürzen droht.
20
Die Metapher der virtuellen Gemeinschaft rückt die kommunikativen Potenzen des
Prozesses für die Gestaltung sozialer Gemeinschaften in weltweiten Datennetzen in
den Vordergrund. Diese haben sich weitgehend von ihren geographischen
Voraussetzungen befreit. Virtuelle Gemeinschaften im Netz realisieren die
Möglichkeit von Sozialität unter Abstraktion von körperlicher Anwesenheit. Die
Metapher geht von Rückkopplungen aus, die vom Cyberspace in den realen Raum
geschehen, übersieht aber die Umkehrung des Prozesses. Sie impliziert die
idealisierte Vorstellung vom Internet als elektronische Agora.
21
3. Allgemeine Medientheorien zur medialen Vernetzung
Industrie, Universitäten, Behörden und Institutionen investieren erhebliche Summen,
um auf dem neuen Feld des Internet dabei zu sein. Der neuen Technik werden Chancen
und faszinierende Möglichkeiten für die Zukunft eingeräumt. Wo die Rechner nun auch
noch Kontakt miteinander aufnehmen, steht fest: ,,Es handelt sich um ein Medium. Nach
dem Muster des Telefonnetzes und der Fernsehdistribution werden die Computer unter
die ,Kommunikationsmittel` eingereiht."
78
Damit findet ein Perspektivenwechsel der
Vorstellungen über den Rechner statt, die ehemals von einer Denkmaschine oder einem
Werkzeug ausgingen.
Die Informatik war darauf genauso schlecht vorbereitet wie die Medientheorie, welche
die Rechner lange Zeit den Spezialisten überlassen hatte. Die Computer selbst sind mit
der Vernetzung zu einer globalen Infrastruktur zusammengewachsen, deren Betrachtung
immer notwendiger erscheint.
Winkler bringt den Begriff der Docuverse in die Diskussion, der die Tatsache festhält,
,,daß ein Universum der maschinenlesbaren Dokumente, Programme und Projekte
entstanden ist, das technisch, gesellschaftlich und institutionell eigenen Regeln und
eigenen medialen Gesetzmäßigkeiten folgt."
79
Er stützt sich dabei auf Theodor Nelson,
der diesen Begriff in Bezug auf Literatur als ein ,,ongoing system of interconnecting
documents"
80
prägte. Das Datenuniversum sah er entsprechend als eine neue Art und
Weise an, Dokumente in Relation zueinander zu bringen.
Am Anfang einer Beschreibung der neuen Medien-Anordnung steht die Frage nach der
Motivation, die eine so grundsätzliche Innovation, einen so grundsätzlichen Umbau der
Medienlandschaft überhaupt vorantrieb.
81
Winkler outet das neue Medium, eine
veritable Wunschmaschine zu sein
82
, da der konkrete Output langer Datenreisen im Netz
noch weit hinter den Aufwendungen zurückliegt, um den Zutritt zu dem neuen
Universum zu erhalten.
Die grundlegende Annahme geht also davon aus, ,,daß die Dynamik der
Medienentwicklung in bestimmten Wunschstrukturen ihre Ursache hat, und daß die
Mediengeschichte beschreibbare Sets impliziter Utopien verfolgt."
83
Der gesamte
Umbruch hin zum Datenuniversum ist auf eine einzige Wunschstruktur zurückzuführen.
78
Winkler, Hartmut: Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. Hamburg 1997. S.9.
79
Ebd. S. 9/10.
80
Nelson, Theodor H.: Literary Machines. South Bend 1987. S.2 und 9.
81
Vgl. Winkler (Anm. 78) S.10.
82
Vgl. Ebd. S.11
83
Ebd. S.17.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832453527
- ISBN (Paperback)
- 9783838653525
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Philipps-Universität Marburg – Germanistik und Kunstwissenschaften
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- theoriediskussion erzählgenres erzählpraktiken arpanet netzdiskurs
- Produktsicherheit
- Diplom.de