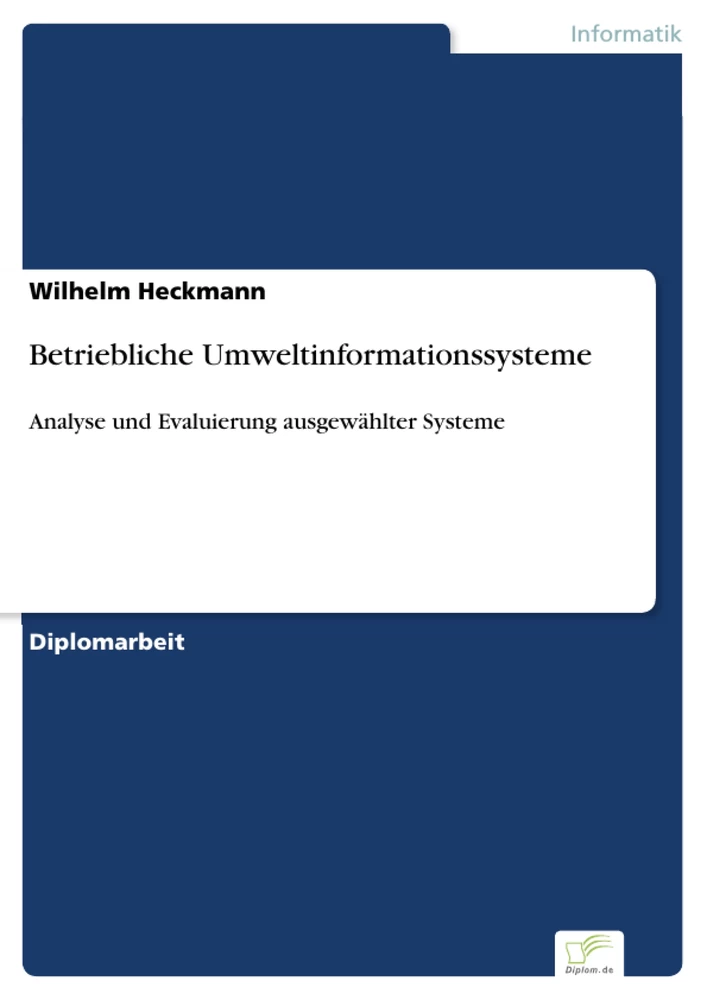Betriebliche Umweltinformationssysteme
Analyse und Evaluierung ausgewählter Systeme
Zusammenfassung
Ökologische Fragestellungen haben in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine hohe Bedeutung erlangt. Umweltgerechte Produktion, Logistik, Recycling und Entsorgung werden in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt des Interesses gelangen. Unternehmen erkennen, dass die Orientierung der Unternehmensziele und -politik an ökologischen Erfordernissen nicht nur kostspielige Konsequenzen mit sich bringt, sondern auch zu Wettbewerbsvorteilen führen kann. Ein wichtiger Baustein dazu ist die Unterstützung durch Betriebliche Umweltinformationssysteme.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Einsatzmöglichkeiten von Betrieblichen Umweltinformationssystemen im Umweltmanagement aufzuzeigen. Dabei wird aber auch versucht die Berührungspunkte zwischen Informationsmanagement und Informatik auf der einen Seite und Umweltschutz und Umweltmanagement auf der anderen Seite, darzustellen.
Gang der Untersuchung:
Die Arbeit beschäftigt sich in den ersten beiden Kapiteln mit dem wesentlichen Faktor der Umweltinformation und den Möglichkeiten, die die Umweltinformatik zur Beschaffung, Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen geschaffen hat.
Schwerpunkt des Kapitel 3 ist die Charakterisierung von Betrieblichen Umweltinformationssystemen. Die Abgrenzung zu anderen Informationssystemen, die Darstellung der verschiedenen Funktionen und Modelle, die Ansprüche des Umweltmanagements an Betriebliche Umweltinformationssysteme und die Einsatzmöglichkeiten sowohl im strategischen als auch im operativen Umweltmanagement sind die wichtigsten Elemente dieses Kapitels.
In Kapitel 4 werden die Aspekte, die bei der Einführung von Betrieblichen Umweltinformationssystemen beachtet werden sollten, dargestellt. Dies beginnt bei der Grobplanung und endet bei der Produktauswahl und der Installation.
Die letzten beiden Kapitel widmen sich den bereits am Markt verfügbaren Systemen. Kapitel 5 gibt einen Überblick über den deutschsprachigen Umweltsoftwaremarkt. Kapitel 6 zeigt eine vom Autor durchgeführte Evaluierung von neun verschiedenen Betrieblichen Umweltinformationssystemen, vor allem hinsichtlich Funktionalität und Ergonomie.
Die evaluierten Produkte kommen aus den drei Bereichen: Abfallwirtschaftssysteme, Ökobilanzsysteme, Öko-Audit-Systeme.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
EINLEITUNG6
1.DIE BEDEUTUNG VON INFORMATION FÜR DAS UMWELTMANAGEMENT8
1.1DEFINITION UND ABGRENZUNG DER BEGRIFFE9
1.1.1Information und Daten9
1.1.2Informatik und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Die Bedeutung von information für das umweltmanagement
1.1 Definition und Abgrenzung der Begriffe
1.1.1 Information und Daten
1.1.2 Informatik und Informationssystem
1.1.3 Informationsmanagement
1.2 Information als zentraler Punkt im Umweltmanagement
1.2.1 Informationen für das Unternehmen selbst
1.2.2 Informationen für das Unternehmensumfeld
1.3 Umweltschutzbezogene Erweiterung des betrieblichen Informationsmanagements
1.3.1 Management des Informationsbedarfs
1.3.2 Gestaltung des organisatorischen Rahmens
1.3.3 Management der Informationstechniken
2 umweltinformatik - ein wesentliches instrument zur lösung von umweltproblemen
2.1 Grundsätzliche Aufgaben der Umweltinformatik
2.1.1 Die Beschaffung von umweltrelevanten Daten
2.1.2 Die Auswertung und Analyse umweltrelevanter Daten
2.1.3 Die Synthese zur umweltorientierten Maßnahmenplanung
2.2 Beschreibung der verschiedenen Teilgebiete der Umweltinformatik
2.2.1 Umweltmonitoringsysteme zur Beobachtung der Umwelt
2.2.2 Die Entwicklung von Umweltdatenbanken
2.2.3 Modellbildung und Simulation im Umweltbereich
2.2.4 Expertensysteme für komplexe Aufgabenstellungen aus dem Umweltbereich
2.2.5 Umweltinformationssysteme zur Verarbeitung von betrieblichen und überbetrieblichen Umwelt-daten
2.3 Beitrag der Umweltinformatik zur Lösung von Umweltproblemen
3 charakterisierung von betrieblichen umweltinformationssystemen
3.1 Allgemeines zu Betrieblichen Umweltinformationssystemen
3.2 Abgrenzung von BUIS zu anderen Informationssystemen
3.3 Unterschiedliche Anspr-che des Umweltmanagements an ein BUIS
3.3.1 BUIS als Dokumentationssystem
3.3.2 BUIS als Entscheidungsunterst-tzungssystem
3.3.3 BUIS als Expertensystem
3.3.4 Zusammenfassung weiterer Anforderungen
3.4 Funktions- und Architekturkonzepte von BUIS
3.4.1 Funktionale Aspekte von BUIS
3.4.2 Architektur- und Integrationskonzepte von BUIS
3.5 Die Bedeutung von BUIS für das Umweltmanagement
3.5.1 Die Stellung von BUIS im Umweltmanagement
3.5.2 Einsatzmöglichkeiten im strategischen Umweltmanagement
3.5.3 Einsatzmöglichkeiten im operativen Umweltmanagement
3.6 Risiken und Chancen beim Einsatz von BUIS
4 schwerpunkte bei der einf-hrung von buis
4.1 Systematisches Vorgehen als wesentlicher Erfolgsfaktor
4.2 Grobplanung
4.3 Soll- und Istzustandsanalyse
4.3.1 Sollzustandsanalyse
4.3.2 Istzustandsanalyse
4.4 Bedarfsplanung und Systemspezifikation
4.4.1 Integrierte versus nicht integrierte Systeme
4.4.2 Standardsoftware versus Individualsoftware
4.4.3 Beschreibung der Anforderungen an ein BUIS in einem Pflichtenheft
4.5 Produktauswahl und Installation
5 analyse des deutschsprachigen umweltsoftwaremarktes
5.1 Kurzbeschreibung der allgemeinen Marktsituation
5.1.1 Gegenüberstellung der Anbieter und Nachfrager
5.1.2 Das Marktvolumen und die Marktentwicklung
5.2 Überblick über die am deutschsprachigem Markt angebotene Umwelt-Software
5.3 Analyse der angebotenen Betrieblichen Umweltinformationssysteme
5.3.1 Abfallwirtschaftssoftware
5.3.2 Ökobilanzierung- und Öko-Controlling-Systeme
5.3.3 Öko-Audit-Systeme
5.3.4 Andere angebotene Systeme
6 evaluierung ausgewählter betrieblicher umweltinformationssysteme
6.1 Allgemeine Beschreibung der Vorgehensweise
6.1.1 Ziele der Evaluierung
6.1.2 Der Testplan und die Auswahl der Testprodukte
6.1.3 Eingesetzte Methoden und Techniken
6.1.4 Eingesetzte Infrastruktur
6.2 Der Kriterienkatalog
6.2.1 Allgemeine Kriterien
6.2.2 Qualitätsorientierte Kriterien
6.2.3 Kostenorientierte Kriterien
6.3 Evaluierung
6.3.1 Abfallwirtschaftssysteme
6.3.2 Ökobilanzierungs- und Öko-Controllingsysteme
6.3.3 Öko-Audit-Systeme
6.4 Schlußfolgerungen und Empfehlungen
abbildungsverzeichnis
literaturverzeichnis
Einleitung
Ökologische Fragestellungen haben in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine hohe Bedeutung erlangt. Umweltgerechte Produktion, Logistik, Recycling und Entsorgung werden in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt des Interesses gelangen. Unternehmen erkennen, daß die Orientierung der Unternehmensziele und -politik an ökologischen Erfordernissen nicht nur kostspielige Konsequenzen mit sich bringt, sondern auch zu Wettbewerbsvorteilen führen kann. Ein wichtiger Baustein dazu ist die Unterstützung durch Betriebliche Umwelt-informationssysteme.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Einsatzmöglichkeiten von Betrieblichen Umwelt-informationssystemen im Umweltmanagement aufzuzeigen. Dabei wird aber auch versucht die Berührungspunkte zwischen Informationsmanagement und Informatik auf der einen Seite und Umweltschutz und Umweltmangement auf der anderen Seite, darzustellen. Dies dient vorallem dazu, den Stellenwert der EDV für den betrieblichen Umweltschutz zu verdeutlichen. Denn aktiver und effektiver Umweltschutz ist heute ohne den Einsatz der EDV nicht mehr denkbar [Arnd93, S. 1].
Die Arbeit beschäftigt sich in den ersten beiden Kapiteln mit dem wesentlichen Faktor der Umweltinformation und den Möglichkeiten, die die Umweltinformatik zur Beschaffung, Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen geschaffen hat.
Schwerpunkt des Kapitel 3 ist die Charakterisierung von Betrieblichen Umweltinformations-systemen. Die Abgrenzung zu anderen Informationssystemen, die Darstellung der verschiedenen Funktionen und Modelle, die Anspr-che des Umweltmanagements an Betriebliche Umweltinformationssysteme und die Einsatzmöglichkeiten sowohl im strategischen als auch im operativen Umweltmanagement sind die wichtigsten Elemente dieses Kapitels.
In Kapitel 4 werden die Aspekte, die bei der Einführung von Betrieblichen Umwelt-informationssystemen beachtet werden sollten, dargestellt. Dies beginnt bei der Grobplanung und endet bei der Produktauswahl und der Installation.
Die letzten beiden Kapitel widmen sich den bereits am Markt verf-gbaren Systemen. Kapitel 5 gibt einen Überblick über den deutschsprachigen Umweltsoftwaremarkt. Kapitel 6 zeigt eine vom Autor durchgeführte Evaluierung von neun verschiedenen Betrieblichen Umweltinformationssystemen, vorallem hinsichtlich Funktionalität und Ergonomie. Die evaluierten Produkte kommen aus den drei Bereichen Abfallwirtschaftssysteme, Ökobilanzsysteme und Öko-Audit-Systeme.
1 Die Bedeutung von Information für das Umweltmanagement
Die grundsätzliche Bedeutung von Information beschreibt das folgende Zitat von Wi [Wick92, S. 584]. Umweltmanagement ist zielorientiertes Handeln. Es umfaßt nämlich die Planung, Realisierung, Steuerung und Kontrolle aller betrieblichen Umweltschutzaktivitäten. Zur Erf-llung dieser Aufgabe sind Informationen über alle umweltrelevanten Vorgänge im Unternehmen nat-rlich unerläßlich [Hopf93, S. 1156].
Das Ziel dieses ersten Kapitels ist es nun, den Stellenwert und die Bedeutung von Information in der heutigen Zeit, sowohl für das Unternehmen im allgemeinen, als auch für das Umweltmanagement im speziellen, zu untersuchen.
Die klassische Betriebswirtschaftslehre im Sinne Gutenbergs kennt die drei Produktions-faktoren Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe. Wenn man jedoch den betrieblichen Herstellungs- und Verwertungsprozeß genauer analysiert, so ist Information als zweck-orientiertes Wissen zu einer zielführenden Kombination der klassischen Produktionsfaktoren unumgänglich [Lehn91, S. 345].
Es besteht somit durchaus die Berechtigung Information als den vierten Produktionsfaktor zu bezeichnen. Es gen-gt nämlich nicht mehr, Arbeitskräfte einzustellen, Produktionsstätten zu errichten und Kapital für die Investitionen zu besitzen [Henn95, S. 17]. Die Unternehmen m-ssen mehr und mehr, Information als wichtige Geschäftsressource betrachten und als Wettbewerbsvorteil begreifen. Darüberhinaus ist es wichtig in unserer dynamischen Gesellschaft - man rechnet zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Verdopplung des Informationsbestandes alle sieben Jahre - die Fähigkeit zu besitzen, zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden und nur das herauszufiltern, was wirklich von Interesse ist [Henn95, S. 17].
Den Stellenwert des Produktionsfaktors Information in der Unternehmung soll die folgende Abbildung verdeutlichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.1: Der Stellenwert von Information im Unternehmen
Das folgende Kapitel soll nun zeigen, warum Information einen so hohen Stellenwert für das Umweltmanagement besitzt, wofür die Informationen benötigt werden und welche entscheidende Bedeutung dem Informationsmanagement in diesem Zusammenhang zukommt. Dabei wird auch auf die Aufgabe der Umweltinformationsbeschaffung, deren Probleme und Lösungsmöglichkeiten, genauer eingegangen.
1.1 Definition und Abgrenzung der Begriffe
Es erscheint sinnvoll, bevor man nähere Betrachtungen anstellt, zuerst die wesentlichen Begriffe näher zu beleuchten, sie voneinander abzugrenzen und verschiedene Definitionen bzw. Definitionsvorschläge zu diskutieren.
1.1.1 Information und Daten
Information und Daten sind Schl-sselbegriffe der Wirtschaftsinformatik. Trotz vieler Bem-hungen ist es bisher nicht gelungen, allgemein akzeptierte Definitionen für den Begriff Information und den damit eng verbundenen Begriff Daten zu entwickeln [Lehn95, S. 165].
Information kommt vom lateinischen Wort "informare", was soviel bedeutet wie "eine Form oder Gestalt geben" und im übertragenen Sinn bedeutet es "jemanden durch Unterweisung bilden" [Dude93, S. 315]. In der Wirtschaftsinformatik versucht Heinrich eine Definition von Information zu geben [Hein95, S 258]:
- Information ist handlungsbestimmendes Wissen über historische, gegen-wärtige und zuk-nftige Zustände der Wirklichkeit und Vorgänge in der Wirklichkeit.
Der wohl bekannteste Definitionsversuch stammt aus der betriebswirtschaftlichen Forschung von Wittmann [Witt59, S. 14]:
- Information ist zweckorientiertes Wissen, also solches Wissen, das zu Erreichung eines Zweckes, nämlich einer möglichst vollkommenen Disposition eingesetzt wird.
Darüberhinaus findet sich sowohl in der Informatik als auch in der Betriebswirtschaftlehre keine exakte Definition. Trotzdem zählt der Informationsbegriff zu den am häufigsten ge-brauchten Begriffen des täglichen Lebens. Die Verwendungszusammenhänge sind dabei relativ vielfältig. Wir informieren uns, wir informieren andere, sind informiert, ärgern uns über falsche Informationen, holen Informationen ein, besitzen einen Informationsvorsprung usw. Eine differenzierte Betrachtung dieser Begriffe ergibt, daß Information nur bei Übermittlung von bisher unbekannten neuem Wissen verwendet wird. Der Neuheitscharakter wird somit zu einem entscheidenden Element [Lehn95, S. 166].
Der Begriff Daten kommt ebenfalls aus dem Lateinischen. Er ist abgeleitet aus dem Wort "dare" und bedeutet "gegeben" oder "Gegebenes" [Lehn95, S. 200]. Heinrich versucht auch zum Begriff der Daten eine Definition zu geben [Hein95, S. 138]:
- Daten sind die Abbildung von Phänomenen der Wirklichkeit oder der Vorstellungswelt des Menschen, die in einem aktuellen Zusammenhang nicht unmittelbar zweckorientiert sind.
Etwas klarer erscheint der Erklärungsversuch von Hildebrand, der der Frage nachgeht, wie die Information überhaupt dem Einsatz in Informationssystemen zugänglich gemacht werden kann [Hild95, S. 4]:
- Daten sind das Ergebnis der der Konkretisierung dienenden Trans-formation der Information in eine maschinen- und werkzeuggerechte Dar-stellung. Hierbei liegt die Betonung auf dem Wort Darstellung, d. h. die Daten sind nicht selbst Information, sondern nur eine vom Code und Kontext abhängige Präsentation.
Diesen von Hildebrand genannten Zusammenhang soll die folgende Abbildung verdeutlichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.2: Information im Kontext von Wissen und Daten
Folgerichtig wird deshalb die maschinelle Verarbeitung und Vermittlung von Informationen Datenverarbeitung genannt. Es handelt sich dabei um eine formale Verarbeitung von maschinell - also bedeutungsfrei - interpretierbaren Zeichenfolgen. Informationsverarbeitung ist daher der umfassendere Begriff, der die Datenverarbeitung einschließt. Allerdings werden in der Praxis die beiden Ausdr-cke häufig synonym verwendet [Hild95, S. 5].
1.1.2 Informatik und Informationssystem
Im Gegensatz zu den beiden vorangegangen Begriffen läßt sich für den Begriff Informatik sehr leicht eine Definition im Informatik-Duden finden [Dude93, S. 305]:
- Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Computern.
Somit stellt sich die Informatik heute als eine Ingenieurwissenschaft dar, die den "Rohstoff Information" modelliert, aufbereitet, speichert, verarbeitet und einsetzt. Gemäß den verschiedenen Schwerpunkten unterscheidet man die theoretische, die praktische, die technische und die angewandte Informatik [Dude93, S. 305].
Im Zusammenhang mit Informatik und Information wird auch der Begriff des Informations-systems in der vorliegenden Arbeit eine entscheidende Rolle spielen.
- Ein Informationssystem ist ein System zur Speicherung, Wiedergewin-nung, Verkn-pfung und Auswertung von Information [Dude93, S. 317].
Eine etwas allgemeinere und für diese Arbeit ausreichende Erklärung von Informations-systemen findet sich bei Kytzia [Kytz95, S. 12]:
- Ein Informationssystem beschreibt die Gesamtheit aller informations-erfassenden und -verarbeitenden Abläufe innerhalb einer Unternehmung.
1.1.3 Informationsmanagement
Der Begriff und die Aufgaben des Informationsmanagements sollen hier nur kurz dargelegt werden. Der Begriff Informationsmanagement entstand aus der Zusammenfassung der beiden Begriffe Information und Management. Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß Information - und ihr Austausch, die Kommunikation - ein Produktionsfaktor ist, der notwendigerweise zu managen ist [Hild95, S. 33]. Demzufolge definiert Heinrich folgendermaßen [Hein96/2, S. 8]:
- Mit dem Konstrukt "Informationsmanagement" wird also das Leitungs-handeln (Management) in einer Betriebswirtschaft in bezug auf Information und Kommunikation bezeichnet, folglich alle F-hrungsaufgaben, die sich mit Information und Kommunikation in der Betriebswirtschaft befassen.
Eine dem Sinn nach der von Heinrich entsprechenden, aber etwas k-rzere und klarere Definition findet sich bei Wallm-ller [Wall95, S. 56]:
- Informationsmanagement ist die Gesamtheit aller Aufgaben und Leistungen der qualitiäts- und kostengerechten Bereitstellung von Information für das Unternehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.3: Der Anspruch des Informationsmanagements
Informationsmanagement beinhaltet somit alle Aufgaben bezüglich Planung, Gestaltung, Or-ganisation, Koordination und Kontrolle von technikgest-tzter Information und Kommunikation im Unternehmen, mit dem Ziel, den Unternehmenserfolg zu steigern [Hild95, S. 35].
1.2 Information als zentraler Punkt im Umweltmanagement
Wie angedeutet wurde, spielt der Faktor Information auch für das Umweltmanagement eine entscheidende Rolle. Umweltmanagement umfaßt die Planung, Steuerung und Kontrolle aller betrieblichen Umweltschutzaktivitäten. Die Erf-llung dieser Aufgabe ist ohne Informationen über alle umweltrelevanten Vorgänge im Unternehmen nicht erf-llbar. Es sind dabei, beispielsweise, folgende Informationen von Interesse [Brau93, S. 21f]:
- Informationen über die von der Firma ausgehenden Umwelteinwirkungen
- Entsprechende Periodenvergleiche
- Informationen über die ökologischen Auswirkungen von Maßnahmen
- Ökologische Ziele, usw.
Um diese Informationen zu generieren, ist es nötig eine Reihe von Fragen wie z. B. die folgenden zu beantworten [Maye95, S. D1]:
- Ist der verwendete Stoff toxisch (human- oder ökotoxisch)?
- Wer kann ihn entsorgen?
- Wieviel Promille des Umsatzes geben wir für Sonderabfall aus?
- Wie beeinflußt ein bestimmter Ersatzstoff unsere Produktion?
Wie an diesen wenigen Beispielen bereits zu erkennen ist, ist es notwendig ein umfassendes Konzept auszuarbeiten, indem festgelegt wird, welche Informationen, wie, wieoft und in welchem Umfang benötigt und erhoben werden. Dabei erscheint es wichtig, daß die Ausarbeitung eines solchen Konzeptes, im Rahmen des Informationsmanagements durchgef-hrt wird. Doch bevor man daran geht ein solches Konzept zu erarbeiten, sollte man sich überlegen wozu die betrieblichen Umweltdaten im einzelnen benötigt werden. Sozusagen das Ziel der Informationsbeschaffung festlegen.
Dabei gilt grundsätzlich, daß die Informationen intern (interne Funktion) der betriebsspezifischen Planung, Entwicklung, Steuerung und Kontrolle dienen und extern (externe Funktion) fördern sie den Dialog zwischen dem Unternehmen und seinem Umfeld [Wick92, S. 511]. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht den gegenwärtigen und zuk-nftigen Stellenwert betrieblicher Umweltinformationen für das Unternehmen und die Gesellschaft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.4: Funktionen und Adressaten betrieblicher Umweltinformationen
1.2.1 Informationen für das Unternehmen selbst
Wie aus der Abb. 1.4 zu erkennen ist, sind umfassende Umweltinformationen vorallem für die Unternehmensf-hrung von entscheidendem Interesse. Sie werden praktisch in allen Phasen der strategischen und operativen Unternehmensplanung benötigt [Wick92, S. 511]:
- Im Rahmen der Problemerkenntnis und Ideenfindung dienen sie dazu, die sich aus der Umwelt ergebenden Chancen und Risiken fr-hzeitig zu erkennen.
- Strategische Entscheidungen erfordern stets die Betrachtung des Gesamtunternehmens und der Umweltbedingungen sämtlicher funktionaler Bereiche.
- Die Entscheidungen und Pläne m-ssen permanent überpr-ft werden, um bei ein-schneidenden Abweichungen rechtzeitig reagieren zu können.
Grundsätzlich können alle Abteilungen einer Unternehmung betriebliche Umwelt-informationen nutzen, um die Umweltbelange ihres Bereiches zu bearbeiten. Beispielsweise benötigt die Marketingabteilung Informationen über den gesamten ökologischen Produkt-lebenszyklus um umweltschädigende Nebenwirkungen von Produkten zu verringern bzw. um-weltfreundlichere Produkte zu forcieren. Das gleiche gilt für die Einkaufs- und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Diese Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen.
Umweltschutzbeauftragte m-ssen schon aufgrund ihres Aufgabengebietes mit allen umwelt-relevanten Informationen versorgt werden. Nur dann können sie die gesamte Aufgabenpalette auch mit entsprechender Sorgfalt erf-llen. Betrieblicher Umweltschutz wird zunehmend auch als Instrument der Mitarbeiter motivation genutzt. Maßnahmen wie umweltorientierte Mitarbeiterschulung, Umweltberatung in Mitarbeiterhaushalten, Umweltaussch-sse und Umweltvorschlagswesen können aber nur funktionieren, wenn die Mitarbeiter über gen-gend Information verfügen und für dieses Thema bereits sensibilisiert sind.
1.2.2 Informationen für das Unternehmensumfeld
Neben dem eigentlichen Umweltmanagement des Unternehmens, sind Umweltinformationen auch überaus wichtig für das Unternehmensumfeld. Dabei gilt es nicht nur die Informations-anspr-che des Staates, die durch Gesetze und Verordnungen geregelt sind, zu befriedigen, sondern darüberhinaus die Chance einer aktiven Kommunikation über Umweltfragen mit den verschiedensten Anspruchsgruppen zu ergreifen. Somit wird Umweltberichterstattung zu einer zentralen Zukunftsaufgabe der Unternehmen [Clau96, S. 1].
Gerade für Kunden und Verbraucher spielen zwar nach wie vor Preis und Qualität die übergeordnete Rolle beim Kauf, doch Informationen über die ökologischen Auswirkungen des Produktes dienen heute als wichtiges Verkaufselement.
Der Umweltinformationsbedarf der Lieferanten konzentriert sich auf Daten, die R-ckschl-sse auf mögliche Einschränkungen oder Veränderungen des bisherigen Produktionsprogrammes des Abnehmers ermöglicht. Die Abnehmer sind möglicherweise an der Umweltgefährdung der erzeugten Produkte interessiert, bzw. welche Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes bereits ergriffen wurden. Dies gilt insbesonders dann, wenn als Nachfrager die öffentliche Hand auftritt, die in der Regel nach Erlässen zur umweltverträglichen Beschaffung vorgeht.
Im Bereich der Investoren ist es denkbar, daß umweltbewußte Anleger sich bei gleicher Renditeerwartung für das Unternehmen entscheiden, welches insgesamt die geringeren Um-weltbelastungen verursacht. Auch heute schon achten Banken bei der Beleihung von Grund-st-cken auf potentielle Altlasten. Gleiches gilt für Versicherungen, die die wachsenden Haftungsrisiken durch Umweltschädigungen bereits heute versuchen zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und schließlich zu kalkulieren. Das heißt, je undurchsichtiger und l-ckenhafter die Umweltdaten des Betriebes sind, umso schwieriger und kostspieliger wird sich der Versicherungsabschluß gestalten.
Und nicht zuletzt können mit Hilfe von umfassenden Umweltinformationen die Anspr-che der Behörden und der Öffentlichkeit gedeckt werden. Gegenüber Behörden sind ja bereits eine Reihe von Informations- und Auskunftspflichten im Umweltrecht geregelt. Es kann davon ausgegangen werden, daß diese Pflichten in Zukunft mehr und mehr ausgedehnt werden. Die Öffentlichkeit, die unter anderem durch Unternehmensverbände, Gewerkschaften, Ver-braucherverbände, Medien und Umweltschutzgruppen vertreten werden, hat in der Umwelt-diskussion eine wichtige Position. Ökologische Informationen können dazu dienen, die Diskussion sachlicher zu führen und bessere Lösungen zu finden.
1.3 Umweltschutzbezogene Erweiterung des betrieblichen Informations-managements
Wie bereits aufgezeigt wurde kann integrierter Umweltschutz, in Form eines umfassenden Umweltmanagements, nur bewältigt werden, wenn er vom Informationsmanagement des Betriebes unterst-tzt und in adäquater Weise in betrieblichen Informationssystemen abgebildet wird. Insbesondere muß der Informationsbedarf in den Betrieben im Hinblick auf die Umweltbelastungen gedeckt werden [Krau95, S. 15].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.5: Aufgaben des Umweltinformationsmanagements
Zu den Aufgaben des Informationsmanagements im Sinne des integrierten Umweltschutzes ge-hören daher insbesondere das Erfassen und Sammeln von ökologisch relevanten Informationen innerhalb und außerhalb des Betriebes, sowie die Aufbereitung und Bereitstellung dieser Daten zur Umsetzung geplanter ökologischer Maßnahmen [Krau95, S. 15].
Um diese Aufgaben zu erf-llen, setzt das Informationsmanagement in den Bereichen an, die das informationserfassende und -verarbeitende Verhalten innerhalb der Unternehmung bestimmen [Kytz95, S. 19ff]:
- Management des Informationsbedarfs
Darunter versteht man die Planung und Kontrolle des Informationserfassungsprozesses. Das heißt die Durchführung einer umfassenden Informationsbedarfsanalyse und die Festlegung der Informationsquellen.
- Gestaltung des organisatorischen Rahmens
Dabei geht es um die Anpassung sowohl der Organisationsstruktur als auch der Arbeitsabläufe um die Integration des Informationssystems zu unterst-tzen.
- Management der Informationstechniken
Dazu zählt vorallem die Schaffung und Einführung geeigneter Informationstechniken bzw. Informationssysteme, die die Ziele des strategischen Umweltinformationsmanagements möglichst optimal unterst-tzen.
1.3.1 Management des Informationsbedarfs
Wie bereits erwähnt geht es in diesem Bereich des Informationsmanagements darum, den Informationsbedarf zu planen und die Informationsquellen für diesen Informationsbedarf festzulegen. Dabei sollten im Bereich der Umweltinformationsbeschaffung und -verarbeitung folgende Beobachtungsfelder in Betracht gezogen werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abb. 1.6: Beobachtungsfelder im Rahmen der Umweltinformationsbeschaffung
Neben diesen eher betriebsexternen Beobachtungsfeldern sollten auch die folgenden vier Infor-mationsaufgaben erf-llt werden [Hall92, S. 34]:
- Erfassung von Stoff- und Energieflußinformationen der unternehmensinternen Aktivitäten
- Bereitstellung von Stoff- und Energieflußinformationen aus dem ökologischen Lebenszyklus der Produkte
- Beschaffung von Informationen zur ökologischen Beurteilung der Stoff- und Energieströme
- Bereitstellung von Informationen zur Analyse der ökonomisch-ökologischen Restriktionen
Grundsätzlich läßt sich die ökologische Relevanz unternehmerischer Aktivität immer auf die Stoff- und Energieaustauschbeziehungen mit der Natur zurückführen [Bund95, S. 26]. Deshalb hat das Informationsbeschaffungssystem die Aufgabe, Informationen über die Austausch-beziehungen des gesamten Betriebes sowie einzelner Prozesse oder Verfahrensschritte zur Verfügung zu stellen. Darüberhinaus sind Informationen über die stofflichen Wechselwir-kungen im Rahmen der ökologischen Produktlebenszyklen und die Wechselwirkungen mit der Natur, die durch die Bereitstellung der Produktionsfaktoren und der notwendigen Infrastruktur entstehen, bereitzustellen [Hall92, S. 35]. Hierfür m-ssen die Informationen nicht nur erfaßt, sondern auch entsprechend aufbereitet werden.
Unabhängig vom festgelegten Informationsbedarf, der nat-rlich für jedes Unternehmen anders ist, ist es notwendig anschließend jene Informationsquellen zu bestimmen bzw. zu identifizieren, wo dieser Informationsbedarf am besten gedeckt wird. Dabei gibt es gundsätzlich zwei Möglichkeiten: betriebsinterne Quellen oder betriebsexterne Quellen.
1.3.1.1 Betriebsinterne Informationsbeschaffung
Die betriebsinterne Informationsbeschaffung vollzieht sich grundsätzlich an der betrieblichen Wertkette. Das heißt es wird sowohl der Input und der Output als auch der Transformations-prozeß zur Deckung des Informationsbedarfs herangezogen. Auf der Inputseite sind vorallem die G-ter und Stoffe, die in den Transformationsprozeß eingehen von Bedeutung, aber auch Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Energie spielen eine wichtige Rolle. Auf der Outputseite sind vorallem die Produkte von Interesse, aber auch der unerwünschte Output, wie Emissionen und Abfälle. Im Rahmen des Transformationsprozesses sind vorallem die Prozeßinformationen als wichtige Informationsquellen anzusehen. Im einzelnen bieten sich folgende interne Informationsquellen an:
- das betriebliche Rechnungswesen
hier wird das Mengenger-st der jährlichen G-terfl-sse (inkl. Energieträger und Wasser-verbrauch) in Geldeinheiten beschrieben [Kytz95, S. 129]
- das System der Produktionsplanung und Steuerung
hier finden sich Grunddaten (Artikelstamm mit Stücklisten), Auftragsdaten und Daten aus dem Einkauf, Verkauf, der Materialwirtschaft und der Lagerhaltung [Esch95, S. 90f]
- Emissionsmeßberichte
Messungen von Abluft- und Abwasserströmen zählen klarerweise zu internen Informationsquellen [Kytz95, S. 130]
- Umweltschutzstatistiken
falls vorhanden, stellen solche Umweltschutzstatistiken vorallem Abfall-, Wasser- und Energiestatistiken wertvolle Informationsquellen dar [Kytz95, S. 131]
- Mitarbeiter des Unternehmens
eine nicht zu unterschätzende Informationsquelle stellen die eigenen Mitarbeiter dar, die in ihrer unmittelbaren Arbeitsumgebung sehr genau bescheid wissen [Lehm93, S. 27]
Darüberhinaus stellen alle Informationen über Stoff- und Energieströme (wie z. B. Büro-materialdateien, Entsorgerdatei, usw.) potentielle Informationsquellen zur Generierung von Umweltinformationen dar.
1.3.1.2 Betriebsexterne Informationsbeschaffung
Als betriebsexterne Informationsquellen kommen laut einer Umfrage unter 85 Umweltbeauftragten folgende Quellen in Frage [Lang95, S. 38]:
- Publikationen von Kammern und Fachverbänden
- behördliche Mitteilungen
- Fachzeitschriften und B-cher
- Lieferanten und Hersteller
- Seminare, Tagungen und Messen
- Öko-Consulting-Anbieter
- Universitäten und Forschungsinstitute
- Umweltdatenbanken
- informelle Kontakte mit anderen Umweltbeauftragten
Weitere Möglichkeiten der Erschließung externer Informationsquellen sind Tageszeitungen und externe Berater, wie das Ergebnis einer umfassenden Befragung von knapp 600 Unternehmen in der BRD gezeigt hat [Umwe91, S. 220]. Darüberhinaus finden sich bei Eschenbach [Esch95, S. 89f] noch B-rgerinitiativen und Konsumentenschutzvereine als weitere externe Quellen. Es gibt sicher noch eine Reihe weiterer externer Informationsquellen, die nur speziell für einzelne Unternehmungen von Bedeutung sind. Wie diese internen und externen Informationsquellen sinnvoll genutzt werden können und wie diese Informationsgewinnung organisiert und durch geeignete Informationstechnologien bestmöglichst unterst-tzt werden kann, ist Thema der folgenden beiden Kapitel.
1.3.2 Gestaltung des organisatorischen Rahmens
Das Informationsmanagement ist in diesem Zusammenhang auch gefordert sowohl die Aufbauorganisation (Bildung von Stellen und Abteilungen) als auch die Ablauforganisation (Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse) dahingehend zu überpr-fen, ob das Ziel einer qualitativen und quantitativen Umweltinformationsbeschaffung und -verarbeitung optimal unterst-tzt wird [Kytz95, S. 21].
Im Bereich der Aufbauorganisation sind Verantwortliche zu bestimmen (Umweltbeauftragte), die der Unternehmensf-hrung verantwortlich sind. Natürlich können auch ganze Umwelt-schutzabteilungen gebildet werden, deren organisatorische Eingliederung optimal angepaßt werden muß.
Die Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe sind durch geeignetes Business-Process-Reeingineering dahingehend zu verändern, daß eine optimale Umweltinformationsverarbeitung möglich wird. Darüberhinaus können verschiedene Organisationsinstrumente eingef-hrt werden, um die Informationsverteilung zu verbessern [Kytz95, S. 58f]:
- die Bildung von "Ökologiezirkeln", in denen Mitarbeiter verschiedener Abteilungen Probleme diskutieren und gemeinsam Lösungswege erarbeiten
- die Installierung von Instrumenten der Mitarbeiterinformation (z. B. Anschlagbrett oder Mitarbeiterzeitung)
- die Installierung von Instrumenten der Information durch die Mitarbeiter (z. B. Vorschlagswesen, Wettbewerbe oder Mitarbeiterbefragungen)
1.3.3 Management der Informationstechniken
Das Informationsmanagement hat desweiteren dafür zu sorgen, daß geeignete Informationstechniken zur Verfügung stehen, um das Ziel, die umweltrelevanten Informationen zu erfassen und zu verarbeiten, möglichst schnell und effizient erreicht werden kann. Dabei ist das vorrangige Ziel, die im Betrieb erfaßten und verstreut gehaltenen ökologisch relevanten Informationen in ein System zu integrieren und auswertbar zu machen [Krau95, S. 15].
Dazu m-ssen Informationstechnologien und Geschäftsprozesse integriert werden. Das heißt, Geschäftsprozesse m-ssen analysiert und optimiert werden und anschließend durch geeignete Informationssysteme, wie zum Beispiel, durch
- die Erweiterung des Rechnungswesens um ökologische Belange
- die Einführung eines Öko-Controlling-Systems
- die Einführung eines ökologischen Fr-hwarnsystems
- die Implementierung eines computergest-tzten Betrieblichen Umweltinformationssystems
unterst-tzt werden [Krau95, S. 16]. Egal welches Informationssystem auch immer im Unter-nehmen installiert wird, sollte darauf geachtet werden, daß eine integrative Lösung (keine redundante Datenhaltung) mit einer Anbindungsmöglichkeit von externen Informationsquellen angestrebt wird.
2 Umweltinformatik - ein wesentliches Instrument zur Lösung von Umweltproblemen
Wie bereits im vorigen Kapitel erörtert wurde, sind die Aufgaben des Umweltschutzes, der Umweltplanung und der Umweltforschung nur auf der Grundlage einer hinreichenden und zuverlässigen Informationsbasis zu bewältigen. Somit ist es offensichtlich, obwohl der Verringerung von Umweltbelastungen zweifellos auch andere H-rden als Informationsdefizite im Wege stehen, daß Problemlösungen im Umweltbereich in zunehmendem Maße komplexe Informationsverarbeitungsaufgaben umfassen, die nur mit einer weitgehenden technischen Unterstützung zu bewältigen sind [Page94, S. 13].
Aus diesem Grund, begann sich mitte der 80er Jahre, in der Informatik die Forschungsrichtung "Angewandte Informatik im Umweltschutz" zu bilden. Diese Forschungsrichtung ist inzwischen zur Spezialdisziplin der Umweltinformatik mit interdisziplinärem Charakter gewachsen und läßt sich folgendermaßen definieren [Page94, S. 16]:
- Umweltinformatik ist eine Teildisziplin der Angewandten Informatik, die mit Methoden und Techniken der Informatik diejenigen Informationsverfahren analysiert, unterst-tzt und mitgestaltet, die einen Beitrag zur Untersuchung, Behebung, Vermeidung oder Minimierung von Umweltbelastungen und Umweltschäden leisten können.
Ein weiterer Definitionsvorschlag kommt vom GI (Gesellschaft für Informatik)-Arbeitskreis "Ausbildung im Bereich Umweltinformatik", der Umweltinformatik folgendermaßen definiert [Page94, S. 258]:
- Umweltinformatik befaßt sich mit den Anwendungen der Informatik für den Umweltschutz. Sie sammelt, ordnet, bewertet und entwickelt Methoden, Verfahren und Techniken der Informatik und bietet sie den Anwendern an.
Die Gründe für die Entstehung dieser eigenen Teildisziplin der Informatik liegen vorallem in den besonderen Eigenschaften der Umweltdaten und deren Verarbeitungserfordernissen im Vergleich zu den Daten anderer Anwendungsgebiete der Informatik [Page94, S. 17f]:
- Die Daten in Umweltinformationssystemen liegen in heterogener Struktur vor (z. B. Meßwerte aus der Umweltüberwachung, textuelle Daten aus der Umweltliteratur, aus Gesetzen oder Forschungsvorhaben, Strukturdaten zu chemischen Stoffen, formatierte Daten zu technischen Anlagen, usw.), haben häufig einen geographischen Bezug und m-ssen oft durch komplexe geometrische Objekte dargestellt werden.
- Im Umweltbereich spielt sowohl die Verarbeitung empirischer Daten mit statistischen Methoden als auch der Umgang mit unsicheren, unpräzisen oder unvollständigen Daten (Verarbeitung von vagem Wissen) eine zentrale Rolle.
- Weiters muß ein einfacher und flexibler Zugriff auf heterogene Datenbanken möglich sein, da ein Benutzer aufgrund der interdisziplinären Umweltprobleme häufig auf unterschiedliche Datenquellen zugreifen muß.
- Schließlich ist es häufig notwendig, die Umweltdaten modellbasierten Analysen zu entnehmen (z. B. um gemessene Immissionsdaten durch Ausbreitungsrechnungen zu ergänzen).
Aus diesen und anderen Gründen ergeben sich spezifische Anforderungen an die Informationsverarbeitung im Umweltbereich, die nur durch die Integration verschiedener Konzepte und durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelöst werden können. Somit hat die Umweltinformatik Wissen und Informationen aus unterschiedlichen Spezialgebieten aufzunehmen, zu verarbeiten und wieder zur Verfügung zu stellen. Diese integrative und ganzheitliche Betrachtung geht auch aus der folgenden Abbildung hervor, die die unterschiedlich starken Verkn-pfungen mit anderen speziellen Informatiken zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1: Verkn-fung von Umweltinformatik mit anderen Informatiken
Wie aus der Abbildung erkennbar ist, bestehen die Beziehungen teilweise nur aus einem punktuellen Wissensaustausch (z. B. Rechtsinformatik), in anderen Fällen jedoch auch aus einer Überschneidung der Gegenstandsbereiche (z. B. Wirtschaftsinformatik).
Eine Überschneidung besteht unter anderem mit der Bioinformatik, da sich beide Disziplinen, unter anderem, mit dem Einsatz von Informationstechniken zur Analyse natürlicher Systeme befassen. Ebenfalls sehr breite Überschneidungsbereiche gibt es nat-rlich mit der Geoinformatik, die sich intensiv mit dem Aufbau von Geographischen Informationssystemen befaßt. Auf der technischen Ebene, besonders im Rahmen von Überwachungs- und Kontrollsystemen, bestehen Gemeinsamkeiten mit der Ingenieurinformatik, vorallem im Bereich der Prozeß- und der Meßdatenverarbeitung.
Die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich zunehmend mit Konzepten von Betrieblichen Umweltinformationssystemen, Software-Werkzeugen für die Erstellung von Prozeß-, Betriebs- oder Produkt-Ökobilanzen, oder für die ökologisch orientierte Produktionsplanung bis hin zur computergest-tzten Ökologistik. Somit entwickelt sich zwischen Umweltinformatik und Wirtschaftsinformatik ein breites gemeinsames Aktionsfeld.
Mit den anderen speziellen Informatiken, wie Verwaltungsinformatik, Rechtsinformatik, Chemieinformatik und Medizininformatik bestehen nur punktuelle Berührungspunkte, die vorallem daher kommen, daß das Anwendungsgebiet für die Umweltinformatik sehr breit gestreut ist.
Diese Darstellung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es in der Umweltinformatik nicht nur darum geht, Werkzeuge der Informationsverarbeitung, die ohne Bezug auf mögliche Anwendungen im Umweltbereich entwickelt worden sind, nun auch in diesem Bereich einzusetzen und damit der Informatik ein neues Aufgabengebiet zu erschließen. Denn jeder neue Aufgabenbereich, stellt eigene Anforderungen und neue Aufgaben. Das heißt, wer Umweltinformatik betreiben will, der muß mit einem Bein in der Informatik, und mit dem anderen genau so fest in der Umweltproblematik stehen. Erst dann wird Umweltinformatik glaubw-rdig und erst dann kann sie einen echten Beitrag zur Lösung der anstehenden Probleme leisten [Page94, S. 27].
Nach dieser kurzen Einführung in die Entstehungsgeschichte, die Ziele und die Einordnung der Umweltinformatik wird in den folgenden Kapiteln genauer auf die Aufgaben der Umweltinformatik und deren verschiedenen Teilgebiete eingegangen. Im Anschluß daran wird der Beitrag den die Umweltinformatik zur Lösung der anstehenden Umweltprobleme leisten soll und leisten kann einer kritischen Betrachtung unterzogen.
2.1 Grundsätzliche Aufgaben der Umweltinformatik
Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel beschrieben, ist das Hauptziel der Umweltinformatik, zur Lösung der Umweltprobleme beizutragen. Dabei steht im Vordergrund das Informationsdefizit auszugleichen und mit den entwickelten Methoden und Techniken die Entscheidung für oder gegen bestimmte Maßnahmen zu erleichtern und eine Kontrolle der eingeleiteten Maßnahmen zu ermöglichen.
Somit hat die Umweltinformatik drei aufeinander aufbauende Grundaufgaben mit unterschiedlicher Zielsetzung zu erf-llen [Hilt95, S. 7]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.2: Grundsätzliche Aufgaben der Umweltinformatik
2.1.1 Die Beschaffung von umweltrelevanten Daten
Eine der wesentlichen Aufgaben der Umweltinformatik ist die Beschaffung von umweltrelevanten Daten. Diese Daten dienen der Beschreibung des Zustandes und der Entwicklung der Umwelt. Sie werden benötigt zur Vermeidung oder Begrenzung negativer und zur Unterstützung positiver Auswirkungen auf die Umwelt.
Die meisten im praktischen Einsatz stehenden Umweltinformatik-Systeme sind dieser Stufe zuzuordnen. Dazu gehören unter anderem Umweltmonitoring-Systeme (siehe auch Kap. 2.2.1), die den Zustand der Umwelt kontinuierlich überwachen. Die Schwierigkeiten liegen, wie bereits angesprochen, darin, daß Informationen über Umweltprobleme fast immer räumlich und zeitlich differenziert zu betrachten sind und daher der Datenaufwand enorm steigt. Weiters handelt es sich nicht immer über Daten über die Umwelt (wie z. B. Daten zur Luft- oder Wasserg-te), sondern auch um Daten mit indirektem Umweltbezug, wie z. B. Angaben zu Materialien, Produkten, Abfällen, Gesetzen oder Forschungsergebnissen.
2.1.2 Die Auswertung und Analyse umweltrelevanter Daten
Die zweite Stufe, die Auswertung und Analyse umweltrelevanter Daten, dient der Schaffung dauerhafter Grundlagen für ein Verständnis der Umwelt und der Wechselwirkungen zwischen Natur, Technik und Gesellschaft und bildet sozusagen die Basis für die Unterstützung umweltrelevanter Entscheidungen.
Es umfaßt somit alle Bem-hungen zur Speicherung umweltbezogener Daten und deren Verdichtung zu aussagefähigen Informationen. Dazu zählt vorallem der Bereich der Datenbankanwendungen (siehe auch Kap. 2.2.2), wie zum Beispiel Datenbanken zur Umweltliteratur und -forschung, Datenbanken zu umweltgefährdenden Stoffen und Datenbanken die Daten aus Umweltmonitoringsystemen verwalten (z. B. Luftmeßwerte). Dabei spielt in j-ngerer Zeit immer mehr das Problem von integralen Betrachtungen eine zentrale Rolle. Das heißt, man will einer Zersplitterung des Informationsangebotes in einzelne Umweltmedien entgegenwirken, in dem beispielsweise Daten zur Luftüberwachung, der Gewässerg-te und dem Vorkommen bestimmter Tier- und Pflanzenarten miteinander verkn-pft bzw. zusammenhängend verf-gbar gemacht werden [Simo91, S. 78].
Die Bedeutung dieser Aufgabe für den Umweltschutz liegt vorallem in der effizienten Bereitstellung von Informationen. Man unterstellt jedoch dabei, daß das Wissen über Umweltsituation und Umweltzusammenhänge zumindest einen wichtigen Faktor bei der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten und der Implementation von Maßnahmen darstellt. Es wurde aber bislang noch nicht untersucht, ob ein Mehr an Information auch immer einen Fortschritt bei der Bewältigung von Umweltproblemen bedeutet [Simo91, S. 78].
2.1.3 Die Synthese zur umweltorientierten Maßnahmenplanung
Die dritte grundsätzliche Aufgabe der Umweltinformatik, ist die Synthese der erhobenen und ausgewerteten Daten zur Maßnahmenplanung. Das heißt, mit anderen Worten, zu wissen, wo es brennt - bessere und umfassendere Informationen über den Zustand und die wahrscheinliche Entwicklung von Umweltsystemen - ist eine Voraussetzung für besseren Umgang mit Umweltproblemen. Zu wissen, wie gelöscht werden kann - Kenntnis der Eingriffsmöglich-keiten und ihrer Folgen - ist aber die zweite notwendige Vorraussetzung für den Erfolg [Page94, S. 30].
Es geht also darum, die Wirkungen und Nebenwirkungen möglicher Maßnahmen abzuschätzen und erfordert somit eine genaue und tiefgreifende Analyse der Zusammenhänge und der durch sie bedingten dynamischen Prozesse. Die Umweltinformatik kann dazu Werkzeuge für die routinemäßige Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen schaffen, mit denen der Schritt von reiner Datenverarbeitung zur Wissensverarbeitung getan werden kann. Im konkreten gehören dazu die Expertensysteme und die Simulationssysteme (siehe auch Kap. 2.2.3 und 2.2.4).
Welche Methoden und Techniken die Umweltinformatik nun im einzelnen entwickelt hat und in welchen Teilgebieten Forschungen und Entwicklungen betrieben wird zeigt das folgende Kapitel.
2.2 Beschreibung der verschiedenen Teilgebiete der Umweltinformatik
Das nachfolgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Teilgebiete und Entwicklungen der Umweltinformatik. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl anderer, vorallem Forschungen bzw. Forschungsvorhaben. Alle aufzuzählen würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem übersteigen.
2.2.1 Umweltmonitoringsysteme zur Beobachtung der Umwelt
Unter Umweltmonitoring versteht man die kontinuierliche, automatisierte Beobachtung des Zustandes der Umwelt [Page94, S. 51]. Somit befriedigen diese Systeme vorallem die Grund-aufgabe der Beschaffung von umweltrelevanten Daten. Die entsprechenden Informationen können einerseits über Satelliten oder aber auch mit billigeren Sensoren gewonnen werden. Es ist daher möglich, angefangen beim räumlich sehr begrenzten Bereich eines Unternehmens, über regionale bis nationale und sogar globale Bereiche Umweltmonitoring zu betreiben.
So werden auf europäischer Ebene beispielsweise die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, der Zustand der Meere oder die Veränderung des Klimas in zunehmendem Maße mit Mitteln der Satellitenfernerkundung untersucht [Page94, S. 55]. Im regionalen Bereich setzen Kommunen vorallem auf die Sensortechnik gekoppelt mit geeigneter Informationstechnologie, um vorallem die Umweltmedien, wie Luft und Wasser, in unmittelbarer Umgebung kontinuierlich zu überwachen, um so bei Überschreiten der Grenzwerte rasch geeignete Gegen-maßnahmen einzuleiten. Ein Beispiel für ein solches System ist das automatische Luftüber-wachungsnetz für Oberösterreich (LMN), daß 1977 seinen Betrieb aufgenommen hat und die Emissionen, Immissionen und die Temperaturverhältnisse für ganz Oberösterreich aufzeichnet [Lehn90, S. 40]. Aber auch eine wachsende Anzahl von Unternehmen betreibt bereits ein unternehmenseigenes Umweltmonitoring zur Messung der Emissionen.
Den Höhepunkt haben diese Systeme aber bei weitem noch nicht erreicht. Zahllose Forschungsprojekte sind im Gange und es ist damit zu rechnen, daß in absehbarer Zeit weit mehr und weit leistungsfähigere Systeme auf den Markt kommen werden. Der Leitgedanke ist dabei, schneller und verläßlicher zu umfassenden Informationen über den Zustand der Umwelt im zeitlichen Verlauf zu gelangen.
2.2.2 Die Entwicklung von Umweltdatenbanken
Umweltdaten stellen besondere Anforderungen an die Datenbanktechnologie. Neben reinen Faktendaten (wie Angaben über chemische Substanzen, Abfälle, usw.) und Meßwerten aus Überwachungssystemen m-ssen in vielen Fällen auch Daten ganz anderer Struktur (z. B. Umweltgesetze und -verordnungen) in die Datenbanken aufgenommen werden. Dies hat schon sehr bald den Entwurf eigener Umweltdatenbanken bewirkt. Somit sind Datenbanken die ältesten Informatikanwendungen im Bereich des Umweltschutzes [Ökol94, S. 8].
Eine Umweltdatenbank ist durch folgende Eigenschaften charakterisiert [Page94, S 79]:
- es sind überwiegend Umweltdaten gespeichert
- es wird ein Datenbanksystem zur Speicherung verwendet
- die Datenbank wurde als Grundlage für umweltbezogene Anwendungen oder Ausk-nfte angelegt
Darüberhinaus gelten nat-rlich dieselben Anforderungen an das Datenbanksystem, wie bei anderen Datenbanken auch: persistente Datenhaltung, Datenbanksprache, Transaktions-konzept, Mehrbenutzerbetrieb, Datensicherheit, Datenschutz und Zugangskontrolle.
Man kann grundsätzlich zwei Arten von Datenbanken unterscheiden: Online Datenbanken die über verschiedene Netze (Datex-P, Internet, etc.) erreichbar sind und Offline Datenbanken (Inhouse-Systeme) zu denen CD-ROM's und Disketten gehören [Voig94, S. 71]. In dem welt-weit größten Datenbankf-hrer, dem Gale Directory of Databases sind 1994, 8400 Daten-banken beschrieben, darunter 656 Datenbanken mit Umweltbezug [Voig94, S. 71ff].
Das Spektrum der Anwender reicht dabei von öffentlichen Körperschaften zur Überwachung von Umweltauflagen, über Unternehmen zur Selbstkontrolle, Beratungsfirmen und Planungs-b-ros als Dienstleistungsunternehmen, Umweltschutzgruppen zur Überwachung bis hin zu Forschungsinstituten.
Genauso breit wie das Spektrum der Anwender ist auch das Spektrum der Einsatzgebiete von Umweltdatenbanken. Ein bewährtes Beispiel ist das Wattenmeer-Datenbanksystem WADABA, das Datenmaterial und Ergebnisse aus der Wattenmeerforschung verwaltet [Ökol94, S. 8]. Ein anderes Datenbanksystem, das Altlastenkataster Berlin, verwaltet alle Informationen über Altlastenverdachtsflächen in Berlin [Ökol94, S. 8]. Weiters werden im Berliner Umweltbundesamt (UBA) eine ganze Reihe öffentlich zugänglicher Datenbanken verwaltet. So zum Beispiel die Umweltliteraturdatenbank ULIDAT, die Umweltforschungs-datenbank UFORDAT und die Umweltrechtsdatenbank UR-DB [Ökol94, S. 8f]. Jeder Besitzer eines PC kann mit Hilfe eines Modems über Datex-P, Internet oder über das Wissenschaftsnetz in diesen UBA-Datenbanken recherchieren.
Weiters gibt es eine Reihe von allgemeinen Umweltdatenbanken, wie ENVIROLINE, POLLUTION ABSTRACTS und ULIDAT, die einen sehr guten Querschnitt durch umwelt-bezogene Themen geben [Schw94, S. 14].
Das Problem besteht nun aus der F-lle der Datenbanken jene zu finden, wo die gesuchten Antworten lagern. Dabei sollte man sich vor der Suche in sogenannten Datenbankf-hrern und Metadatenbanken, wie z. B. DADB - Metadatenbank der Online Datenbanken [Voig94, S. 72ff] umsehen und die gesuchten Begriffe oder Probleme möglichst genau abstecken, um möglichst rasch ein brauchbares Ergebnis zu erhalten. Darüberhinaus sollte man sich auch nicht davor scheuen, in den klassischen Fachdatenbanken oder Literaturdatenbanken, wie CHEMICAL ABSTRACTS (Chemiedatenbank), MEDLINE (Medizindatenbank), TOXALL (Toxikologische Datenbank), HARVARD BUSINESS REVIEW (Wirtschaftsdatenbank) oder WORLD PATENS INDEX (Patentdatenbank), zu suchen [Schw94, S. 14ff].
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1997
- ISBN (eBook)
- 9783832451172
- ISBN (Paperback)
- 9783838651170
- DOI
- 10.3239/9783832451172
- Dateigröße
- 942 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz – Wirtschaftsinformatik
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Schlagworte
- betriebliche umweltinformationssysteme evaluierung umweltinformatik umweltmanagement umweltsoftwaremarkt
- Produktsicherheit
- Diplom.de