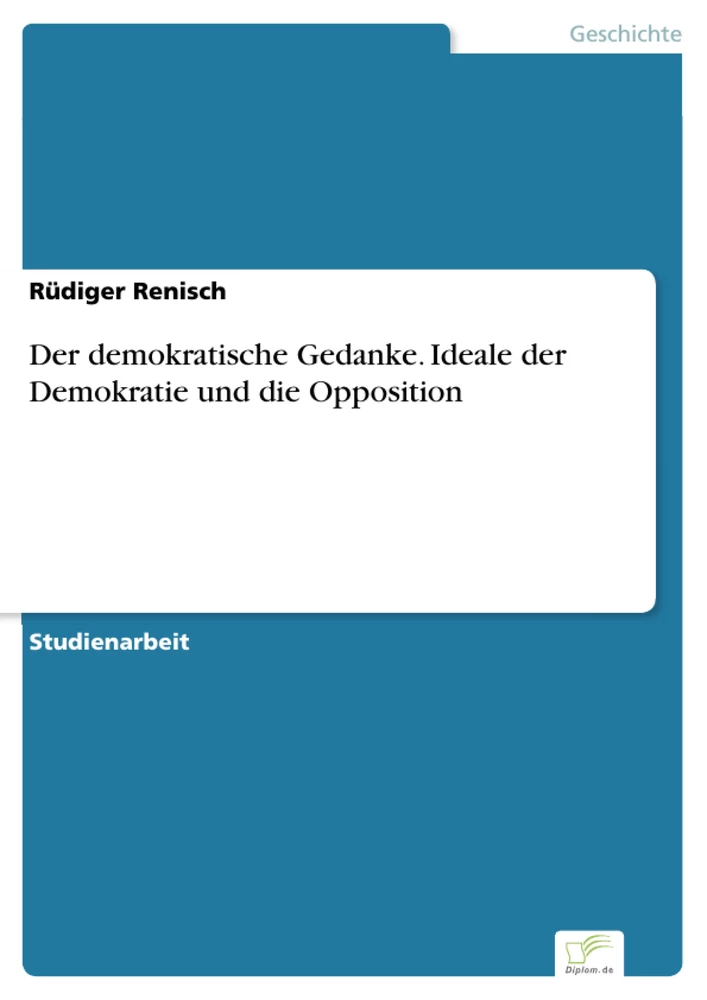Der demokratische Gedanke. Ideale der Demokratie und die Opposition
©2004
Hausarbeit
24 Seiten
Zusammenfassung
Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Diese Behauptung mag zwar zuerst widersinnig klingen, aber bei eingehender Betrachtung wird sich herausstellen, dass sie vollends berechtigt ist. Die heutigen Unterschiede der Demokratien sind allein ein Thema für sich und umfassen auch nicht die Thematik dieser Arbeit, die sich allein mit dem geistigen und praktischen Hintergrund der attischen Demokratie des 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., sowie den demokratischen Elementen der römischen Republik bzw. des späten Prinzipats befasst. Dabei wird natürlich ein Ausblick hin zu den heutigen Formen der Demokratie gewagt werden. Allerdings kann dieser nur in schwachen Zügen umrissen werden, denn inzwischen sind mehr als 2500 Jahre vergangen, als sich die früheste nachweisbare Form auf der attischen Halbinsel entwickelte. Allein dieser Zeitunterschied ist schon fast eine ausreichende Erklärung für die fundamentalen Unterschiede zwischen der antiken, insbesondere der attischen Demokratie gegenüber der heutigen Form.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
1. zur Demokratiedefinition
Demokratie () bedeutet korrekt übersetzt ,,Volks- Macht", obwohl sich die
Definition ,,Volksherrschaft" mittlerweile eingebürgert hat. Konkret bedeutet
Demokratie eine auf Dauer angelegte Staatsform, in der das souveräne Volk sich
selbst durch institutionalisierte und verrechtlichte Selbstkontrolle vor Zufalls- und
Willkürentscheidungen schützt und damit ständig überprüfbare Grundlinien in Politik,
Recht und Verwaltung schafft.
Demokratie nach dieser Definition ist demnach nicht einfach Herrschaft des Volkes,
sondern Volksherrschaft auf der Grundlage freiwillig und mehrheitlich vereinbarter
Kontrollmechanismen für den Prozeß der Entscheidungsfindung in
Volksversammlung und Gericht. Die demokratische Gesellschaft und die rechtliche
Form ihrer Organisation bilden somit eine Einheit, die sich nicht in Volkssouveränität
und Gesetzessouveränität bzw. Herrschaft des Volkes und Herrschaft der Gesetze
aufspalten läßt.
1
Die attische Demokratie im Speziellen beruhte auf dem System der
Isonomie (,,gleiche Verteilung" der politischen Rechte) und der nach Herodot in den
Mittelpunkt der Demokratie gestellten Isegoria, dem gleichen Recht auf Rede für
alle.
2
Der demokratische Gedanke im Ganzen beruhte also in der schon erwähnten
Iseogoria, der Gleichheit als politischer Gleichberechtigung, der Herrschaft der
Masse und der Identität der Herrschenden mit den Beherrschten.
1.1. Entwicklung der attischen Demokratie
Die Ursprünge der attischen Demokratie sind in der zweiten Hälfte des 5. Jh. unter
Kleisthenes (Herodot) zu suchen. Sie sind nicht das Ergebnis einer antiken
Theoriediskussion und deren Umsetzung, sondern auf eine Krise der Adelswelt
zurückzuführen, die schon im 7. und 6. Jh. entstand. Diese Krise steckte in beinahe
allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, besonders in den Formen der
politischen Willensbildung, sowie auch in allen militärischen und wirtschaftlichen
Aspekten. Die Folge des Ganzen war eine überhandnehmende Verschlechterung
der sozialen Lage breiter Bevölkerungskreise, die geradezu zwangsweise zu
Reformen in der Politikausübung der oberen Schichten führen mußte. Die
Veränderungen im politischen Leben wurden durch die Reformen Solons
manifestiert. Dieser wollte durch seine Gesetzgebung die ins Wanken gebrachte
Ordnung (Dysonomie oder Anomie) wieder zu einer Wohlordnung (Eunomie) führen.
Sein Ziel bestand also nicht in der Beseitigung alter Strukturen, sondern in der
1
Eder, W.: Die athenische Demokratie im 4. Jh v. Chr.-Krise oder Vollendung?, S. 21.
2
Schubert, Ch.: Athen und Sparta, S. 26.
3
Festigung derselben durch bindende Markierungen, welche für dauerhafte
Harmonie sorgen sollten. Da die Gestalt Solons mehr mythischer Natur ist, ist die
Zuschreibung der ,,Errichtung der Demokratie" eine Rückprojektion der Athener in
der frühestens ab Kleisthenes und in den Zeiten danach, nachweisbar herrschenden
radikalen Demokratie. Die kleisthenische Reform, auch als kleisthenische
Phylenreform bezeichnet, hatte nicht nur die Neueinteilung- sowie Organisation der
athenischen Gemeinschaft zum Ziel, sondern auch die politische Gleichheit aller
athenischen Bürger, die das Grundprinzip für das Funktionieren seiner Reformen
darstellte. Die Neuorganisation der Gemeinschaft erfolgte unter der Abschaffung der
Phratrien und der Einteilung der Phylen in zehn Bezirke. Jede Phyle sollte sich aus
jeweils drei Trittyen zusammensetzen, die einem der drei großen
Landschaftsbereiche, Stadt (ásty), Binnenland (mesógeion) und Küste (paralía)
angehörte. Nach diesen Phylen wurden die Mitglieder der politischen Gremien erlost
oder gewählt, ebenso wurden die Athener nach diesem System zum Dienst im Heer
als Hoplit, Ruderer, Leichtbewaffneter etc. eingeteilt. Allerdings kann man auch erst
in perikleischer Zeit von einer vollausgebildeten Demokratie sprechen, da in dieser
Zeit dem Areopag gewisse Kompetenzen entzogen und der Volksversammlung,
dem Rat und dem Volksgericht übertragen wurden.
1.2. Ideal der Demokratie
Das Ideal der attischen Demokratie bestand in der ,,Freiheit", als attischer Bürger
seine politischen Rechte wahrnehmen zu können und in diesen den anderen gleich
gestellt zu sein. Die Teilnahme an der kollektiven Ausübung der Macht war für den
attischen Bürger die höchste Vollendung. Die Grenzen der ,,Freiheit" waren jedoch
spätestens dann erreicht, wenn individualistische Vorstellungen, sich vor den
kollektiven Vorstellungen durchzusetzen versuchten. Die Interessen der
Gemeinschaft hatten auf jeden Fall Vorrang vor denen des Individuums, ganz
abgesehen davon, daß es gar keine Definition dafür gab.
1.3. Opposition gegenüber der Demokratie
Man kann allgemein postulieren, daß fast alle Autoren, seien es Historiker oder
nachsokratische Philosophen Feinde der Demokratie waren. Einzig die Tragiker, die
die politische Tragödie entwickelten, vor allem Aristophanes, sowie die meisten der
Redner, zum Beispiel Demosthenes waren Verfechter der Demokratie. Die Gegner
der Demokratie erhoben als bedeutendsten Vorwurf die politische Gleichheit der
Demokratie, da der Gleichheitsbegriff für sie eine abstrakte Größe war, der jeder
inhaltliche Bezug, wie Leistung, Ansehen etc. fehlte. Der zweite wichtige Vorwurf
4
war jener, der dem Volk vorwirft sich aufgrund fehlender ethischer Bindungen über
das Gesetz zu stellen, da dieses für das Volk nicht gelte, sondern allein seine
Launen. Der dritte Vorwurf ist gegen die meisten Institutionen und die Wahl, sowie
das Losverfahren für die Besetzung derselben gerichtet. Zum Beispiel wurde bei der
Volksversammlung die Entscheidungspraxis und bei den Gerichten das
Losverfahren kritisiert. Gerade bei den Richtern und Beamten traf der Vorwurf tief,
daß bei ihrer Wahl oder Auslosung, der Zufall dem Sachverstand zumeist
vorgezogen wurde.
1.4. Vergleich zwischen den Herrschaftsformen in Athen und Rom
Um einen Vergleich führen zu können inwieweit demokratische Elemente sich auch
in der Verfassung der römischen Republik befinden, ist es sinnvoll sich die
Unterschiede der Regierungsformen in Athen und Rom anhand einer Tabelle zu
verdeutlichen:
Athen
Rom
-
-
-
-
-
-
-
Vertrauen in die Urteilskraft des Volkes
Vorrang der kollektiven Meinung vor der
individuellen Meinung
trotz bestehender Censusbedingungen
während des 5. Jh. wurde die aktive
Beteiligung von möglichst vielen Bürgern
an öffentlichen Institutionen durch
verschiedene Einrichtungen gefördert:
durch diverse Losverfahren
durch das Recht eines jeden Bürgers
einen Gesetzentwurf einzubringen
durch die Aufwandsentschädigungen
(Diäten) für die Tätigkeit/ Teilnahme an
den Gerichten, Rats- und
Volksversammlungen
durch kollektive politische Bildung
,,learning by doing" (jeder vierte Athener
im Alter über 30 Jahre gehörte im Laufe
eines Jahrzehnts der an und etwa
sechstausend besuchten die
regelmäßig
-
-
-
-
-
aktive Beteiligung des Bürgers wurde
nie gefördert
nur die angesehensten Bürger waren in
den Konzilen befugt Entscheidungen zu
treffen, obwohl sich an ihnen alle
theoretisch beteiligen konnten
nur die Inhaber von Ämtern, Mitglieder
der Elite waren befähigt,
Gesetzesiniatitiven einzubringen, so daß
die römischen Bürger in den comitien
mit Ja und Nein beantworten konnten,
ohne eine Anhörung oder Ergänzung
durch eine rogatio herbeiführen zu
dürfen
Trennung von beschließenden und nicht
beschließenden Volksversammlungen
(comitia und contiones)
Gegensatz zwischen einer
Entscheidungsbefugnis, die die Elite
tatsächlich in den comitien besaß und
der, der Theorie nach passiven Rolle
der Plebs in den contiones, entspricht
genau der Rollenverteilung von der die
res publica de facto geprägt war
5
Einleitung
Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Diese Behauptung mag zwar zuerst
widersinnig klingen, aber bei eingehender Betrachtung wird sich herausstellen, dass
sie vollends berechtigt ist. Die heutigen Unterschiede der Demokratien sind allein
ein Thema für sich und sollen auch nicht die Thematik dieser Arbeit umfassen, die
sich allein mit dem geistigen und praktischen Hintergrund der attischen Demokratie
des 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., sowie den demokratischen Elementen der
römischen Republik bzw. des späten Prinzipats befassen soll. Dabei wird natürlich
ein Ausblick hin zu den heutigen Formen der Demokratie gewagt werden. Allerdings
kann dieser nur in schwachen Zügen umrissen werden, denn inzwischen sind mehr
als 2500 Jahre vergangen, als sich die früheste nachweisbare Form auf der
attischen Halbinsel entwickelte. Allein dieser Zeitunterschied ist schon fast eine
ausreichende Erklärung für die fundamentalen Unterschiede zwischen der antiken,
insbesondere der attischen Demokratie gegenüber der heutigen Form. Jedoch dazu
später mehr.
2. Demokratiedefinition
Was bedeutet Demokratie eigentlich? Vielfach wird dies heute mit ,,Volksherrschaft"
übersetzt, was jedoch nicht ganz korrekt ist. Demokratie besteht aus den
Wortbestandteilen démos und krátein. Démos steht für das Volk, wobei auch dafür
auch wieder eine Definition notwendig sein wird. Krátein bedeutet aber genau
übersetzt nicht ,,herrschen", sondern steht für ,,Macht inne haben" oder ,,Macht
ausüben". Die korrekte Übersetzung von Demokratie müßte also lauten ,,Macht des
Volkes"
3
Im Unterschied zur Demokratie ist die Oligarchie tatsächlich eine
Herrschaft der Wenigen, da olígoi die Wenigen sind und árchein diesmal korrekt mit
,,herrschen" übersetzt wird.
4
Die Frage die sich nun logischerweise stellt, ist die nach
dem Unterschied zwischen Macht und Herrschaft. Zwei Definitionen Max Webers
mögen eine Annäherung an die Unterschiede gewähren: Macht ist ,,jede Chance,
innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben
durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht. Herrschaft hingegen ,,soll
heißen die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts, bei angebbaren Personen
gehorsam zu finden". Zudem unterscheidet sich Herrschaft von Macht dadurch, daß
sie legitimiert ist.
3
Pabst, A.: Die athenische Demokratie, S. 17.
4
Ebenda.
6
2.1. Legitimation der Demokratie
Diese Legitimation , in diesem Fall bezogen auf die traditionelle Herrschaft der
Antike, beruhte auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher geltenden
Traditionen, worauf sich die Herrschenden beriefen.
Das würde also im Umkehrschluß bedeuten, daß der attischen Demokratie die
Legitimation gefehlt hätte. Was jedoch so nicht stimmt, da - wie man schon sieht
die Legitimation aller anderen Regierungsformen, größtenteils ein Konstrukt aus
Überlieferungen und Traditionen darstellt und die Demokratie der Antike sich
durchaus auch auf Traditionen berief (wie zum Beispiel im Falle Athens Solon als
Gründer der Demokratie und Bewahrer der Traditionen dargestellt wurde). Bei
genauerer Quellenbetrachtung stellt sich heraus, daß er per se zwar nicht der
Gründer der Demokratie war, aber sehr wichtige und bedeutende Anstöße hin zu
ihrer eigentlichen Entfaltung gegeben hatte.
2.2. Wegbereiter der attischen Demokratie Solon
Solon war in der Zeit von 594/93 v. Chr. als ein mit Sondervollmachten
ausgestatteter árchon tätig, der die später für die Demokratie so sozialen und
politischen Reformen durchführte, die aus folgenden Punkten bestanden:
Für die neun hohen Ämter schuf er einen Zensus, der die entsprechend
zugelassenen Personen als ,,Fünfhundertscheffler" bezeichnete (Männer mit
Jahreseinkommen von 22 500 Liter Korn/ 18 000 Liter Öl/ Wein).
Als zweiter wichtiger Punkt seiner Reformen kann die Wahl der Inhaber hoher Ämter
durch die Volksversammlung gelten, zugleich übertrug er der Volksversammlung
gewisse Funktionen der Rechtsprechung (man vermutet zum Beispiel die
Funktionsübernahme als Appellationsinstanz in Gerichtsverfahren).
Der dritte und letzte Punkt seiner Reformen, auch wenn das als nicht ganz gesichert
gelten kann, ist die Einführung eines zweiten Rates, der aus allen Bürgern erlost
wird. Diese Funktion ist allerdings zu diesem Zeitpunkt noch ohne Diäten von den
Erlosten zu erfüllen gewesen.
5
Man sieht also zumindest die Einführung erster demokratischer Elemente durch
Solon, die der zu starken Willkür bei Ämterbesetzungen und
Gerichtsentscheidungen vorbeugen (sollen). Jedoch zurück zur Differenzierung
zwischen Macht und Herrschaft. Das Problem was sich jedoch mit der Definition von
Macht und Herrschaft von Max Weber mit der Übertragung derselben auf die Antike
5
Pabst, A.: Die athenische Demokratie, S. 117.
7
auftut, erklärt sich schon bei der Betrachtung der Begriffe Aristokratie und
Oligarchie.
Demnach wäre bei korrekter Übersetzung die Aristokratie die Macht(aus)übung der
Besten, die nicht legitimiert ist und die Oligarchie die Herrschaft der Wenigen, die
legitimiert wäre. Jedoch ist der Begriff Oligarchie in der Antike schon eindeutig
negativer besetzt als die Aristokratie, da die Wenigen eher für ihr eigenes Wohl
herrschen und die Aristokraten, also die Besten, ihre Regierung zumindest auf
höhere Ziele oder zum Wohlergehen der Gemeinschaft ausüben. Wie kann also
eine im Vergleich zur anderen eindeutig negativer besetzte Regierungsform
gerechtfertigter sein als die andere? Natürlich überhaupt nicht aber dies macht
deutlich, daß die Definitionen Webers nur insofern adäquat sind, wie auch der
Begriff der Legitimität außen vor gelassen wird. Die Übersetzung des
Demokratiebegriffes mit ,,Volksherrschaft" kann demnach als nachträglicher Versuch
gewertet werden, dem Begriff Demokratie per se schon die Legitimität dieser
Herrschaftsform zu implizieren.
Die Fragestellung der Legitimität der antiken Demokratie wird im Verlauf der Arbeit
noch näher erläutert werden. Das Hauptziel hingegen soll es sein, den Gedanken,
der hinter der Demokratie steht, im Spannungsfeld zwischen Ideal und
Verwirklichung, zwischen Befürwortern und Gegnern herauszuarbeiten und
schließlich im Vergleich zwischen der Verwirklichung in Athen und der eventuell
nachweisbaren demokratischen Elemente im Imperium Romanum die Grundidee
der antiken Demokratie und ihren Einfluss auf die heutigen Demokratieformen
nachzuweisen.
Bei der Erwähnung von attischer, athenischer und antiker Demokratie ist
hauptsächlich die der in Athen praktizierten und von dort überlieferten Form der
Demokratie gemeint, einfach, weil die Quellenlage für diese Demokratie am
ergiebigsten ist. Sollten andere Demokratien der Antike gemeint sein, so wird dies
ausdrücklich erwähnt.
Demokratischer Gedanke
3. Realität des demokratischen Athen
Wenn wir die Basis der attischen Demokratie betrachten wollen, kommen wir nicht
umhin uns näher mit dem Volk der Athener zu beschäftigen. Bei diesen handelt es
sich um die Bewohner einer Polis, die als Polites bezeichnet werden. Eine Polis wird
als eine Region, die eine staatliche Einheit bildet und in einer (meist urbanen,
seltener dörflichen) Ansiedlung ihren Mittelpunkt hat (dort Sitz der gesamtstaatlichen
8
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (PDF)
- 9783961161652
- ISBN (Paperback)
- 9783961166657
- Dateigröße
- 884 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Leipzig – Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2017 (September)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- attische Demokratie römische Republik spätes Prinzipat Athen Rom
- Produktsicherheit
- Diplom.de