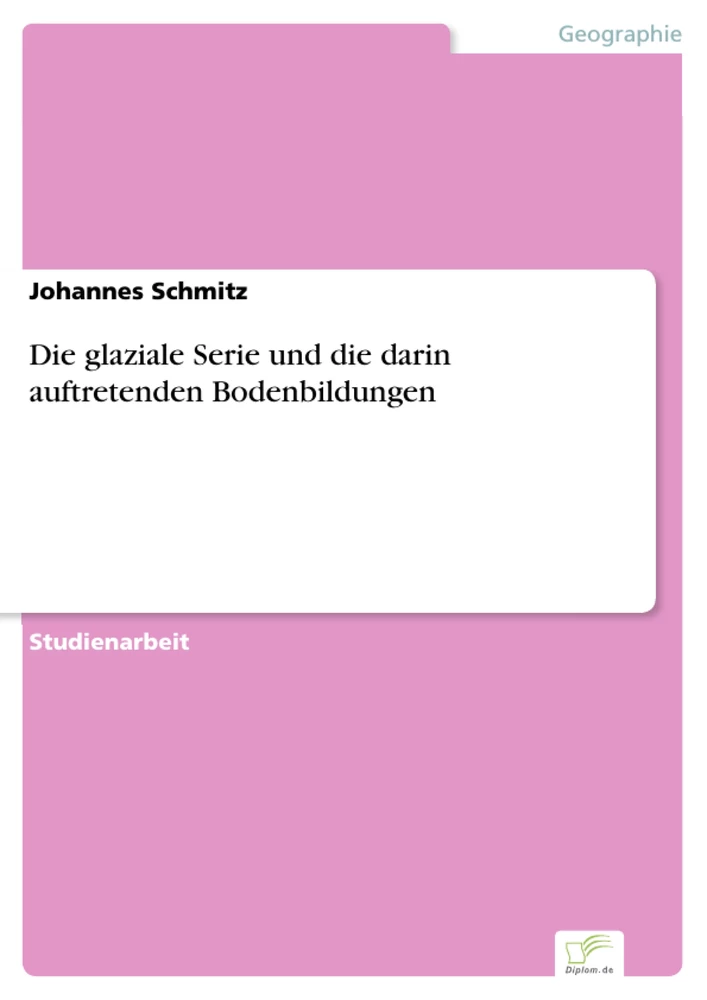Die glaziale Serie und die darin auftretenden Bodenbildungen
©2016
Hausarbeit
24 Seiten
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie befasst sich mit der glazialen Serie, einer Sammelbezeichnung für die idealtypische Anordnung und Abfolge glazialer und glazialfluvialer Formen und Sedimente in Landschaften, deren Relief in der Vergangenheit durch ehemalige Eisrandlagen geprägt wurde. Der Begriff wurde von Albrecht Penck und Eduart Brückner geprägt.
Die Grundmoränenlandschaft ist jene, welche sich in der Nähe des Eisrandes befand und zumeist als kuppige Grundmoräne bezeichnet wird. Sölle, Drumlins, glazialfluviale Kames und Oser sowie Seen, die sich in Schmelzwasserrinnen und Zungenbecken gebildet haben, sind hier vorzufinden. Die Grundmoränenlandschaft ist zumeist durch eine flache, leicht wellige bis kuppige Oberfläche gekennzeichnet, die auch eine Vielzahl von Seen miteinschließt. Das Material, welches der Gletscher im Eis mitgeführt hat, wurde durch das Ausschmelzen unter ihm abgelagert. Das vorliegende Korngrößenspektrum reicht von feinem Sediment (beispielweise Ton und Sand), über Kies bis hin zu großen Gesteinsblöcken (Findlinge). Auf die Grundmoräne folgt die Endmoräne, die die Stillstandphase eines Gletschers kennzeichnet. Die Endmoräne beschreibt die Randlage des Gletschers, sodass sich, aus dem mitgeführten Material des Gletschers, Wälle anhäufen konnten. Dies ist jedoch auch durch das Aufschieben von Material durch den Gletscher zu erklären.
Die Grundmoränenlandschaft ist jene, welche sich in der Nähe des Eisrandes befand und zumeist als kuppige Grundmoräne bezeichnet wird. Sölle, Drumlins, glazialfluviale Kames und Oser sowie Seen, die sich in Schmelzwasserrinnen und Zungenbecken gebildet haben, sind hier vorzufinden. Die Grundmoränenlandschaft ist zumeist durch eine flache, leicht wellige bis kuppige Oberfläche gekennzeichnet, die auch eine Vielzahl von Seen miteinschließt. Das Material, welches der Gletscher im Eis mitgeführt hat, wurde durch das Ausschmelzen unter ihm abgelagert. Das vorliegende Korngrößenspektrum reicht von feinem Sediment (beispielweise Ton und Sand), über Kies bis hin zu großen Gesteinsblöcken (Findlinge). Auf die Grundmoräne folgt die Endmoräne, die die Stillstandphase eines Gletschers kennzeichnet. Die Endmoräne beschreibt die Randlage des Gletschers, sodass sich, aus dem mitgeführten Material des Gletschers, Wälle anhäufen konnten. Dies ist jedoch auch durch das Aufschieben von Material durch den Gletscher zu erklären.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1
1. Aufbau der glazialen Serie
Abbildung 1: Glaziale Serie
Die Glaziale Serie ist eine Sammelbezeichnung für die idealtypische Anordnung und Abfolge
glazialer und glazialfluvialer Formen und Sedimente in Landschaften, deren Relief in der
Vergangenheit durch ehemalige Eisrandlagen geprägt wurde. Der Begriff wurde von Albrecht
Penck und Eduart Brückner geprägt.
Die Grundmoränenlandschaft ist jene, welche sich in der Nähe des Eisrandes befand und
zumeist als kuppige Grundmoräne bezeichnet wird. Sölle
1
, Drumlins
2
, glazialfluviale Kames
3
und Oser
4
sowie Seen, die sich in Schmelzwasserrinnen und Zungenbecken gebildet haben,
sind hier vorzufinden. Die Grundmoränenlandschaft ist zumeist durch eine flache, leicht
wellige bis kuppige Oberfläche gekennzeichnet, die auch eine Vielzahl von Seen miteinschließt.
Das Material, welches der Gletscher im Eis mitgeführt hat, wurde durch das Ausschmelzen
unter ihm abgelagert. Das vorliegende Korngrößenspektrum reicht von feinem Sediment
(beispielweise Ton und Sand), über Kies bis hin zu großen Gesteinsblöcken (Findlinge).
1
Durch das Schmelzen des Toteises sackt die darüberliegende Ablationsmoräne nach und es entstehen Sölle. Sölle
sind meist annähernd kreisrund und trichterförmig, sie können aber auch unregelmäßig geformte Wannen oder
Kessel sein.
2
Drumlins kommen im Ablagerungsbereich von Gletschern vor. Dumlins sind stromlinienförmige Hügel, die aus
Lockermaterial bestehen oder aus fluvialem Schotter von Schmelzwasserflüssen. Ihr Grundriss ist oval und in der
Fließrichtung des Eises gestreckt.
3
,,Kames sind isolierte Schuttablagerungen unter stagnierendem Gletschereis, die nach Abschmelzen des Eises als
Schutthügel im Gelände stehen." (Frank Ahnert 2009, S. 317)
4
,,Oser sind mit den Kames verwandt und erscheinen in der Landschaft als lange, oft gewundene Damme aus
sortiertem, geschichtetem Sand und Kies." (Frank Ahnert 2009, S. 317)
2
Auf die Grundmoräne folgt die Endmoräne, die die Stillstandphase eines Gletschers
kennzeichnet. Die Endmoräne beschreibt die Randlage des Gletschers, sodass sich, aus dem
mitgeführten Material des Gletschers, Wälle anhäufen konnten. Dies ist jedoch auch durch das
Aufschieben von Material durch den Gletscher zu erklären.
Darauf folgt der Sander, bei dem es sich um die Schmelzwassersedimente des Gletschers
handelt. Das Schmelzwasser des Gletschers konnte große Mengen an Ton, Sand und Geröll
fluvial transportieren, die sich hinter der Endmoräne, in der Nähe des Gletschervorlandes,
ablagerten. Mit zunehmender Entfernung zur Endmoräne wird das fluviale Material, aufgrund
seiner Schwere, immer feiner, sodass es nach seiner Korngröße abgelagert wurde. Im
Alpenvorland spricht man nicht, wie in Norddeutschland vom Sander bzw. Sanderflächen,
sondern von Schotterfeldern.
Den Abschluss der glazialen Serie (in Norddeutschland) bildet das Urstromtal, in dem die
vereinigten Schmelzwässer nach Westen (zur Nordsee hin) abflossen. Im Alpenvorland sind
Urstromtäler nicht auffindbar, da die Schmelzwässer in bereits existierende Täler nach Norden
abflossen.
Die Sedimente sowie die Formen der glazialen Serie sind nur in den Jungmoränenlandschaften
aus der WürmWeichselEiszeit
1
zu erkennen, da die Elemente der glazialen Serie der
Altmoränenlandschaften durch eine periglaziale Überprägung meist nicht mehr identifizierbar
sind (Vgl. Zepp 2014, S. 204 f.)
2. Auftretende Substrate und daraus resultierende Bodengesellschaften
2.1 Geschiebemergel
Während des Abschmelzens der weichseleiszeitlichen Gletscher kam insbesondere im
östlichen SchleswigHolstein Geschiebemergel zum Absatz. Geschiebemergel bezeichnet das
zerriebene und überwiegend kristalline Gesteinsmaterial Skandinaviens und des
Ostseebeckens, welches beim Vorrücken des Gletschers in das Eis aufgenommen wurde.
1
Die Weichsel sowie die Würmeiszeit begannen vor etwa 70000 Jahren und beschreiben die verschiedenen Orte,
an denen sie auftraten. Die Weichseleiszeit ist Norddeutschland und die Würmeiszeit Süddeutschland bzw.
konkreter den Alpen zuzuordnen (Vgl. F. Ahnert 2009, S. 321).
3
Dieses Material stammt aus der Kreidezeit und weist einen sehr hohen Carbonatanteil auf.
Häufig liegt schluffreicher und sandiger Lehm vor, in dem sich Kies und Steine von
unterschiedlichem Durchmesser befinden. Das Gesamtporenvolumen
1
des Sedimentes liegt
bei 30 bis 40 Prozent, was bedeutet, dass eine dichte Lagerung der Zerriebsel und
überwiegend feine Poren anzutreffen sind (Vgl. Kuntze 1998, S. 232).
Abbildung 2: Geschiebemergel
Die Bodenbildung auf dem Ausgangssubstrat des Geschiebemergels wurde durch den Rückzug
des weichseleiszeitlichen Gletschers und dem in SchleswigHolstein entstehenden
Permafrostgebiet begünstigt. Durch das stetige Auftauen und Gefrieren des Bodens im
Permafrostgebiet kam es zu kyroklastischen Gesteinszerfall
2
, Frosthub
3
und Eiskeilbildung
4
,
sodass arktische und subarktische Frostmusterböden
5
entstanden, die wiederrum ein
Lockersyrosem (OL) mit den Horizonten Ai/elC ausbilden konnten. Je nach Feuchtigkeit der
Böden können an dieser Stelle auch Tundrengleye oder Moore auftreten (Vgl. Kuntze 1998,
S.232).
Die stetige Erwärmung hatte eine permanente Tieferlegung der DauerfrostObergrenze sowie
die sich stärker verdichtende Tundrenvegetation zur Folge. Letzteres führte zu einer erhöhten
Anreicherung an Huminstoffen, welche durch eine hohe Bioturbation
6
in den Oberboden
gelangen konnten.
1
Das Porenvolumen ist ein Begriff der Bodenkunde und bezeichnet das gesamte, mit Luft oder Wasser gefüllte
Hohlraumvolumen des Bodens.
2
Die Verwitterung durch Volumenvergrößerung des Wassers und der Bildung hoher Drücke beim Gefrieren wird als
Kyroklastik bezeichnet
3
Frosthub ist ein wichtiger Einzelprozess innerhalb der periglazialen Frostdynamik. Frosthub kommt durch das
Wachstum von Eiskristallen senkrecht zur Abkühlungsfront zustande, die überwiegend von oben nach unten in den
Untergrund eindringt.
4
Eiskeile bilden sich in Frostspalten, in denen sich Schnee sammelt. In Tauperioden füllen sich die Spalten mit
Wasser und im Winter gefriert dieses wieder, sodass ein Eiskeil entsteht. Beim Wiederholen dieses Vorganges
vergrößern sich die Spalten.
5
Frostmusterböden sind ein im periglazialen Formungsbereich weit verbreitetes Phänomen des Auftretens
verschiedener Formen der Musterung des Oberflächensubstrats. Oft ist diese Musterung mit einer Sortierung nach
unterschiedlichen Korngrößen verbunden.
6
Bioturbation definiert die Veränderung der Struktur und Zusammensetzung suppiger, weicher und fester
Sedimente durch grabende Organismen.
4
Somit war die Ausbildung eines MulhumusHorizontes möglich, sodass von dem Bodenprofil
einer Pararedzina (RZ) mit den Horizonten Ah/elC gesprochen werden konnte (Vgl. Kuntze
1998, S. 232).
Bereits in den Phasen der Nacheiszeit des Holozäns kam es zur Carbonatauswaschung, die bis
in den Unterboden gereicht haben dürfte. Eine intensivere Entkalkung und eine gleichzeitige
Freisetzung von ResidualTon und Schluff aus den Kalk und Mergelsteinkomponenten des
Geschiebemergels sind auf die stark zunehmende Bewaldung zurückzuführen. Eine zusätzliche
chemische Verwitterung der SilicatMinerale führte zur Neubildung von metallorganischen
Komplexverbindungen und Sesquioxid
1
Mineralien, welche Mineralkörner umschließen und so
zur Verbraunung führen. Eine Verlehmung des vorliegenden Bodens wurde zeitgleich durch die
Gitterbausteine der verwitterten Silicate und deren Glimmermineralien mit einhergehender
KaliumIonenFreisetzung begünstigt. In Folge dessen kam es zur Ausbildung eines Bv
Horizontes, wodurch das Bodenprofil einer Braunerde vorzufinden war (Vgl. Kuntze 1998, S.
232 f.).
Jahreszeitliche und witterungsbedingte Schwankungen führten innerhalb der Braunerde zur
Schrumpfung der Tonminerale im BvHorizont sowie zur Entstehung eines Krümelhorizontes
im Zusammenhang mit der Tätigkeiten von Bodenorganismen im AhHorizont. Die
zunehmenden Temperaturen und die dichter werdende Vegetation bewirkten eine
Tondurchschlämmung und Lessivierung. Die Voraussetzung hierfür wurde erst durch eine
Entbasung des Sorptionskomplexes im Oberboden, welche die Erniedrigung des pHWertes auf
6,5 bis 5,0 nach sich zog und somit die Dispergierung
2
der Bodenkollide in den Unterboden
ermöglichte, geschaffen. Neben Tonmineralen, Huminstoffen und Silicatmineralien waren auch
braune Sesquioxide an der Durchschlämmung beteiligt. Diese Feinsubstanzverluste bewirkten,
im weiteren zeitlichen Verlauf, die Aufhellung des Oberbodens und die Ausbildung eines Al
Horizontes. Die starke Versauerung des Horizontes rief eine hohe Mineralverwitterung hervor,
die eine stärkere Verbraunung in silicatreichen Substraten ermöglichte. So entstanden die
Horizonte Al und Bv. Der darauffolgende Prozess zur Genese einer Parabraunerde, mit dem
Bodenprofil Ah/Al/Bt/Bv/elC, war die Bildung eines Tonanreicherungshorizontes (Bt). Die
Gelegenheit zur Bildung dieses Horizontes gaben Unterböden mit hohen pHWerten und hoher
Basensättigung, verlangsamte Wasserbewegungen und zeitgleiche Ausflockungen der im
Sickerwasser transportierten Bodenkollide
3
sowie der stagnierende Prozess der
Tonverlagerung durch Austrocknung oder endende Poren und Risse. Der BtHorizont der
Parabraunerde ist gekennzeichnet durch einen höheren Tongehalt als der AlHorizont, eine
rötliche Färbung durch die Anreicherung von Eisenoxiden, einem überprägten
Makrogrobgefüge
4
und Tonbelägen (Vgl. Kuntze 1998, S. 233).
1
Sesquioxide sind im Boden meist nebeneinander vorkommenden Oxide, Hydroxide und Oxidhydroxide des Eisens,
Mangans und Aluminiums.
2
Die Dispergierung beschreibt die Zerlegung in Primärteilchen durch Entsalzung, Entkalkung, Art der Tonminerale
und ist ein Teilprozess der Tonverlagerung. Die Lessivierung wird durch den Vorgang der Dispergierung gesteuert.
3
Bodenkolloide sind fein verteilte Stoffe im Boden (z.B. Huminstoffe, Tonminerale und Sesquioxide), weisen
aufgrund besondere physikalische Eigenschaften auf und haben den größten Anteil an der Austauschkapazität des
Bodens.
4
Makrogrobgefüge, entstehen durch Absonderungsprozesse, wie Wechsel von Quellung und Schrumpfung, in
bindigen Böden.
5
Durch eine saure Nadelauflage, die aufgrund der hohen Bewaldung entstand, kam es in
Bereichen des gemäßigthumiden Klimas, auf sandreichem und wasserdurchlässigem
Geschiebemergel, zur beinahe vollständigen Entbasung mit daraus resultierenden pHWerten
von unter 4,0. Dies hatte eine Beschleunigung der Verwitterung von primären Silicaten und
Tonmineralen zur Folge, sodass freie AluminiumIonen innerhalb des Bodens vorlagen. Dies
behinderte die weitere Tondurchschlämmung des Bodens und begünstigte somit letztlich die
Ausbildung einer stark sauren Fahlerde mit folgendem Bodenprofil: Ah/Ael/Bt/elC (Vgl. Kuntze
1998, S. 233).
In humiden und gemäßigten Klimaten hatte die Tonanreicherung im Unterboden eine starke
Verstopfung der Bodenporen zur Folge. Diese sogenannte ,,Einlagerungsverdichtung" sorgte
für eine zunehmende Vernässung des Bodens, die sich durch deren Intensivierung (z.B. durch
winterliche Nassphasen) und einen temporären Luftmangel äußerte. Während solcher
Nassphasen konnten Eisen und Manganoxide reduziert und verlagert werden. Typisch für
diese Verlagerung sind gebleichte und an Sesquioxid verarmte (Ober)Bodenbereiche. Bei
abnehmender Bodenfeuchte kam es anschließend zur Oxidierung von noch vorhandenen oder
lateral hinzugefügten Einsen und ManganVerbindungen aufgrund allmählicher Luftfüllung
großer Bodenporen, sodass unregelmäßige, fleckenhafte Rostflecken auftraten. An größeren
Holräumen (z. B. Risse, Klüfte oder Wurzeln) kam es zur erhöhten Wasserbewegung zur Zeit
der Nassphasen. Daher ließen sich an solchen Holräumen die Reduktion und Fortfuhr der
Sesquioxide durch hellgraue und verarmte Randzonen erkennen. Die Oxidation und Reduktion
der Sesquioxide verlieh dem Boden das besondere, marmorierte und rostfleckige Aussehen.
Böden, die durch Staunässe und hydromorphe
1
Merkmale entstehen, nennt man Pseudogleye.
Ein FahlerdePseudogley, wie in Abbildung drei zu sehen, entstand, wenn die Prozesse der
Hydromorphierung in den Horizonten der Fahlerde abliefen. So war ein wasserleitender und
rostfleckiger AelSwHorizont und ein verdichteter, wasserstauender sowie marmorierter Bt
SdHorizont zu sehen (Vgl. Kuntze 1998, S. 234).
Die auf dem Geschiebemergel entstandenen, unterschiedlichen Bodentypen wurden
anthropogen im Kontext der menschlichen Besiedlung umgestaltet. Die Vegetation wurde
allmählich zerstört, nicht zuletzt wegen vermehrtem Bedarf an Bau und Brennholz sowie
benötigter landwirtschaftlicher Nutzflächen, sodass der Boden langsam, aufgrund der
fehlenden Pumpwirkung, durchnässte. So kam es in besonders feuchten Lagen zur Entstehung
von Mooren (Vgl. Kuntze 1998, S. 234).
Durch die vermehrte Abholzung der Vegetation wurde letztlich eine sekundären
Vegetationsform
2
begünstigt: Nadelholz und insbesondere Heidevegetation. Die Streu dieser
Sekundärvegetation ist nur schwer zersetzbar, nährstoffarm und führte zu einer starken
Versauerung des Bodens. Hierdurch wurde die Nährstoffversorgung des Bodens behindert,
sodass sich eine stark saure und torfähnliche Auflageschicht ausbildete. Durch die
versickernden Niederschläge resultierten hieraus stark saure und niedermolekulare
Verbindungen, die sich in den Ah und AlHorizonten anreicherten, die arm an Ton waren und
dort eine hohe Verwitterung der vorliegenden Silicate hervorriefen.
1
Hydromorphe Böden sind grundwasserbeeinflusste Böden. Zu ihnen gehören Gleye, Anmoore und Niedermoore
2
Die Sekundärvegetation tritt nach Zerstörung der vorhergehenden Primärvegetation auf. Hier wird von einer
natürlichen und nicht anthropogen angelegten Sekundärvegetation gesprochen.
Die dabei entstandenen Eisen, Mangan und AluminiumVerbindungen wanderten als organo
mineralische
1
Komplexverbindungen mit dem Sickerwasser abwärts (Vgl. Kuntze 1998, S. 234).
6
Dadurch hinterließen sie einen zunehmenden und silicatarmen (in seltenen Fällen silicatfreien)
AeHorizont. Die transportierten Stoffe gelangten dann in silicatreichere Bereiche mit höheren
pHWerten und basischen Kationen, wo sie durch Aufnahme weiterer Aluminium und Eisen
Ionen und durch Oxidation ausgefällt wurden. Diese Ausfällungsprodukte umrahmten im Laufe
ihrer Anreicherung Mineralkörner. Diese sind mikroskopisch als ,,dunkle Rinde" an den
Mineralkörnern zu erkennen. Dieses sogenannte ,,Hüllengefüge" ist typisch für Bsh und Bhs
Anreicherungshorizonte. Dieser Prozess wird auch Podsolierung genannt, tritt jedoch auf
Geschiebemergeln sehr selten auf. Ebenso selten findet man dementsprechend den daraus
erfolgenden Bodentyp des Podsols. Unter Sekundärvegetation weist er folgende
Bodenhorizonte auf: L/Of/Oh/Ah/Ae/Bhs/C. In Gebieten mit Laubwald tritt die Podsolierung
nur sehr selten auf (Vgl. Kuntze 1998, S.235).
Die hier beschriebenen Bodenbildungsprozesse auf dem Ausgangssubstrat des
Geschiebemergels unterliegen in der Natur zahlreichen Faktoren. Sofern einer dieser
(ausschlaggebenden) Faktoren nicht oder verändert auftritt, kann die Bodenbildung
anderweitig verlaufen oder gar stagnieren. Somit stellt die unten stehende Abbildung
bodenbildende Prozesse da, die auftreten können, aber nicht zwangsläufig auftreten werden
oder bereits aufgetreten sind (Vgl. Kuntze 1998, S. 235).
Abbildung 3: Bodenbildende Prozesse auf Geschiebemergel
1
Organomineralische Verbindungen sind eine Verbindung zwischen mineralischen (anorganischen) und
organischen Stoffen. Die Komplexe entstehen aufgrund von ionischen Bindungen, Wasserstoffbrückenbindungen
und/oder einem DipolCharakter.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783961161713
- ISBN (Paperback)
- 9783961166718
- Dateigröße
- 3.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Koblenz-Landau – Geographie
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Oktober)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Sedimente Glaziale Serie Grundmoräne Eis Gletscher
- Produktsicherheit
- Diplom.de