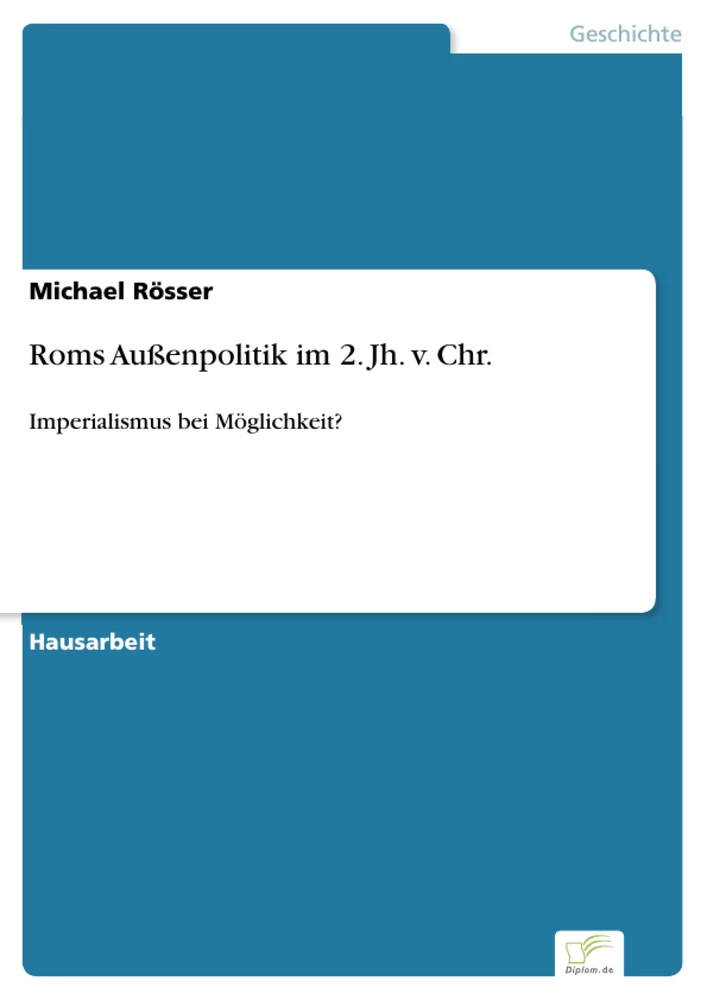Roms Außenpolitik im 2. Jh. v. Chr.
Imperialismus bei Möglichkeit?
©2011
Hausarbeit
20 Seiten
Zusammenfassung
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, welchen Prinzipien die römische Eroberung des östlichen Mittelmeerraumes folgte und ob diese Expansion eher einem defensiven oder einem hegemonialen Charakter zuzuordnen ist.
Dabei wird zunächst geklärt, ob Rom als Gesamtgesellschaft generell an einer stetigen Machtausweitung interessiert war. Danach wird die Bedeutung der Administration zur Herrschaftsausübung dargestellt und skizziert, ob und unter welchen Voraussetzungen Rom gewillt war diese Form der direkten Herrschaft auszuüben. Die anschließende Analyse der Makedonischen Kriege, des römisch-syrischen Kriegs sowie Roms Vorgehen beim Erbe Attalos III werden das römische Handlungsprinzip in der Außenpolitik im zweiten Jh. v. Chr. deutlich werden lassen.
Dabei wird zunächst geklärt, ob Rom als Gesamtgesellschaft generell an einer stetigen Machtausweitung interessiert war. Danach wird die Bedeutung der Administration zur Herrschaftsausübung dargestellt und skizziert, ob und unter welchen Voraussetzungen Rom gewillt war diese Form der direkten Herrschaft auszuüben. Die anschließende Analyse der Makedonischen Kriege, des römisch-syrischen Kriegs sowie Roms Vorgehen beim Erbe Attalos III werden das römische Handlungsprinzip in der Außenpolitik im zweiten Jh. v. Chr. deutlich werden lassen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1
1. Der Charakter der römischen Außenpolitik
Karl Christ stellt die römische Außenpolitik im hellenistischen Osten im zweiten
Jahrhundert v. Chr. wie folgt dar: Es fehlte an einem Gesamtkonzept zur
römischen Machtexpansion über den gesamten Mittelmeerbereich. Ferner war
Rom auch nicht an einer direkten Machtübernahme interessiert.
Rom habe sich
seit seinem Entstehen mit der Bekämpfung seiner Nachbarvölker konfrontiert
gesehen und dieses defensive Handlungsprinzip sei mit der Ausweitung des
Machtbereiches stets nur fortgeführt worden.
1
Es sei ,,missverständlich, die
römische Politik als ´imperialistisch´ zu bezeichnen".
2
Im Gegensatz zu Christ ist für William Harris die Ausweitung des Machtbereichs
über andere Völker und Landschaften ein Grundprinzip der römischen
Gesellschaft
3
und ,,no accidental growth".
4
Im Zentrum der Arbeit steht also die Frage, welchem Prinzip die römische
Eroberung des östlichen Mittelmeerraumes folgte und ob diese Expansion eher
einem defensiven oder einem hegemonialen Charakter zuzuordnen ist.
Dabei soll zunächst geklärt werden, ob Rom als Gesamtgesellschaft generell an
einer stetigen Machtausweitung interessiert war. Danach wird die Bedeutung der
Administration zur Herrschaftsausübung dargestellt und skizziert, ob und unter
welchen Voraussetzungen Rom gewillt war diese Form der direkten Herrschaft
auszuüben. Die anschließende Analyse der Makedonischen Kriege, des römisch-
syrischen Kriegs, sowie Roms Vorgehen beim Erbe Attalos III werden das
römische Handlungsprinzip in der Außenpolitik im zweiten Jh. v. Chr. deutlich
werden lassen.
Meine Ausführungen über die Außenpolitik stützen sich vor allem auf die Werke
von William Harris und Sherwin-White. In wichtigen Teilbereichen (vor allem
Punkt 3 und 4.3) werden diese durch weitere Spezialliteratur ergänzt, sowie durch
Standardwerke gestützt. Komplettiert wird das Forschungsergebnis durch die
Konsultation antiker Geschichtsschreiber. Am aufschlussreichsten waren dabei
ausgewählte Biographien von Plutarch. Weitere Aspekte stützen sich auf die
Geschichtsschreibungen von Polybios und Livius.
1
Vgl. Christ, Karl: Krise und Untergang der Römischen Republik, Darmstadt 1993, S. 64 f.
2
Christ, Karl: Krise und Untergang der Römischen Republik, Darmstadt 1993, S. 66.
3
Vgl. Harris: War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 B.C., Oxford 1979, S. 1-7.
4
Harris: War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 B.C., Oxford 1979, S. 2.
2
2. Das römische Interesse an der Expansion
2.1 Römisches Hegemonialbestreben in allen Bevölkerungsschichten
Innerhalb der Aristokratie war das Bestreben in immer höhere Ämter aufzusteigen
stets präsent.
5
Um bei der Ämterlaufbahn immer weiter aufzusteigen, war
militärischer Erfolg ein sehr wirksames Mittel. Zum einen brachte es dem
Individuum eine Menge Prestige ein und zum anderen galt ein fähiger Feldherr
auch als kompetenter Staatsmann.
6
Erfolg in der Kriegsführung wurde darüber
hinaus als moralischer Wert für die Gesellschaft angesehen und solch eine
Stellung half sich von der normalen Masse abzuheben und wurde mit Ruhm
belohnt.
7
Dieser allein half nicht nur Wahlen zu gewinnen, sondern wirkte sich
auch positiv auf die Finanzen aus. Ein großes Vermögen half wiederum bei der
Finanzierung von Wahlkämpfen, was den Wahlausgang mit beeinflusste.
8
Diese Ideologie ,,was such that it required the opportunities offered by war to be
more or less continually available"
9
und ist demnach ein eindeutiges Indiz dafür,
dass die römische Führungsschicht ein stark ausgeprägtes Interesse an
Kriegsführung hatte.
Der Wille des einfachen Volkes Krieg zu führen ist natürlich weniger
entscheidend als in den führenden Schichten
10
. Dennoch gibt es genug Hinweise
dafür, dass das römische Volk ebenfalls ein ausgeprägtes Interesse am Krieg
hatte. Zunächst ist festzustellen, dass der Ruhm eines erfolgreichen Krieges auch
diejenigen geehrt hat, die in der Heimat verblieben waren und wenn ein
erfolgreicher Krieg führenden Personen Prestige einbringt, versteht es sich von
selbst, dass dieses Prestige einer Bewunderung durch das Volk gleichkommt.
11
Darüber hinaus benötigt ein erfolgreiches Heer immer Menschen, die sich bereit
erklären für das Militär zu dienen. Die Motivation sich für einen Militärdienst im
römischen Reich zu verpflichten resultiert daraus, dass stets die Hoffnung auf
Beute sowie Zugewinn von Land bestand.
12
Weitere Aspekte sind Patriotismus,
5
Für das folgende Vgl. steht: Harris: War and Imperialism.
6
Vgl. S. 10 f.
7
Vgl. S. 30.
8
Vgl. Polyb. VI 9, 6-8.
9
Harris: War and Imperialism, S. 34.
10
Vgl. S. 41.
11
Vgl. Plut. Aem. 11.
12
Vgl. Rosenstein, Nathan: Recruitment and Ist Consequences for Rome and the Italian Allies, S.
239, in: Jehne, Martin/ Pfeilschifter, Rene: Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in
republikanischer Zeit. Frankfurt a.M. 2006, S. 227-243.
3
sowie die Bereitschaft, ein hartes Leben in der Landwirtschaft gegen das eines
Legionärs zu tauschen.
13
Die allgemeine Kriegsbereitschaft der gesamten römischen Bevölkerung und ihr
ausgeprägtes Interesse daran lässt sich nach Harris besonders gut an ihrer
Kontinuität feststellen: es verging fast kein Jahr, in dem nicht Krieg geführt
wurde. Harris geht sogar soweit zu sagen, dass der Wille Gewalt einzusetzen
charakteristisch für Rom war und sogar pathologische Züge aufwies.
14
2.2 Ökonomische Gründe für den Imperialismus
Materieller Gewinn war ein essenzieller Bestandteil des römischen Verständnisses
von Krieg und Expansion. Steuern, Land, Beute und Sklaven lagen dabei im
Zentrum der Begierde.
15
Neben diesen sehr allgemeinen Zielen der Kriegsführung gibt es für das zweite
Jahrhundert v. Chr. mehrere Indizien für rein ökonomisch motivierte
Kriegsführung. Nach dem zweiten Punischen Krieg war der römische Staat hoch
verschuldet und konnte schließlich durch die Beute, die Manlius Vulso aus Asia
brachte, konsolidiert werden.
16
Ab dem Jahr 146 v. Chr. wurden außerdem immer
mehr luxuriöse Gebäude errichtet und mehr für den öffentlichen Bereich
ausgegeben.
17
Nach der Einrichtung der Provinzen Macedonia 146 v. Chr. und der
Provinz Asia nach der Erbschaft Pergamons 133 v. Chr. wurden hohe Stellungen
in der Verwaltung vor allem deshalb angestrebt, um sich selbst zu bereichern.
18
Aber nicht nur der Staat und die Führungsschichten profitierten von einem Krieg.
Man darf nicht vergessen, dass eine Armee Ausrüstung benötigt, die hergestellt
und an den Mann gebracht werden muss. Das hat zur Folge, dass die
handwerklichen Betriebe und Händler während Kriegszeiten mit einem
Profitzuwachs rechnen konnten.
19
Wenn man bedenkt, dass das römische Reich vom dritten Jahrhundert v. Chr. bis
zum ersten Jh. v. Chr. eine enorme Expansion erfuhr, ist es nicht verwunderlich,
13
Vgl. S. 48.
14
Vgl. S 53.
15
Vgl. S. 56.
16
Vgl. S. 70.
17
Vgl. S. 72 f.
18
Vgl. S. 77 ff.
19
Vgl. S. 93 ff.
4
dass sich mit seiner Fläche auch das Wirtschaftssystem veränderte.
20
Sklaven
waren für die Agrarwirtschaft der Großgrundbesitzer und beispielsweise in den
Silberminen in Spanien ein integraler Bestandteil geworden und jegliche Form
von Krieg begünstigte die ausreichende Versorgung Roms mit diesen
,,Arbeitskräften".
21
Einen Aspekt, den wir später noch betrachten werden, ist die Diskrepanz
zwischen der römischen Hegemonie im gesamten Mittelmehrraum einerseits und
den fehlenden direkten administrativen Strukturen, vor allem in den Provinzen,
andererseits.
22
Dieses Bindeglied nahmen in (fast) allen wirtschaftlichen und
finanziellen Bereichen seit dem 3. Jh. v. Chr die Publicani ein.
23
Dem-
entsprechend groß war ihr machtpolitischer Einfluss und Interesse an der immer
weiterführenden Expansion des römischen Reiches, zum Zwecke der wirtschaft-
lichen Ausbeutung.
24
20
Vgl. Bellen, Heinz: Grundzüge der römischen Geschichte. Teil 1. Von der Königszeit bis zum
Übergang der Republik in den Prinzipat, Darmstadt 1995, S. 88 ff.
21
Vgl. S. 80-85.
22
Vgl. Christ: Krise und Untergang, S. 79-82.
23
Andreau, Jean übersetzt von Externbrink, S.: DNP II (2001), sp. 575-578, Sv. Publicani.
24
Vgl. S. 93 ff.
5
3. Herrschaft und Administration
3.1 Die Bedeutung des Straßenbaus und der Administrativen Einrichtungen
In seinem Artikel ,,How is the Empire" legt Rene Pfeilschifter mit Fokus auf
Italien dar, welche Rolle das Wissen des Senats um die römischen Kolonien
hatte.
25
Er charakterisiert dabei Rom bereits im dritten und zweiten Jahrhundert
als Empire ,,ein Herrschaftsgebiet, das von einem Gemeinwesen kontrolliert
wird, selber aber nicht in dieses Gemeinwesen integriert ist".
26
Schon vor der
Expansion Roms über den gesamten Mittelmeerraum war es für die Römer von
besonderer Bedeutung die langsame Nachrichtenübermittelung durch den
systematischen Straßenbau zu beschleunigen, um somit die Kolonien besser an
das Zentrum binden zu können. Dabei spielten natürlich auch militärische und
sozioökonomische Aspekte eine Rolle.
27
Die zentrale Bedeutung der Straßen ist
gut daran zu erkennen, dass beispielsweise die Provinz Asia entlang wichtiger
Handelsstraßen und zur Verbindung wichtiger Versammlungsorte eingerichtet
wurde.
28
Waren diese noch nicht vorhanden, so wurden sie im Falle Asias schon
vom ersten Gouverneur M. Aquillius zwischen 129 und 126 v. Chr. geschaffen.
29
,,The ability of the Romans to control Anatolian affairs depended upon the
effectiveness of their diplomatic system"
30
und so wurden die funktionstüchtigen
administrativen Strukturen der Provinz Asia weitestgehend von den zuvor
herrschenden Mächten übernommen und wenn nötig ergänzt. Darunter fallen
Einrichtungen wie Diözesen und Assisengerichte.
31
Dass der verwaltende - und damit herrschende - Arm Roms nicht zu hundert
Prozent über die Straßen und Ballungszentren hinausreichte zeigt die besondere
Bedeutung der Administration zur Machtausübung.
32
25
Vgl. Pfeilschifter, Rene: `How is the Empire?´. Roms Wissen um Italien im dritten und zweiten
Jahrhundert v. Chr. In: Jehne, Martin/ Pfeilschifter, Rene: Herrschaft ohne Integration? Rom und
Italien in republikanischer Zeit, Frankfurt a.M. 2006, S. 111-139.
26
Doyle, Michael W. : Empires, S. 112, in : Cornell Studies in Comparative History, New York
1986. S. 30-47. Zitiert nach Pfeilschifter, Rene: `How is the Empire?`.
27
Vgl. Pfeilschifter: ´How is the Empire?`, S. 120 f.
28
Vgl. Mitchell, Stephen: The Administration of Roman Asia from 133 BC to AD 250, S. 20-24,
in: Eck, Werner: Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen
Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, München 1999, S. 17-46.
29
Vgl. Mitchell: The Administration of Roman Asia. S, 18 f.
30
Sherwin-White, A.N.: Roman Foreign Policy in the East. 168 B.C. to A.D.1, London 1984.
S. 55.
31
Vgl. Mitchell: The Administration of Roman Asia. S, 22-25.
32
Vgl. Mitchell: The Administration of Roman Asia. S, 45 f.
6
Es wird außerdem klar, dass den Städten bei der Verwaltung eine Schlüsselrolle
zukam, besonders wenn es sich um Steuereinnahmen und Verwaltung handelte.
Diese funktionierte über lokale Gouverneure und Publicani, die mit den Städten
zusammenarbeiteten. Generell lässt sich sagen, dass es Rom nicht besonders
interessierte, mit wem sie arbeiteten oder wo eine Kooperation notwendig war,
solange die Provinzen ihre Pflichten in materieller oder politischer Hinsicht
erfüllten.
33
3.2 Der Senat: Kein Wille zur Annektierung, aber zur Hegemonie?
Wie soeben dargelegt stellte die Verwaltung des Weltreiches ein effizientes und
zentrales Element zur Herrschaftsausübung dar. Allerdings wirft diese besondere
Bedeutung einige Fragen auf, wenn man bestimmte geschichtliche Ereignisse
genauer betrachtet. Zwischen der Entscheidungsschlacht bei Pydna 168 v. Chr. im
dritten Makedonischen Krieg und der Einrichtung der Provinz Macedonia im
Jahre 146 v. Chr. vergingen beispielsweise genau 22 Jahre.
34
Weshalb blieb hier
eine direkte Herrschaftsausübung so lange aus? Diese Frage hat in der Forschung
viele Kontroversen ausgelöst.
35
Harris ist dabei der Meinung, dass der Senat auf jeden Fall gewillt war,
Annexionen durchzuführen, solange diese möglich waren und Profit
versprachen
36
. Annexionspläne wurden stets realistisch gesehen und ob ein Gebiet
nun offiziell zum römischen Reich gehörte, oder ob über dieses Gebiet nur
praktisch Macht in einem indirekten Sinne ausgeübt wurde, war nicht von
Belang
37
. Denn von den seltenen Fällen, in denen von Annexion abgesehen wurde
geschah dies zum Vorteil Roms und war auch nur eine von vielen Formen der
Machtausübung.
38
Im oben genannten Fall der nicht erfolgten Annektierung vom späteren Gebiet der
Provinz Macedonia sollen nun noch die Gründe angeführt werden, warum Rom
von einer direkten Machtübernahme so lange absah. Zunächst hatte Flamininus
33
Vgl. Mitchell: The Administration of Roman Asia. S, 30f.
34
Vgl. Christ: Krise und Untergang. S, 52 ff.
35
Vgl. Harris: War and Imperialism, S. 131 ff.
36
Vgl. Harris: War and Imperialism, S. 105.
37
Harris: War and Imperialism, S. 105.
38
Harris: War and Imperialism, S. 133 ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (PDF)
- 9783961161379
- Dateigröße
- 256 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Regensburg – Geschichte
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- Rom Antike Roms Außenpolitik Imperialismus
- Produktsicherheit
- Diplom.de