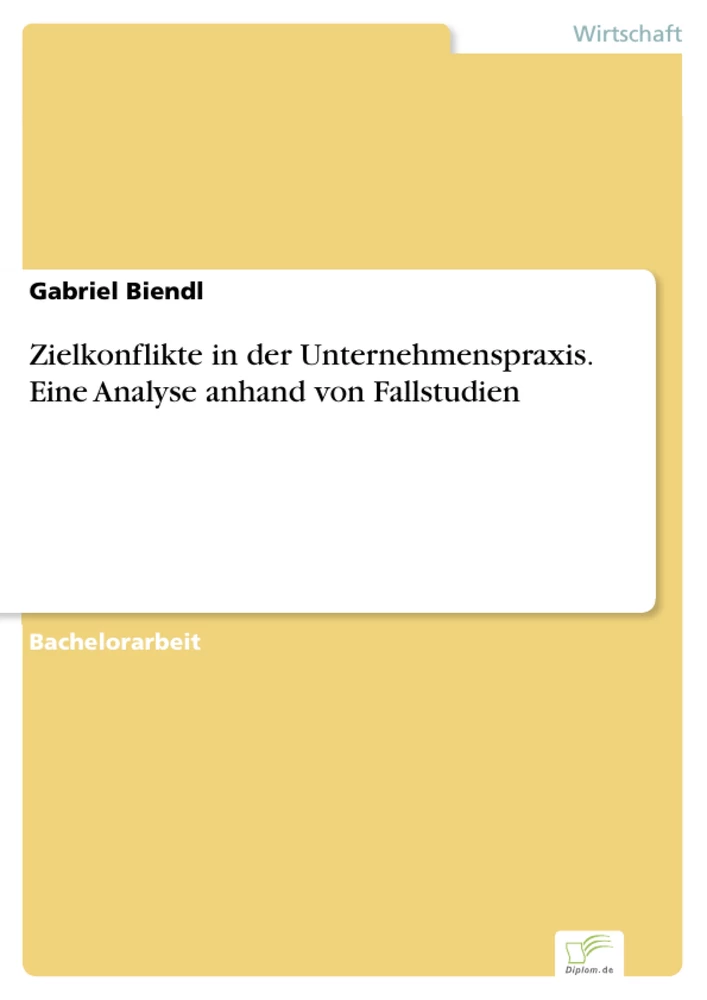Zielkonflikte in der Unternehmenspraxis. Eine Analyse anhand von Fallstudien
©2016
Bachelorarbeit
52 Seiten
Zusammenfassung
Zielkonflikte sind Ziele, die einen negativen Einfluss aufeinander haben. Konzentriert man sich auf das Erreichen eines Zieles, leidet darunter das andere. Diesen Konflikten sind Unternehmen ausgesetzt. Sie müssen entscheiden, auf welche Ziele sie den Fokus legen, und dies dann auch in der Gesellschaft vertreten. Der Zielkonflikt eines Unternehmens schlechthin ist das Kunststück des Spagats zwischen der Maximierung des Gewinns und dem moralisch „guten“ Handeln. Nachhaltigkeit ist hier das Stichwort, worunter man Umweltschutz, die Einhaltung ethischer Grundsätze, gute Arbeitsbedingungen und ähnliches zusammenfassen kann.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Der erste, theoretische Teil ist grundlegend für die Analyse der drei ausgewählten Unternehmen im Hinblick auf ihr Nachhaltigkeitsmanagement und die Diskussion der Unterschiede und Gemeinsamkeiten im zweiten Teil der Arbeit.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Der erste, theoretische Teil ist grundlegend für die Analyse der drei ausgewählten Unternehmen im Hinblick auf ihr Nachhaltigkeitsmanagement und die Diskussion der Unterschiede und Gemeinsamkeiten im zweiten Teil der Arbeit.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1
Einleitung... 1
2
Zweck und Ziele eines Unternehmens ... 3
2.1
Unternehmenszweck ... 3
2.2
Ziele eines Unternehmens ... 3
2.2.1
Gewinnprinzip ... 3
2.2.2
Zufriedenstellung aller beteiligten Gruppierungen... 4
2.2.2.1
Shareholder... 4
2.2.2.2
Stakeholder ... 4
2.2.3
Mögliche Beziehungen zwischen Unternehmenszielen ... 6
2.2.3.1
Neutrale Ziele ... 7
2.2.3.2
Komplementäre Ziele ... 7
2.2.3.3
Konkurrierende Ziele bzw. Zielkonflikte ... 7
3
Der kritische Blick der Gesellschaft auf Unternehmen... 8
3.1
Kritische Sicht des Gewinnprinzips ... 8
3.2
Schwindendes Vertrauen gegenüber Unternehmen ... 8
4
Vertrauensfördernde Maßnahmen von Seiten der Unternehmen ... 10
4.1
Corporate Social Responsibility... 10
4.2
Corporate Governance ... 13
4.3
Corporate Citizenship... 13
5
Gewinn versus gesellschaftliche Verantwortung Ein Zielkonflikt ... 14
5.1
Gewinnprinzip und moralische Qualität ... 14
5.2
Unternehmensinteressen und Gesellschaftsinteressen ... 16
5.3
Shareholder Value vs. Stakeholder Value... 17
6
Nachhaltigkeit als Überbegriff ,,guten Handelns"... 18
6.1
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit ... 18
6.1.1
Ökologische Nachhaltigkeit... 18
6.1.1.1
Begriffsdefinition ... 18
6.1.1.2
Ressourcenmanagementregeln ... 19
6.1.1.3
Ökologische Erwartungen der Stakeholder ... 20
6.1.2
Soziale Nachhaltigkeit ... 21
6.1.2.1
Begriffsdefinition ... 21
6.1.2.2
Soziale Erwartungen der Stakeholder ... 22
6.1.3
Ökonomische Nachhaltigkeit... 23
6.1.3.1
Begriffsdefinition ... 23
6.1.3.2
Bedingungen für die Umsetzung der ökonomischen Nachhaltigkeit ... 24
6.1.3.3
Ökonomische Erwartungen der Stakeholder ... 25
7
Analyse des Nachhaltigkeitsmanagements ausgewählter Unternehmen ... 26
7.1
Analyse anhand der Allianz SE... 26
7.1.1
Selbstdarstellung und Ziele der Allianz SE ... 26
7.1.2
Vorfälle und Kritik von außen ... 28
7.1.3
Persönliche Einschätzung ... 30
7.2
Analyse anhand der VW AG... 32
7.2.1
Selbstdarstellung und Ziele der VW AG ... 32
7.2.2
Vorfälle und Kritik von außen ... 34
7.2.3
Persönliche Einschätzung ... 35
7.3
Analyse anhand der Henkel AG & Co. KGaA ... 36
7.3.1
Selbstdarstellung und Ziele der Henkel AG & Co. KGaA ... 36
7.3.2
Vorfälle und Kritik von außen ... 38
7.3.3
Persönliche Einschätzung ... 38
7.4
Zusammenfassung... 39
8
Resümee ... 40
9
Literaturverzeichnisse ... 41
9.1
Bücher- und Zeitschriftenverzeichnis ... 41
9.2
Internetquellenverzeichnis ... 45
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schichtenmodell der Stakeholder eines Unternehmens nach Stapleton... 5
Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Tradeoffs... 7
Abbildung 3: Vertrauen der Deutschen in Unternehmen von 2008-2014 ... 9
Abbildung 4: Vertrauensvergleich zwischen 2014 und 2015... 9
Abbildung 5: CSR-Pyramide nach Carroll ... 11
Abbildung 6: Der Zielkonflikt zwischen Gewinn und Moral... 15
Abbildung 7: Unternehmen als Akteure in einem Tradeoff ... 16
Abbildung 8: Herausforderungen und wesentliche Handlungsfelder des VW-Konzerns . 33
Abbildung 9: Henkel: "Unsere Fokusfelder und Fünfjahresziele 2011 bis 2015"... 37
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Stakeholder und ihre ökologischen Interessen ... 21
Tabelle 2: Stakeholder und ihre sozialen Interessen... 23
Tabelle 3: Stakeholder und ihre ökonomischen Interessen ... 25
Tabelle 4: Vorwürfe gegenüber der Allianz und ihre Reaktionen darauf... 30
Abkürzungsverzeichnis
bspw.
beispielsweise
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
CSR
Corporate Social Responsibility
etc.
et cetera
HV
Hauptversammlung
VW
Volkswagen
z.B.
zum Beispiel
1 Einleitung
Dies ist der Anfang eines erst kürzlich erschienenen Artikels namens ,,Richtig oder nur
nützlich?" aus Der Zeit vom 06.01.2016 (Beschorner, 2016).
1
Wie werden sich Unternehmen im Tradeoff zwischen Gewinnprinzip und moralischer
Verantwortung verhalten? Kommen Einbußen im Gewinn zu Gunsten unserer Umwelt
überhaupt in Frage?
Auf dieses Thema und die damit zusammenhängenden Fragen möchte ich in dieser Arbeit
eingehen. Dafür stelle ich zuerst die beiden Beteiligten vor: Das Unternehmen auf der
einen Seite und die Gesellschaft auf der anderen. Ich stelle Zweck und Ziele, insbesonde-
re das Gewinnprinzip dar und wie sich verschiedene Unternehmensziele gegenseitig
beeinflussen können. Hier erfolgt dann die allgemeine Definition des Zielkonflikts.
Wie das Handeln eines Unternehmens zum Erreichen dieser Ziele von der Gesellschaft
gesehen wird, erfolgt im dritten Teil. Jeder Fehltritt, jeder Skandal, jegliche negative
Presse kann das Vertrauen in ein Unternehmen schmälern und so ist es ganz besonders
wichtig, ein nachhaltiges Bild nach außen zu vermitteln und bei angebrachter oder nicht
angebrachter negativer Kritik bestmöglich mit dieser umzugehen. Verschiedene Metho-
den hierzu werden in Punkt 4 vorgestellt.
Danach möchte ich detailliert auf den Tradeoff zwischen Gewinn und Moral eingehen.
Welche Entscheidungen müssen Firmen treffen, welchen Gruppen misst das Unterneh-
men den meisten Wert zu? Sich für das Eine zu entscheiden, heißt meistens etwas
Anderes einzubüßen und dies muss das Unternehmen nach außen moralisch vertreten.
Im Fokus der Moral, von der wir immer sprechen, steht der Begriff Nachhaltigkeit, auf
den ich in Punkt 6 eingehen möchte. Nachhaltigkeit wird von der Gesellschaft gefordert,
mit ihrer Verankerung im Unternehmen baut man ein ,,gutes Image" auf. Nachhaltigkeit
sollte in allen Menschen, die auf dieser Welt leben auch in denen, die in Unternehmen
Gewinn erwirtschaften wollen verankert sein.
Nachdem die theoretischen Grundlagen geschaffen wurden, möchte ich das Nachhaltig-
keitsmanagement von drei international agierenden Großunternehmen aus Deutschland
analysieren. Die Allianz SE, die Volkswagen (VW) AG und die Henkel AG & Co. KGaA
weisen verschiedene Einstellungen zu Nachhaltigkeit, Moral und Umwelt auf und tragen
dies mit ihren Taten nach außen. Alle drei finden in den Medien statt und genießen ein
bestimmtes Image bzw. haben mit einem bestimmten Image zu kämpfen. Diese drei sind
perfekt für eine Gegenüberstellung der Strategien und einer Einschätzung des Einflusses
des Ansehens der Gesellschaft für das Unternehmen. Auch die unlängst geschehenen
Vorfälle werden natürlich Thema sein.
2
2 Zweck und Ziele eines Unternehmens
Um später in der Arbeit allgemein und anhand der Fallstudien auf Zielkonflikte in einem
Unternehmen eingehen zu können, erfolgt ein kurzer Abriss über den Zweck und die
Ziele eines Unternehmens.
2.1 Unternehmenszweck
Ein Unternehmen erhält seine Daseinsberechtigung durch die Bestimmungen, welche ihm
von seiner Umwelt und deren Angehörigen verliehen werden (Staehle, 1999). Neben den
kaufmännischen Zielen der Bereitstellung von Produkten bzw. der Durchführung von
Dienstleistungen übernimmt das Unternehmen auch Aufgaben für die Gesellschaft
(Ulrich, 1995). Dem Vorhandensein des Unternehmens wird durch Gesellschaftsteile
bzw. der ganzen Gesellschaft Legitimität verliehen, da diese die offerierten Güter oder
Dienstleistungen nachfragen. Dieses System funktioniert für ein Unternehmen so lange,
wie es Verantwortung sowohl für die Gesellschaft als auch für die Wirtschaft übernimmt
(Wheelen, 1995). Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Zweck des Unternehmens
in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zu sehen ist und es auf verantwortungsvolle
Weise Dienste für Andere erbringen soll (Hill, 1968).
2.2 Ziele eines Unternehmens
Ziel der meisten Unternehmen ist die Erwirtschaftung von Gewinn. Dies ist auch vorran-
giges Bedürfnis der Shareholder, also der Anteilseigner des Unternehmens. Jedoch
werden die Interessen anderer Gruppen, wie z.B. Mitarbeiter und Kunden, aber auch der
Staat und die Öffentlichkeit immer wichtiger. All diese oft widersprüchlichen Bedürf-
nisse und Interessen der involvierten Gruppen gilt es für das Unternehmen zu befriedigen.
Sogenannte Zielkonflikte sind die Folge, auf die ich nach der Diskussion über das Ge-
winnprinzip und der Vorstellung der direkt und indirekt beteiligten Gruppen eines
Unternehmens genauer eingehen werde.
2.2.1 Gewinnprinzip
Das Gewinnprinzip ist - neben anderen ein wichtiges Unternehmensziel. Unter dem
Gewinnprinzip oder der Gewinnmaximierung versteht man unter Beachtung von Absatz-
menge, Kosten und Preis, den Gewinn zu maximieren. Ein Gewinnmaximum ist die
3
maximale Differenz zwischen dem Erlös eines Unternehmens und dessen Kosten. Er-
reicht werden kann dieses Maximum durch eine Kostensenkung und/oder einer
Erlössteigerung (Poth, 2013).
2.2.2 Zufriedenstellung aller beteiligten Gruppierungen
In ein Unternehmen sind viele verschiedene Gruppen in unterschiedlicher Art und Weise
eingebunden. Neben dem Gewinnprinzip ist die Befriedigung ihrer Ansprüche Ziel eines
Unternehmens. Im Folgenden grenze ich die Gruppen klar voneinander ab und gehe auf
die verschiedenen Interessen genauer ein.
2.2.2.1 Shareholder
Shareholder sind die Anteilseigner eines Unternehmens und lassen sich im Allgemeinen
als Eigentümer im Sinne der Wirtschaftlichkeit charakterisieren (Schmidt, 2003). Sie
investieren in ein Unternehmen allein aus dem Grund, einen finanziellen Nutzen daraus
zu ziehen und deshalb steht das Maximieren des langfristigen Unternehmenswertes im
Fokus jeder Entscheidung. Die Investition in ein Unternehmen beginnt für den Anteils-
eigner mit einer Auszahlung, welche er unter Berücksichtigung des erwarteten Risikos
und Ertrages bei einem Unternehmen tätigt (Reimann, 1988).
2.2.2.2 Stakeholder
Erstmals wurde die Bezeichnung Stakeholder 1963 vom Stanford Research Institute (SRI)
genutzt, um aufzuzeigen, dass Shareholder (Aktionäre) nicht die einzige beachtenswerte
Gruppierung für das Management sind (Clausen, 1996). Heutzutage wird der Begriff
Stakeholder in der deutschsprachigen Literatur häufig schon ohne Übersetzung genutzt.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Begriff der Anspruchsgruppen eine gängige Über-
setzung (Hentze, 2014). Damit sind laut Freeman folgende Personen und Gruppierungen
gemeint:
,,A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can
affect or is affected by the achievement of the organization's objectives" (Freeman, 2010:
S. 46).
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass mit dem Begriff Stakeholder alle einzelnen
Personen oder Gruppierungen mit einem direkten oder indirekten Bezug zum Unterneh-
men gemeint sind. Die Auflistung und Kategorisierung der Stakeholder wurde in der
Vergangenheit sehr unterschiedlich vorgenommen.
4
Freeman nahm die Stakeholder ohne Kategorisierung als folgende Liste auf (Freeman,
2010: S. 8ff):
Management
Mitarbeiter
Eigentümer der Unternehmung
Kunden
Lieferanten
Fremdkapitalgeber
Mitbewerber
Staat, Regierung und Behörden
Verbände, Organisationen, Interessensvertretungen und gruppen
die allgemeine Öffentlichkeit, meist repräsentiert durch die Medien
Stapelton kategorisiert die Stakeholder in zwei Gruppen: interne und externe Stakeholder.
Zu den internen Stakeholdern werden Manager, Mitarbeiter, Investoren, Aufsicht und
Betriebsräte gezählt. Die externen Stakeholder werden wiederum in zwei Gruppierungen
aufgeteilt. Jene, welche der direkten Unternehmensumwelt zugehörig sind, wie Kunden,
Lieferanten, Kreditoren und Konkurrenten. Des Weiteren diejenigen, welche der erweiter-
ten bzw. allgemeinen Umwelt zugeordnet werden (Stapleton, 2005a). Graphisch
veranschaulicht Poeschl diese Aufteilung in Abbildung 1:
Abbildung 1: Schichtenmodell der Stakeholder eines Unternehmens nach Stapleton
(Poeschl, 2013 S. 146)
5
Nicht selten haben Shareholder und Stakeholder widersprüchliche Ziele, aber auch
innerhalb der Stakeholder kann dies vorkommen. Widersprüchliche Interessen können
bspw. darin bestehen, ,,dass die Kunden niedrige Preise, die Geldgeber hohe Renditen und
die Angestellten zugleich möglichst hohe Löhne wünschen" (Heinrichs, 2014 S. 334).
Alle Gruppen haben das Interesse daran, dass das Unternehmen Bestand hat, da nur
dadurch eine Wertschöpfung und Kooperation möglich ist (Heinrichs, 2014).
Cornell und Shapiro unterscheiden die Ansprüche von Stakeholdern zwischen explizit
und implizit. Dabei sind explizite Ansprüche diejenigen, welche aus rechtlichen Grundla-
gen und Verträgen hervorgehen und lassen sich dementsprechend eindeutig identifizieren.
Dagegen sind implizite Ansprüche rechtlich nicht verbindlich und weisen auch keine
vertraglich abgesicherte Grundlage auf, sondern ergeben sich aus ethischen und morali-
schen Verpflichtungen (Cornell, 1987).
Neben der genannten Einteilung der Ansprüche kann sich noch das Problem ergeben, dass
es ,,neben Gruppen mit explizit formulierten Ansprüchen auch Gruppen gibt, die ihre
Ansprüche nicht explizit formulieren, aber implizit von der Berücksichtigung bzw.
Befriedigung ihrer impliziten Erwartungshaltungen ausgehen" (Poeschl, 2013 S. 148).
Des Weiteren kann es innerhalb einer Stakeholdergruppierung zu unterschiedlichen
Grundgedanken über die Ansprüche kommen, welche sich auch im Laufe der Zeit ändern
können und deswegen nicht aus einer statischen Sichtweise betrachtet werden können.
Um diese Probleme bewältigen zu können, ist es für Unternehmen notwendig, die Be-
dürfnisse und Ansprüche der Stakeholder kontinuierlich zu analysieren (Wilbers, 2005).
Eine detaillierte Unterteilung in soziale-, ökonomische-, und ökologische Stakeholderan-
sprüche wird in einem späteren Absatz ausführlicher dargestellt.
2.2.3 Mögliche Beziehungen zwischen Unternehmenszielen
Ein Unternehmen sieht sich mit vielen unterschiedlichen Interessen und Ansprüchen
konfrontiert. Es bilden sich Ziele heraus, die sich gegenseitig beeinflussen können. In
dieser Arbeit stehen Ziele, die sich gegenseitig negativ beeinflussen im Vordergrund. Um
diese aber abgrenzen zu können, gebe ich zuerst einen kurzen Überblick über verschiede-
ne Formen von Zielbeziehungen.
6
2.2.3.1 Neutrale Ziele
Bei neutralen Zielen lassen die Nebenwirkungen des einen Ziels die Verfolgung des
anderen Ziels unberührt (Ramb).
2.2.3.2 Komplementäre Ziele
Die Nebenwirkungen des einen Ziels begünstigen die Erreichung des anderen Ziels
(Ramb).
2.2.3.3 Konkurrierende Ziele bzw. Zielkonflikte
Die Nebenwirkungen des einen Ziels beeinträchtigen die Verfolgung des anderen Ziels
negativ. Dies wirft Abwägungsprobleme auf und erfordert Kompromisse (Ramb).
Aus der Wirtschaftsethik stammt der Begriff ,,Tradeoff", welcher als Synonym für einen
Zielkonflikt zu verstehen ist. Dieser bezeichnet ein als Spannungsfeld aufgefasstes
Verhältnis von wenigstens zwei verschiedenen Zielen bzw. Werten. Abbildung 2 zeigt
diesen Tradeoff schematisch:
Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Tradeoffs
(Beckmann, 2007 S. 54)
Grundlegend wird die Annahme getroffen, dass die jeweiligen Ziele A und B sich einan-
der bedingen. Dies bedeutet, dass sie nicht voneinander unabhängig erreicht werden
können. Vielmehr beeinflusst der Zielerreichungsgrad von A direkt den Zielerreichungs-
grad von B. Die negative Steigung der sogenannten Tradeoff-Linie zeigt an, dass die
verbesserte Zielerreichung des einen Zieles direkt zu Lasten des anderen Zieles geht.
7
3 Der kritische Blick der Gesellschaft auf Unternehmen
3.1 Kritische Sicht des Gewinnprinzips
Viele Unternehmen sehen sich steigendem Druck durch die Kritik von Seiten der Gesell-
schaft bzgl. des von ihnen vertretenen Systems der Gewinnmaximierung ausgesetzt. Die
Bevölkerung kann das Gewinnprinzip gedanklich nicht in Einklang mit gesellschaftlicher
Verantwortung bringen. Dies geht aus einer Umfrage aus dem Jahr 2002 hervor, wonach
nur 4% der deutschen Bevölkerung die Gewinnerzielung als ein Kriterium für gesell-
schaftliche Verantwortung ansehen (Civis, 2003). Ein ähnliches Ergebnis erzielte die
weltweite Umfrage des GlobeScan im Jahr 2005 als nur 5% der Befragten angaben, dass
Gewinnerzielung ein Teil der unternehmerischen Verantwortung sei (GlobeScan, 2005).
In der öffentlichen Auffassung gewinnt die Ansicht, dass eigene Gewinninteressen zu
Lasten von Gesellschaftsanliegen gehen. Dies kann man bspw. bei steigenden Unterneh-
mensgewinnen und gleichzeitigem Abbau von Arbeitsplätzen beobachten. Diese Ansicht
teilen auch die Deutschen bei einer Erhebung aus dem Jahr 2005 als 74% angaben, dass
sie der Meinung sind, Unternehmen würden hohe Gewinne erzielen und dennoch Ar-
beitsplätze abbauen (Handelsblatt, 2005).
3.2 Schwindendes Vertrauen gegenüber Unternehmen
Dass das Vertrauen der Deutschen gegenüber nennenswerten gesellschaftlichen Instituti-
onen sinkt, wurde schon 2001 vom Institut für Demoskopie in Allensbach ermittelt. Der
Anteil an Personen aus Westdeutschland / Ostdeutschland, die ,,sehr viel oder ziemlich
viel Vertrauen" in diese Institutionen haben, lagen bei nur 29% / 30%. Zum Vergleich:
1991 waren es noch 43% / 45% (Noelle-Neumann, 2002)
.
Zum Zeitpunkt des Verfassens
dieser Bachelorarbeit liegen keine aktuelleren Zahlen zu dieser Studie vor.
Als aktuelle Quelle zu diesem Thema kann man das Edelman Trust Barometer heranzie-
hen. Dies ist die ,,größte, jährliche Untersuchung zu Vertrauen in und Glaubwürdigkeit
von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Wirtschaft und Medien". 2015 wurden
so 1200 Menschen in Deutschland mithilfe eines 20-minütigen Online-Interviews befragt.
Bzgl. des Vertrauens in Unternehmen haben die Befragten auf einer Skala von eins bis
neun angegeben, wie groß das Vertrauen ist, wobei eins ,,ich vertraue überhaupt nicht"
und neun ,,ich vertraue ganz und gar" bedeutet.
8
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783961161263
- ISBN (Paperback)
- 9783961166268
- Dateigröße
- 1.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leopold-Franzens-Universität Innsbruck – Institut für Organisation und Lernen
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Mai)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- CSR Corporate Social Responsibility Allianz Henkel Volkswagen VW Nachhaltigkeit Unternehmensziele Zielkonflikt Tradeoff Unternehmenskonflikte Shareholder Stakeholder soziale Verantwortung
- Produktsicherheit
- Diplom.de