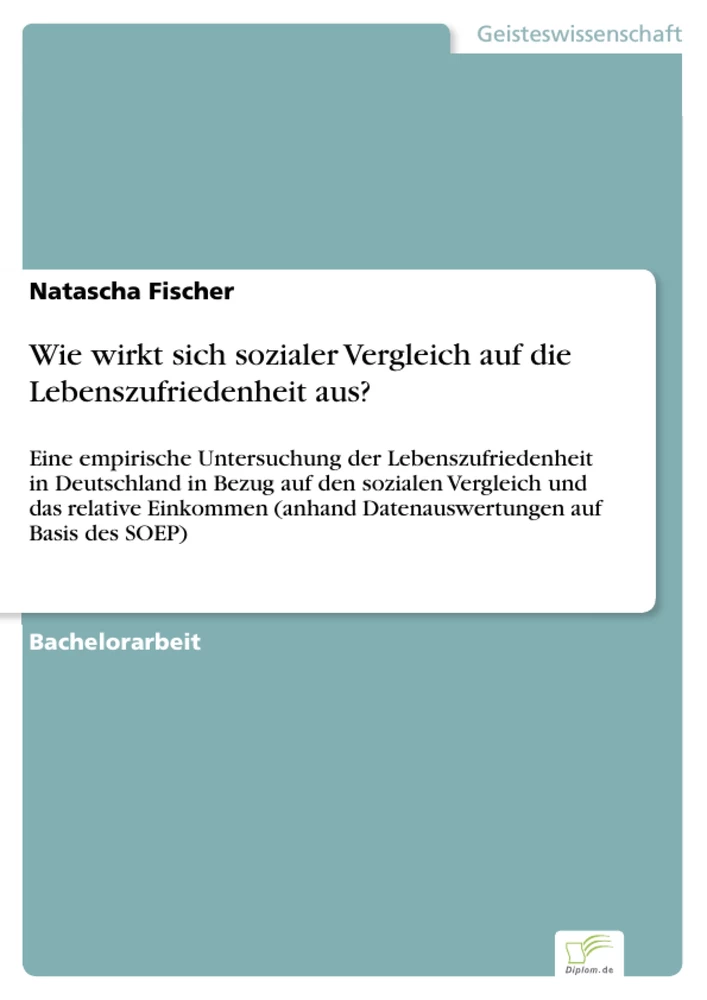Wie wirkt sich sozialer Vergleich auf die Lebenszufriedenheit aus?
Eine empirische Untersuchung der Lebenszufriedenheit in Deutschland in Bezug auf den sozialen Vergleich und das relative Einkommen (anhand Datenauswertungen auf Basis des SOEP)
©2016
Bachelorarbeit
44 Seiten
Zusammenfassung
Wie wirkt sich der Vergleich mit anderen auf die eigene Lebenszufriedenheit aus? Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen. Es soll dabei empirisch, anhand von Datenanalysen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), untersucht werden, welchen Einfluss verschiedene Aspekte des sozialen Vergleichs auf die allgemeine Lebenszufriedenheit in Deutschland haben. Wie die Ergebnisse zeigen, wirkt sich dieser negativ auf die Zufriedenheit aus, wobei zwischen sozialem Vergleich von Fähigkeiten und von Meinungen unterschieden wird: Je höher die Tendenz, Fähigkeiten mit anderen zu vergleichen, desto geringer die Lebenszufriedenheit. Es wird außerdem der Effekt von unterdurchschnittlichem Einkommen innerhalb dreier Bildungsgruppen untersucht. Auch hier zeigt sich eine negative Auswirkung auf die Zufriedenheit. Des Weiteren wird die relative Einkommenshypothese anhand des eigenen Lebensstandards im Vergleich zum Lebensstandard der Nachbarschaft überprüft.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
II
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung ... I
Inhaltsverzeichnis ...II
Tabellenverzeichnis... III
1 Einleitung
... 4
2 Forschungsstand... 5
3 Theoretischer
Hintergrund
... 8
3.1 Sozialer
Vergleich...
8
3.2
Die Bedeutung des relativen Einkommens ... 10
3.2.1 Einkommensdifferenzen
innerhalb/zwischen Bildungsgruppen.. 11
3.2.2
Relativer und absoluter Lebensstandard... 12
4
Methode ... 14
4.1
Daten des SOEP ... 15
4.2 Die
INCOM-Skala
...
16
5 Ergebnisse
... 18
5.1 Deskriptive
Statistik
...
19
5.2 Bivariate
Statistik
...
20
5.3 (Multivariate)
Regressionsanalysen
...
21
5.3.1
Sozialer Vergleich & Lebenszufriedenheit (Hypothese 1) ... 22
5.3.2
Einkommen/Bildung & Lebenszufriedenheit (Hypothese 2) ... 24
5.3.3
Lebensstandard & Lebenszufriedenheit (Hypothese 3) ... 26
5.3.4
Relativer Lebensstandard, sozialer Vergleich &
Lebenszufriedenheit ... 28
6 Diskussion
... 30
7 Fazit
... 32
Anhang ... 34
Literaturverzeichnis ... 41
Tabellenverzeichnis
III
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1.1:
Fragenkatalog Lebenszufriedenheit
Tabelle 1.2:
Fragenkatalog ,,Iowa-Netherlands Comparison Orientation Scale" (IN-
COM)
Tabelle 1.3:
Fragenkatalog Lebensstandard Haushalte in der Nachbarschaft
Tabelle 1.4:
Fragenkatalog Lebensstandard eigener Haushalt
Tabelle 1.5:
Fragenkatalog Haushaltseinkommen
Tabelle 2.1:
Deskriptive Zusammenfassung der statistischen Daten des ,,Iowa-
Netherlands Comparison Orientation Scale" (INCOM)
Tabelle 2.2:
Deskriptive Zusammenfassung der statistischen Daten der Lebenszufrie-
denheit
Tabelle 2.3:
Deskriptive Zusammenfassung der statistischen Daten des Lebensstandards
in der Nachbarschaft und eigener Lebensstandard
Tabelle 2.4:
Deskriptive Zusammenfassung der statistischen Daten der Einkommen
nach Bildungsgruppe
Tabelle 3.1:
Berechnung der Korrelationen zwischen den Items und Cronbach's alpha
Tabelle 3.2:
Berechnung der Korrelationen zwischen den Items und Cronbach's alpha
gekürzte Version der INCOM-Skala
Tabelle 4.1:
Einseitige T-test-Statistiken
Tabelle 4.2:
Einseitige T-test-Statistiken - gekürzte Version der INCOM-Skala
Tabelle 5.1:
Lineare Regressionsanalyse (OLS) des sozialen Vergleichs auf die Lebenszu-
friedenheit
Tabelle 5.2:
Lineare Regressionsanalyse (OLS) des über-/unterdurchschnittlichen Ein-
kommens innerhalb Bildungsgruppen auf die Lebenszufriedenheit
Tabelle 5.3:
Lineare Regressionsanalyse (OLS) des Lebensstandards auf die Lebenszu-
friedenheit
Tabelle 5.4:
Lineare Regressionsanalyse (OLS) der Lebenszufriedenheit
1 Einleitung
4
1 Einleitung
Macht es uns unzufrieden, wenn wir uns mit anderen vergleichen? Wie wirkt sich das Ein-
kommen anderer und dessen Vergleich mit dem eigenen Einkommen auf die individuelle
Lebenszufriedenheit aus? Und: Welchen Einfluss hat der relative Lebensstandard auf die
allgemeine Lebenszufriedenheit? All diese Fragen beziehen sich auf unterschiedliche Art
mit unterschiedlichen Variablen auf den sozialen Vergleich und dessen Auswirkungen auf
die allgemeine Lebenszufriedenheit.
Wie aus verschiedenen Studien hervor geht, hat der soziale Vergleich mit anderen einen
Einfluss auf die allgemeine Lebenszufriedenheit (siehe F
IREBAUGH
&
S
CHROEDER
2009,
W
OLBRING
et al. 2013,
F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
2005,
L
UTTMER
2005). So hat beispielsweise
nicht nur das eigene Einkommen einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, sondern auch
das Einkommen anderer wie z.B. unserer Nachbarn; hierbei ist also das relative Einkom-
men von Bedeutung.
Individuen tendieren dazu sich mit anderen zu vergleichen. Dieser soziale Vergleich von
z.B. Fähigkeiten, was mit Konkurrenzverhalten sowie mit Status und Prestige zusammen-
hängen kann, kann negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden haben. Daher
ist es von besonderem Interesse, die verschiedenen Effekte des sozialen Vergleichs auf die
allgemeine Lebenszufriedenheit zu analysieren.
In dieser Arbeit soll theoretisch und empirisch dargelegt werden, wie sich sozialer Ver-
gleich auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Die Beantwortung dieser Fragestellung soll
anhand Analysen dreier Hypothesen erreicht werden, welche durch verschiedene Variablen
des sozialen Vergleichs (wie die Tendenz sich zu vergleichen basierend auf der INCOM-
Skala, unter-/überdurchschnittliches Einkommen innerhalb von Bildungsgruppen, absolu-
ter und relativer Lebensstandard) den Effekt auf die Lebenszufriedenheit zeigen sollen.
Der Aufbau der Arbeit lässt sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil glie-
dern, wobei der erste Teil (Kapitel 2 & 3) den aktuellen Forschungsstand sowie die theore-
tischen Grundlagen fokussieren. Im zweiten Teil (Kapitel 4 & 5) werden anhand von Da-
ten des SOEP die aufgestellten Thesen, die sich an der erläuterten Theorie im vorherigen
Kapitel anlehnen, analysiert und interpretiert. Anschließend folgen die Diskussion und ein
zusammenfassendes Fazit.
2 Forschungsstand
5
2 Forschungsstand
Obwohl bereits im 18. Jahrhundert das Thema der Lebenszufriedenheit, sowie der (mögli-
che) Zusammenhang von Wohlstand und Zufriedenheit, in klassischen Werken von H
UME
,
S
MITH
, B
ENTHAM
, M
ARX
, S
IMMEL
, D
URKHEIM
und W
EBER
aufgegriffen wurde, findet
man überraschend wenig publizierte Artikel über die Thematik (W
OLBRING
et al. 2013:86;
K
EUSCHNIGG
& W
OLBRING
2012:190). In den letzten Jahrzehnten stieg nicht nur in der
Psychologie und Wirtschaft, sondern auch in den Sozialwissenschaften zunehmend das
Interesse an Zusammenhänge, welche die allgemeine Lebenszufriedenheit beeinflusst und
erklärt. Eine wesentliche Arbeit zur Theorie des sozialen Vergleichs ist der Aufsatz ,,A
Theory of Social Comparison Processes
" von F
ESTINGER
aus dem Jahre 1954, welcher als Grund-
lage weiterer Forschungen gilt.
Die Thematik der Lebenszufriedenheit ist breit gefächert und weist verschiedene Schwer-
punkte auf. Untersuchungen von Einflussfaktoren welche die Lebenszufriedenheit im All-
gemeinen beeinflussen, ergeben, dass Wirtschaftsentwicklung und Demokratisierung, wel-
che die freie Wahl ermöglichen (I
NGLEHART
et al. 2008:264)
1
sowie Einkommen, Wohl-
fahrtsstaat und Lebenserwartung (D
I
T
ELLA
&
M
AC
C
ULLOCH
2008:22) einen positiven
Effekt auf die Zufriedenheit haben. Variablen wie Arbeitsstundenanzahl, Umweltzerstö-
rung, Kriminalität, Inflation und Arbeitslosigkeit haben hingegen einen negativen Effekt
(D
I
T
ELLA
&
M
AC
C
ULLOCH
2008:22).
2
F
IREBAUGH
& S
CHROEDER
(2009) betonen die
Wichtigkeit des sozialen Kontextes für das subjektive Wohlbefinden: Übereinstimmend mit
den theoretischen Überlegungen bezüglich des Zugangs zu öffentlichen Gütern (wie z.B.
Schulen und Sicherheit) und das Ausbleiben von negativen Einflüssen (wie z.B. Kriminali-
tät), hat das Leben in einer reichen Nachbarschaft positive Effekte auf die Lebenszufrie-
denheit (W
OLBRING
et al. 2013:86). Dem entgegengesetzt lässt sich ein negativer Effekt des
1
In dem Artikel von I
NGLEHART
,
F
OA
,
P
ETERSON
&
W
ELZEL
(2008) werden Entwicklungen der Lebenszu-
friedenheit im Zeitraum von 1981 bis 2007 in 52 Ländern vorgestellt wovon diese in 45 Ländern anstieg. Dies
wird durch die Wirtschaftsentwicklung, Demokratisierung sowie Steigerung sozialer Toleranz erklärt, was die
freie Wahl begünstigt und dadurch zur Steigerung der Lebenszufriedenheit führt (ebd. 264).
2
Einen weitreichenden Überblick über theoriebasierte und empirischer Literatur bieten C
LARK
,
F
RIJTERS
&
S
HIELS
(2008); angefangen bei dem Easterlin-Paradox, über den Zusammenhang von Einkommen und Zu-
friedenheit, bis hin zur Nutzenfunktion mit Einbezug verschiedener Aspekte und Einflussfaktoren.
Auch D
IENER
&
B
ISWAS
-D
IENER
(2002) beleuchten den Zusammenhang von Einkommen und Lebenszu-
friedenheit umfassend und legen einen guten Übersichtsartikel dar.
2 Forschungsstand
6
sozialen Vergleichs mit wohlhabenderen Nachbarn feststellen (W
OLBRING
et al. 2013:86).
3
Auch haben Aspirationen einen Effekt auf die Lebenszufriedenheit: Wie Untersuchungen
von S
TUTZER
(2004)
und
M
C
B
RIDE
(2010) zeigen, haben Erwartungshaltungen an u.a. Ein-
kommen, einen signifikanten negativen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit (S
TUTZER
2004:89,105;
M
C
B
RIDE
2010:262,273f).
4
Bezüglich des Zusammenhangs von Zufriedenheit und Einkommen gilt E
ASTERLIN
s Werk
als grundlegend; erstmals wurden Erklärungsmechanismen vorgestellt, welche auf dem
sogenannten Easterlin-Paradox basieren. Das Paradoxon beschreibt u.a., dass innerhalb
eines Landes diejenigen mit einem höheren Einkommen im Durchschnitt zufriedener sind
(positive Korrelation des Einkommens mit der Zufriedenheit), allerdings ein Zuwachs aller
Einkommen nicht zu einer Erhöhung der Lebenszufriedenheit führt (E
ASTERLIN
1995:35).
E
ASTERLIN
s Erklärung hierfür war, in Anlehnung an D
UESENBERRY
s (1949) relativer Ein-
kommenshypothese, dass der Einfluss des individuellen absoluten Einkommens keine Rol-
le spielt, vielmehr jedoch im Vergleich zu anderen (B
ALL
&
C
HERNOVA
2008:501). Die
Erklärungsmechanismen des Easterlin-Paradox beziehen sich auf (1) die Zufriedenstellung
materieller Grundbedürfnisse (basic human needs), (2) zwischenmenschliche Vergleichspro-
zesse (social comparisons) und (3) Gewöhnungsprozesse (adaptation) (W
OLBRING
et al.
2013:86f)
5
. Basierend auf M
ASLOW
(1943) stellen physiologische Bedürfnisse und Motivati-
onen in der Bedürfnispyramide die Grundlage dar (ebd. 372f). Die Zufriedenstellung mate-
rieller Grundbedürfnisse, wie Verfügung über Nahrung und Unterkunft, liegt in der Exis-
tenz des Menschen begründet und hat somit Einfluss auf die allgemeine Lebenszufrieden-
heit (W
OLBRING
et al.
2013:87f). Adaption bzw. Gewöhnungsprozesse spielen, wie B
RICK-
MAN
et al. (1978) in einer experimentellen Studie mit Lotterie-Jackpot-Gewinnern zeigen,
insofern eine Rolle für die Lebenszufriedenheit, als dass z.B. durch Adaption verschiedener
3
F
IREBAUGH
& S
CHROEDER
verwenden Daten des American National Election Studies (ANES) zusammen
mit Einkommensdaten des U.S. Zensus und kommen zu dem Ergebnis, dass Individuen zufriedener sind
wenn diese in reicheren Nachbarschaften (Nachbarschaftsforschung) in ärmeren Gegenden (relative Ein-
kommenshypothese) wohnen. D.h. Individuen sind zufriedener wenn sie unter armen Bevölkerungsschichten
leben, solange die Armen nicht zu nahe leben (ebd. 805).
4
S
TUTZER
kommt außerdem zum dem Schluss, dass das subjektive Wohlbefinden von der Differenz der
Einkommensaspiration und dem tatsächlichen Einkommen, und nicht von dem Einkommenslevel an sich,
abhängig ist (ebd. 105).
5
In dem Artikel von W
OLBRING
,
K
EUSCHNIGG
&
N
EGELE
(2013) werden bzgl. der drei Mechanismen die
Hypothesen anhand Daten des SOEP analysiert, welche bestätigt werden können. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Grenze der materiellen Grundbedürfnisse bei circa 800 abgedeckt sind, und dass der Vergleich mit
Kollegen oder Individuen ähnlicher Eigenschaften (nicht so für Freunde oder Verwandte) einen relevanten
Einfluss auf die Zufriedenheit hat. Die Annahmen über Aspirationen und Adaption zeigen, dass relatives
Einkommen eine bedeutendere Rolle für die Zufriedenheit spielt als das absolute Einkommen. Außerdem
haben Einkommensverluste einen stärkeren Effekt als Einkommensgewinne. (ebd. 86)
2 Forschungsstand
7
Umstände die Zufriedenheit nicht signifikant beeinflusst wird (ebd. 917). Welche und in-
wiefern zwischenmenschliche Vergleichsprozesse die Lebenszufriedenheit beeinflussen,
soll in dieser Arbeit herausgefunden werden.
D
USENBERRY
(1949) begründete die relative Einkommenshypothese, welche die Bedeu-
tung des relativen Einkommens erklärt. Es wird der Einfluss des Einkommens auf die Le-
benszufriedenheit durch soziale Vergleiche mit bestimmten Referenzgruppen erläutert
(W
OLBRING
et al. 2013:88). Des Weiteren kommt er zu dem Ergebnis, dass sich Menschen
meist ,,nach oben" vergleichen; Aspirationen somit über dem bereits erreichten Level lie-
gen (S
TUTZER
2004:91).
E
ASTERLIN
hat in dem Artikel ,,Does Economic Growth Improve the Human Lot?" von 1974
erstmals empirisch dargelegt welche Bedeutung dem relativen Einkommen im Vergleich
zum absoluten Einkommen in Bezug auf die Lebenszufriedenheit beigemessen wird. Die
Wichtigkeit des Effekts des relativen Einkommens auf die Lebenszufriedenheit weisen
auch Studien von B
ALL
&
C
HERNOVA
(2008)
6
,
F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
(2005)
7
,
L
UTTMER
(2005)
8
und
S
ENIK
(2009)
9
nach.
Die Theorie des sozialen Vergleichs, welche F
ESTINGER
(1954) begründete, wird in den
Artikeln von M
ASTERS
&
K
EIL
(1987) und L
EVINE
& M
ORELAND
(1987) aufgegriffen. Da-
bei werden unterschiedliche Typen des sozialen Vergleichs sowie verschiedene Aspekte des
Verhaltens bezüglich des sozialen Vergleichs ausführlich erläutert. O
LSON
,
H
ERMAN
&
Z
ANNA
(1986) geben in ihrem Werk einen Überblick über die Theorie des sozialen Ver-
gleichs und über relative Deprivation anhand einer Sammlung mehrerer Artikel.
6
B
ALL
&
C
HERNOVA
(2008) untersuchen in Anlehnung an E
ASTERLIN
(1974) innerhalb des Landes und
zwischen Ländern, den Zusammenhang von relativen bzw. absoluten Einkommen und Zufriedenheit; sie
kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl das absolute als auch das relative Einkommen einen positiven signi-
fikanten Effekt auf die Lebenszufriedenheit hat, wobei letzteres jedoch einen stärkeren Effekt aufweist (ebd.
497,524).
7
F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
(2005)
untersucht die Bedeutung des relativen Einkommens und kommt zu dem
Ergebnis (für Ost- und Westdeutschland), dass dieses mindestens genauso wichtig ist wie absolutes bzw.
eigenes Einkommen: Je größer das Einkommen im Vergleich zu anderen, desto zufriedener sind Individuen.
Ein Einkommenszuwachs hat dabei keinen Effekt auf die Zufriedenheit, solange eine vergleichbare Verände-
rung in der Referenzgruppe vorkommt. (ebd. 997)
8
L
UTTMER
(2005) kommt zu dem Schluss, dass höheres Einkommen in der Nachbarschaft mit einer niedri-
geren berichteten Lebenszufriedenheit einhergeht, zurückführbar auf zwischenmenschlichen Präferenzen
(ebd. 963).
9
S
ENIK
(2009) liefert Evidenz für den signifikanten Einflusses von Einkommensvergleichen auf die allge-
meine Lebenszufriedenheit (ebd. 408). Dabei spielen einerseits Vergleiche mit seinem eigenen (früheren)
Lebensstandard, andererseits Vergleiche mit anderen (Eltern, Kollegen etc.), eine wichtige Rolle (ebd. 408).
Des Weiteren kommt F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
(2005)
zu dem Ergebnis, dass soziale Vergleiche meistens auf-
wärts ausgerichtet sind was die Theorie D
USENBERRY
s bestätigt (F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
2005:997).
3 Theoretischer
Hintergrund
8
3 Theoretischer
Hintergrund
In diesem Kapitel geht es um den theoretischen Hintergrund und um die aufgestellten Hy-
pothesen, die im darauffolgenden Kapitel empirisch bestätigt werden sollen. Dabei liegt der
Fokus auf dem Einfluss des sozialen Vergleichs auf die allgemeine Lebenszufriedenheit.
Im Folgenden wird die Theorie des sozialen Vergleichs, welche von F
ESTINGER
(1954)
begründet wurde, kurz skizziert. Ferner wird die erste Hypothese hergeleitet, bei der es
darum geht wie oft sich Individuen mit anderen bezüglich ihrer Fähigkeiten und Meinun-
gen vergleichen und wie sich dies auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auswirkt. Dabei
werden ebenfalls mögliche Geschlechterunterschiede, Unterschiede im Alter, in der Bil-
dung und dem Wohnort betrachtet. Im Anschluss wird die Bedeutung des relativen Ein-
kommens erläutert. Es werden Effekte von Einkommensdifferenzen innerhalb, sowie zwi-
schen drei Bildungsgruppen auf die Lebenszufriedenheit beleuchtet. Anschließend geht es
um den relativen (Lebensstandard der Nachbarschaft) und absoluten Lebensstandard (ei-
gener Lebensstandard).
3.1
Sozialer Vergleich
Bisherige Forschungen über Prozesse sozialer Vergleiche sind vor allem auf Fähigkeiten
(abilities)
und Meinungen (opinions) ausgerichtet in Anlehnung an F
ESTINGER
(1954), wel-
cher die Theorie des sozialen Vergleichs begründete (Masters & Smith 1987:2). Das grund-
legende Postulat der Theorie ist, dass Menschen dazu tendieren, ihre Meinungen und Fä-
higkeiten (im Vergleich zu anderen) zu evaluieren (O
LSON
& H
AZLEWOOD
1986:6). Wir
Menschen leben unausweichlich in einer sozialen Umwelt, in der Interaktionen mit anderen
zum Alltag gehören, und in der unsere relative Position in der Gesellschaft eine Rolle spielt
(W
OLBRING
et al. 2013:87). Wir sammeln Informationen und fällen Urteile, indem wir uns
mit anderen vergleichen die uns ähnlich sind bzw. die uns nahe stehen bzgl. einer bestimm-
ten Meinung oder Fähigkeit (O
LSON
& H
AZLEWOOD
1986:6; S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2014:767). So beurteilt ein Individuum seine Fähigkeiten oder Meinungen nicht im Ver-
gleich mit jemandem, dessen Fähigkeiten oder Meinungen zu stark abweichen (F
ESTINGER
1954:120f).
3 Theoretischer
Hintergrund
9
Beim sozialen Vergleich lassen sich begrenzt Unterschiede bezüglich einiger Variablen, wie
(1) Geschlecht, (2) Alter, (3) Bildung und (4) Wohnort erkennen (welche im empirischen
Teil der Arbeit anhand t-Test-Statistiken behandelt werden): (1) Frauen weisen, im Ver-
gleich zu Männern, eine stärkere Tendenz auf, sich mit anderen bezüglich Meinungen zu
vergleichen. Ihnen wird im Allgemeinen unterstellt, dass sie offener gegenüber Ratschlägen
sind und sich mehr für die Meinungen und Ideen anderer interessieren (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2011:7). (2) In Bezug auf das Alter lassen sich Unterschiede bezüglich der Tendenz
des sozialen Vergleichs feststellen. So wird davon ausgegangen, dass sich jüngere Menschen
tendenziell häufiger mit anderen bzw. Gleichaltrigen vergleichen (begründet u.a. durch
Selbst-Evaluation) als ältere (S
ULS
1986:102f). Mit zunehmendem Alter und dementspre-
chendem Gewinn an Erfahrungen und entwickelter Persönlichkeit bzw. größerem Selbst-
wertgefühl, nimmt die Tendenz sich mit anderen zu vergleichen ab (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2011:7). Des Weiteren spielen Verluste von Freunden und Verwandten sowie Veränderun-
gen der Wahrnehmung und kognitive Möglichkeiten eine Rolle für die geringere Tendenz
des sozialen Vergleichs (S
ULS
1986:104-106). Es kann also festgehalten werden, dass sich
Jüngere häufiger mit anderen vergleichen als Ältere. (3) Was die Variable der Bildung an-
geht, wird angenommen, dass sich Individuen mit höherer Bildung, bezogen auf Meinun-
gen, häufiger vergleichen als Individuen mit niedrigerer Bildung; aufgrund von allgemein
höherem Interesse an anderen Meinungen, Ideen oder Lösungsvorschlägen. (4) Für die
Variable des Wohnorts wird untersucht, ob sich die Tendenz, sich zu vergleichen in West-
und Ostdeutschland unterscheidet. Für diese Annahme wurde allerdings keine mögliche
Erklärung einer Differenz gefunden und somit wird diesbezüglich kein signifikanten Unter-
schied erwartet.
In Bezug auf die allgemeine Lebenszufriedenheit lässt sich eine Verminderung dieser durch
den Vergleich von Fähigkeiten erwarten, da ein solcher Vergleich Konkurrenzkampf mit-
einschließt und somit Leistungsdruck ausüben kann (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2011:9). Ver-
gleiche bezüglich Meinungen haben dementgegen eine andere Funktion, welche einen posi-
tiven Effekt auf die Lebenszufriedenheit hat; sie ermöglichen Lösungsstrategien und bieten
mehr generelle Orientierungen im Leben (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2011:9).
Ausgehend von der Relevanz des sozialen Vergleichs für die allgemeine Lebenszufrieden-
heit führt dies zu der ersten Hypothese. Diese bezieht sich auf die allgemeine Tendenz des
Vergleichs mit anderen bezüglich der Fähigkeiten und dessen Auswirkung auf die allgemei-
ne Lebenszufriedenheit und lautet wie folgt:
3 Theoretischer
Hintergrund
10
Hypothese 1:
Je höher die Tendenz sich mit anderen zu vergleichen (bezogen auf Fähigkeiten), desto
geringer die Lebenszufriedenheit.
Im ersten Teil der Untersuchung bezogen auf die erste Hypothese geht es also darum,
herauszufinden, ob die Tendenz sich mit anderen zu vergleichen einen Effekt auf die all-
gemeine Lebenszufriedenheit hat. Im nächsten Schritt wird das relative Einkommen mit-
einbezogen.
3.2
Die Bedeutung des relativen Einkommens
Ergebnisse bisheriger Studien beziehen sich vor allem auf den Zusammenhang von Ein-
kommen und der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Dabei hat nicht nur absolutes, sondern
bedeutend stark auch relatives Einkommen einen Effekt auf die Lebenszufriedenheit. Dies
deutet auf die Bedeutung sozialen Vergleichs hin, da soziale Vergleichsprozesse wesentliche
Mechanismen darstellen. Darauf aufbauend wird davon ausgegangen, dass Individuen ihr
Einkommen mit anderen vergleichen um ihre eigene finanzielle Situation zu beurteilen und
dies Auswirkung auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2011:9).
Sozialer Vergleich und relatives Einkommen hängen miteinander zusammen und korrelie-
ren somit im Effekt auf die Lebenszufriedenheit. Dabei ist der Effekt des relativen Ein-
kommens bei denjenigen stärker, die sich häufiger mit anderen vergleichen: ,,The higher the
self-reported tendency to compare oneself with others, the stronger the effect of relative income on life satisfac-
tion"
(S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2014:772). Individuen, die dazu tendieren ihr Einkommen mit
anderen zu vergleichen, berichten über eine geringere Lebenszufriedenheit als diejenigen,
die sich nicht für das Einkommen anderer interessieren (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2011:10).
Der Vergleich von Fähigkeiten spielt dabei eine bedeutendere Rolle als der von Meinungen,
da angenommen wird, dass Fähigkeiten den ökonomischen Erfolg anderer eher wieder-
spiegeln (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2014:772). Auch sind Vergleiche bezüglich Fähigkeiten
meist aufwärts gerichtet, wobei dies für Vergleiche bezogen auf Meinungen nicht gilt: ,,The-
re is a unidirectional drive upward in the case of abilities which is largely absent in opinions"
(F
ESTINGER
1954:124).
Soziale Vergleichsprozesse sind relevant für die Erklärungen des komplexen Zusammen-
hangs zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit (W
OLBRING
et al. 2013:87). Die
3 Theoretischer
Hintergrund
11
Annahme liegt nun darin, dass das Einkommen die Lebenszufriedenheit durch soziale Ver-
gleiche mit bestimmten Referenzgruppen beeinflusst (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2014:772;
W
OLBRING
et al. 2013:88). Dies wird u.a. anhand der relativen Einkommenshypothese
erklärt, die von D
UESENBERRY
stammt und worauf in diesem Kapitel zurückgegriffen wird.
Neben der positiven Korrelation von Einkommen und Lebenszufriedenheit (je höher das
Einkommen, desto höher die Lebenszufriedenheit), spielt das relative Einkommen eine
bedeutende Rolle für die allgemeine Lebenszufriedenheit (E
ASTERLIN
1974; B
ALL
&
C
HERNOVA
2008;
F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
2005;
L
UTTMER
2005;
S
ENIK
2009;
S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2014). Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist somit nicht nur von absolutem Ein-
kommen abhängig, sondern auch von der relativen Position: ,,If everybody were to drive a Rolls
Royce, one would feel unhappy with a cheaper car"
(F
ERRER
-
I
-C
ARBONELL
2005:1001).
Das Vorgehen bei der zweiten und dritten Hypothese wie bereits im theoretischen Kapi-
tel begründet wurde dient u.a. der Überprüfung der relativen Einkommenshypothese.
3.2.1
Einkommensdifferenzen innerhalb/zwischen Bildungsgruppen
In F
ESTINGER
s Arbeit von 1954 heißt es: ,,There exists, in the human organism, a drive to evaluate
his opinions and his abilities"
(ebd.117) und weiter: "[...] people evaluate their opinions and abilities
by comparison respectively with the opinions and abilities of others"
(ebd.118). Darauf begründet wird
davon ausgegangen, dass sich Menschen grundsätzlich mit anderen vergleichen. Wie bereits
kurz erläutert wurde, vergleichen sich Individuen vor allem mit anderen, die ihnen ähnlich
sind. Empirische Studien fanden außerdem heraus, dass es einen signifikanten Zusammen-
hang zwischen sozialem Vergleich und der Bildung gibt (S
CHNEIDER
&
S
CHUPP
2014:771).
Diesbezüglich wird für die nächste Analyse die Variable der Bildung mit aufgenommen,
wobei zwischen Personen mit niedriger Bildung (ohne Schulabschluss oder Hauptschulab-
schluss), mittlerer Bildung (Realschulabschluss/mittlere Reife) und Personen mit hoher
Bildung (Abitur oder Fachhochschulreife) unterschieden wird. Wie anzunehmen ist, sind
Bildung und Einkommen positiv korreliert, sodass die höchste Bildungsgruppe durch-
schnittlich mehr verdient als die erste und zweite, die zweite mehr als die erste (siehe Tabel-
le 2.4). Es wird angenommen, dass sich Personen innerhalb dieser drei Gruppen unterei-
nander vergleichen, was daran gemessen wird, ob Individuen innerhalb einer Bildungs-
gruppe mit einem Einkommen unterhalb des Durchschnitts in dieser Gruppe, eine niedri-
gere Lebenszufriedenheit aufweisen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783961161027
- ISBN (Paperback)
- 9783961166022
- Dateigröße
- 385 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2017 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- sozialer Vergleich Lebenszufriedenheit Einkommen relatives Einkommen SOEP Stata
- Produktsicherheit
- Diplom.de