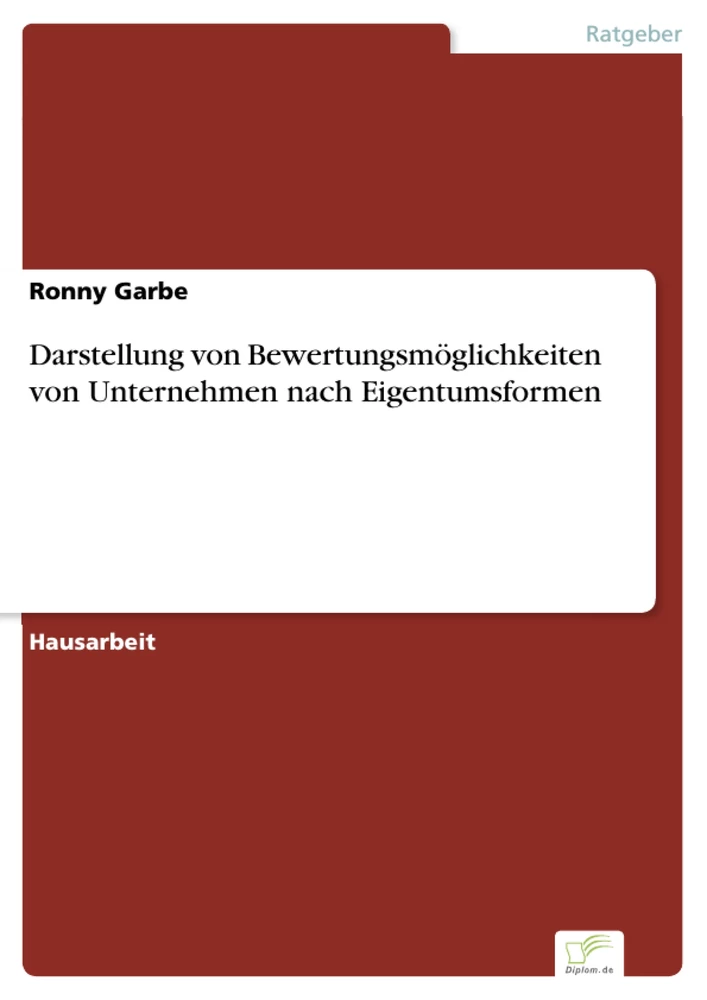Darstellung von Bewertungsmöglichkeiten von Unternehmen nach Eigentumsformen
©2013
Hausarbeit
20 Seiten
Zusammenfassung
Es gibt unterschiedliche Motive eine Unternehmensbewertung durchzuführen. Davon unabhängig existieren zahlreiche Methoden, die auf verschiedene Weisen den Wert einer Unternehmung bestimmen können. Das Resultat dieser Vielzahl unterschiedlicher Verfahren kann dabei extrem divergieren, da jedes Unternehmensbewertungsverfahren andere Faktoren einbezieht.
Das Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich unterschiedlicher Unternehmensbewertungsmethoden in Hinsicht auf Eigentumsformen, sowie die Darlegung einer kurzen Gesamtübersicht des Unternehmensbewertungsbereichs. Es wird sich vor allem auf das Multiplikatorverfahren sowie auf das Ertragswertverfahren konzentriert, welche im Bereich der Wirtschaftswissenschaften als am häufigsten benutzten Methoden gelten. Darüber hinaus wird im letzten Abschnitt die Unternehmensbewertung bei der Änderung von Eigentumsverhältnissen erklärt und dargestellt.
Somit wird im Folgenden zunächst auf die Definition und die Anlässe einer Unternehmensbewertung eingegangen. Es folgt eine Gesamtübersicht über die existierenden Eigentumsformen und Unternehmensbewertungsverfahren. Das Fazit fasst auf den vorherigen Ausführungen basierend die Ergebnisse zusammen.
Das Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich unterschiedlicher Unternehmensbewertungsmethoden in Hinsicht auf Eigentumsformen, sowie die Darlegung einer kurzen Gesamtübersicht des Unternehmensbewertungsbereichs. Es wird sich vor allem auf das Multiplikatorverfahren sowie auf das Ertragswertverfahren konzentriert, welche im Bereich der Wirtschaftswissenschaften als am häufigsten benutzten Methoden gelten. Darüber hinaus wird im letzten Abschnitt die Unternehmensbewertung bei der Änderung von Eigentumsverhältnissen erklärt und dargestellt.
Somit wird im Folgenden zunächst auf die Definition und die Anlässe einer Unternehmensbewertung eingegangen. Es folgt eine Gesamtübersicht über die existierenden Eigentumsformen und Unternehmensbewertungsverfahren. Das Fazit fasst auf den vorherigen Ausführungen basierend die Ergebnisse zusammen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abb Abbildung
AG Aktiengesellschaft
AO Abgabenordnung
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
Bsp. Beispiel
Co. Compagnie
DCF Discounted Cash Flow
EBIT Earnings Before Interest and Tax
Euro
EStG Einkommensteuergesetz
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesetz
GuV Gewinn- und Verlustrechnung
HGB Handelsgesetzbuch
IAS International Accounting Standards
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer
IFRS International Financial Reporting Standards
KG Kommanditgesellschaft
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
OHG Offene Handelsgesellschaft
o.V. ohne Verfasser
StG Stille Gesellschaft
Vgl. Vergleich
1. Einleitung
Mit dieser Arbeit sollen die vielfältigen und umfangreichen Möglichkeiten
einer Unternehmensbewertung im heutigen Wirtschaftsleben dargestellt
werden.
Da aus unterschiedlichen Gründen, wie Erwerb, Verkauf, Aufnahme oder
Ausscheiden eines Gesellschafters oder Auflösung von Betrieben und
Einrichtungen der Wert eines Unternehmens sachlich und zutreffend
bewertet werden muss, haben sich in dieser Ausrichtung der
Betriebswirtschaftslehre ein breit gegliedertes Wissen mit den
entsprechenden Methoden angesammelt, die teilweise auch kontrovers
diskutiert werden.
Gleichzeitig
werden
in
dieser
Thematik
vom
IDW
(Institut
der
Wirtschaftsprüfer)
und
den
genossenschaftlichen
Prüfungsverbänden Grundsätze festgelegt, wann Unternehmensbewertungen
durchzuführen sind.
Bei der durchgeführten Betrachtung der Eigentumsformen ist das
Hauptaugenmerk einmal darauf zu richten wie viele Ausprägungen es in der
Bundesrepublik gibt und weitergehend auf das Vorhandensein der
unterschiedlichen finanziellen Aussagen eines Betriebes.
Bei der Betrachtung der Methoden zur Unternehmensbewertung muss eine
Aussage zur Qualität einer konkreten Anwendung getätigt werden und
welche gesetzlichen Vorgaben es gibt. Davon hängt dann folgend ab,
welcher Aufwand unter Beachtung der Kosten - Nutzen - Relation
betrieben werden muss.
Weiterhin ist mit in Betracht zu ziehen, dass Unternehmensbewertungen
nicht nur bei großen oder international aufgestellten Unternehmungen
durchzuführen sind, sondern ein Großteil dieser Tätigkeit in den
Unternehmensformen der mittleren und kleinen Betriebe stattfindet.
- 1 -
2. Eigentumsformen von Unternehmen
2.1 Rechtsformen des Privaten Rechts
Zur Gründung eines Unternehmens besteht in der Bundesrepublik
Deutschland generell eine Wahlfreiheit in Bezug auf die Rechtsformwahl.
Es gibt hierzu einige Ausnahmen wo die Betriebsart einem Formenzwang
unterliegt (z. B. Genossenschaften, Hypothekenbanken und Kapitalgesell-
schaften). Hier hat der Gesetzgeber klare rechtliche Vorgaben in Form von
speziellen Gesetzen erlassen. Die Wahl der Rechtsform geht wesentlich mit
den wirtschaftlichen Zielen, steuerlichen Gegebenheiten und der Form der
Absicherung einher.
2.1.1 Personengesellschaften
Einzelunternehmung: Die Stellung der Einzelunternehmen richtet sich
besonders nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB). Der Inhaber betreibt seine Geschäfte auf eigene
Rechnung und haftet mit seinem gesamten Vermögen. Gleichzeitig ist
festzuhalten, dass man bei einer Handelstätigkeit die Bezeichnung
(Ist) Kaufmann führen muss und diese Geschäftstätigkeit im Handelsregister
eingetragen wird. Bei einer nicht überwiegend handelsgewerblichen
Tätigkeit besteht die Möglichkeit sich als (Kann) Kaufmann in das
Handelsregister eintragen zu lassen.
Die Leitung des Betriebes obliegt dem Unternehmer, dem der Gewinn oder
der Verlust uneingeschränkt zufällt.
Das Einzelunternehmen hat bis zu einer bestimmten Größe keine
Prüfungspflichten und keine Pflichten zur Veröffentlichung zu erfüllen und
kann dahingehend seinen Gewinn durch die Einnahmenüberschussrechnung
ermitteln. Bei kaufmännischer Tätigkeit oder ab einem Jahresumsatz von
500.000 bzw. einem steuerlichen Gewinn von mehr als 50.000 pro
Abrechnungsjahr (Periode) ist der Unternehmer verpflichtet nach
§ 141 Abgabenordnung (AO)
1
und § 4 Einkommensteuergesetz (EStG)
2
die Buchführung zu erstellen und jährliche Abschlüsse durchzuführen.
1 Bundesministerium der Justiz (1977): Abgabenordnung, http://www.gesetze-im-internet.
de/ao_1977/_141.html, letzter Zugriff am 04.07.2013
2 o.V. (2006): Steuergesetze 1, S. 24
- 2 -
Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Mit der GbR können sowohl
wirtschaftliche als auch ideelle Ziele verfolgt werden.
Bei der wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmensform können nicht nur
natürliche, sondern auch juristische Personen als Gesellschafter
vertraglich festgelegt sein. Der Status wird wesentlich durch das BGB (§§
705 ff.)
3
bestimmt, weshalb sie auch BGB- Gesellschaft genannt wird. Die
GbR wird, wenn nicht anders vereinbart, gemeinschaftlich geleitet und
vertreten. Alle Gesellschafter sind auch Gesamtschuldner und werden damit
gleichmäßig am Gewinn und Verlust beteiligt. Eine Pflicht zur
Veröffentlichung der Unternehmenszahlen, oder zur Rechnungslegung und
Prüfung besteht nicht. In der Regel reicht eine einfache Gewinn- und
Verlustrechnung zum Jahresabschluss. Die GbR ist durch Beschluss des
Bundesgerichtshofes seit 2001 bedingt rechtsfähig.
Offene Handelsgesellschaft: Die OHG kann als die Grundform der
Zusammenarbeit von Kaufleuten betrachtet werden. Der Zusammenschluss
erfolgt von mindestens zwei Gesellschaftern und wird über einen Gesell-
schaftsvertrag begründet. Rechtlich geregelt wird die OHG insbesondere
durch das Handelsgesetzbuch (§§ 105 ff.)
4
und das Bürgerliche
Gesetzbuch. Die Eintragung ins Handelsregister hat zum Beginn der
Geschäftstätigkeit zu erfolgen. Vertreten wird die Gesellschaft von allen
Gesellschaftern gleichberechtigt und in voller Handlungsbreite, es sei denn
vertraglich wurde eine andere Regelung festgelegt. Die Haftung erfolgt
durch alle Gesellschafter zu gleichen Teilen unbeschränkt.
Über das Publizitätsgesetz ist bei großen OHG (Bilanzsumme > 65 Mio. )
die Prüfungs- und Offenlegungspflicht für jede Periode vorgesehen.
Bei kleineren OHG ist über die Gewinn- und Verlustrechnung und die
Handelsbilanz ein finanzieller Einblick in das Unternehmen gewährleistet.
Dies setzt natürlich eine ordnungsgemäße Buchführung über das gesamte
Geschäftsjahr voraus.
3 Kropholler, J. (2008): Studienkommentar BGB, S. 509
4 Overhoff, A., Sanfleber-Decher, M., Schruff, W. (1990): Unternehmensformen und
Rechnungslegung, S. 19
- 3 -
Kommanditgesellschaft: Bei der KG handelt es sich betreffend der
Haftungsfragen um eine abgewandelte offene Handelsgesellschaft mit
mindestens zwei Beteiligten. Hierbei nimmt der Komplementär die Rolle
des voll haftenden Gesellschafters ein, welcher auch eine juristische Person
sein kann. Der Kommanditist haftet nur in Höhe seiner getätigten Einlagen
und ist von der Geschäftsführung sowie der Vertretung nach außen
ausgeschlossen. Eine Offenlegungspflicht der Geschäftszahlen besteht
genauso wie bei der OHG nur für große Kommanditgesellschaften.
Gleichwohl ist für jedes Geschäftsjahr eine Bilanz sowie eine Gewinn- und
Verlustrechnung zu erstellen. Die gesetzlichen Vorgaben sind besonders im
Handelsgesetzbuch (§§ 161 ff.)
5
festgehalten.
Stille Gesellschaft: Die Stille Gesellschaft stellt für den Inhaber oder die
Inhaber eines Handelsunternehmens eine gute und sichere Beschaffung von
Fremdkapital dar. Durch die stille Beteiligung mittels eines
Gesellschaftsvertrages fallen keine Fremdkapitalzinsen an und die Einlage
geht in das Firmeneigentum über. Eine Ausschüttung erfolgt nur bei
positiver Jahresbilanz, die Verlustbeteiligung erfolgt in der Regel nicht.
6
Ein Mitspracherecht des stillen Gesellschafters ist grundsätzlich nicht
vorgesehen, es sei denn vertraglich wurde etwas anderes vereinbart.
Es wird unterschieden zwischen typischer und atypischer stiller Beteiligung.
Da die Beteiligung an den dafür in Frage kommenden Unternehmensformen
stattfindet, gelten hier die gleichen Bedingungen zur Erstellung und
eventuellen Offenlegung von wirtschaftlichen Jahresergebnissen.
2.1.2 Kapitalgesellschaften
Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Die Errichtung einer GmbH kann
durch eine oder mehrere Personen erfolgen. Sie hat den Charakter einer
juristischen Person mit eigener Rechtsfähigkeit. Die notarielle Beurkundung
des Gesellschaftsvertrages und die anschließende Eintragung ins Handels-
register sind zwingende Voraussetzungen für einen Geschäftsbetrieb.
5 o.V. (2008): Handelsgesetzbuch, S. 46
6 o.V. (2008): Handelsgesetzbuch, S. 49
- 4 -
Die Haftung gegenüber den Gläubigern erfolgt nur in Höhe des
Stammkapitals, welches mindestens 25.000 betragen muss. Der oder die
Gesellschafter bestimmen einen oder mehrere Geschäftsführer.
Die Gesellschafterversammlung als oberstes Organ trifft alle
Entscheidungen im Rahmen der Satzung und des GmbH- Gesetzes.
7
Alle Geschäftsvorfälle müssen für die umfangreiche Rechnungslegung
lückenlos dokumentiert werden. Die Buchführung hat sowohl zeitlich
(Grundbuch), als auch sachlich geordnet (Hauptbuch) zu erfolgen.
Damit ist es unter anderem auch unterjährig möglich einen Überblick über
die Finanz- und Ertragslage und das Vermögen der Gesellschaft zu haben.
Am Ende des Geschäftsjahres sind eine Bilanz mit Anhang, eine Gewinn-
und Verlustrechnung, sowie der Lagebericht zu erstellen. Hierbei sind das
Bilanzrichtliniengesetz, das Handelsgesetzbuch und das GmbH- Gesetz
zu beachten. Die Unterlagen sind so zu fertigen, dass ein tatsächliches Bild
der Finanz- und Ertragslage sowie des Vermögens der Kapitalgesellschaft
ersichtlich wird.
8
Ab einer
bestimmten Bilanzsumme, Umsatzgröße oder
Mitarbeiteranzahl ist eine Jahresabschlussprüfung durch einen
Abschlussprüfer durchzuführen.
Aktiengesellschaft: Die Aktiengesellschaft ist die stark vertretene
Unternehmensform für Großbetriebe in der Bundesrepublik Deutschland.
Dies ist besonders damit zu begründen, dass eine Kapitalbeschaffung über
Aktien in großem Umfang realisiert werden kann. Gleichzeitig ist es mit
dieser Unternehmensprägung möglich, vielen Personen einen Anteil
(Aktien) an der Gesellschaft einzuräumen. Die AG ist eine
Handelsgesellschaft mit eigener Rechtsfähigkeit. Ihre Gründung erfordert
mindestens ein Grundkapital von 50.000 und einen oder mehrere
Gesellschafter. Auch hier sind ein notariell beurkundeter Vertrag und eine
Eintragung ins Handelsregister erforderlich.
Die Organe des Unternehmens sind Vorstand, Aufsichtsrat und
Hauptversammlung.
7 Overhoff, A., Sanfleber-Decher, M., Schruff, W. (1990): Unternehmensformen und
Rechnungslegung, S. 43
8 o.V. (2008): Handelsgesetzbuch, S. 59
- 5 -
Der Publizitätsumfang ist von der Größe der Aktiengesellschaft abhängig.
9
Grundsätzlich hat die AG insbesondere die Anforderungen des
Aktiengesetzes und des Handelsgesetzbuches zu erfüllen, was zur Erstellung
der jährlichen Bilanz mit Anhang, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie des
Lageberichtes führt. Ab einer
bestimmten Bilanzsumme, Umsatzgröße oder
Mitarbeiteranzahl hat zutreffend auch die AG eine Jahresabschlussprüfung
durch einen Abschlussprüfer durchzuführen.
Bei Konzernabschlüssen nach HGB oder IFRS- Regeln sind weiterhin die
Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalspiegel mit aufzunehmen.
2.1.3 Mischformen von Gesellschaften
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft:
Die GmbH & Co. KG ist im rechtlichen Sinn eine besondere Form der
Kommanditgesellschaft, deren einziger persönlich haftender Gesellschafter
(Komplementär) die GmbH ist. In den meisten Fällen sind dies dann
personell der oder die Gesellschafter der GmbH. Da die GmbH & Co. KG
eine Personengesellschaft ist, finden hier hauptsächlich die Vorschriften des
HGB für eine KG, aber auch das GmbHG ihre Anwendung. Das betrifft
einerseits die Buchführungen und die Jahresabschlüsse, die zweimal zu
erstellen sind, als auch die Berücksichtigung der speziellen
Steueranforderungen (Körperschaftssteuer und Einkommensteuer) in dieser
Form eines Unternehmens.
Bei der Publizitätspflicht wird die GmbH & Co. KG wie eine
Kapitalgesellschaft behandelt.
Kommanditgesellschaft auf Aktien: Die KGaA ist eine Gesellschaftsform
mit eigener Rechtspersönlichkeit und mit einem in Aktien aufgeteiltem
Grundkapital (mindestens 50.000 ). Sie weist Merkmale einer
Personengesellschaft und einer Aktiengesellschaft auf, wird aber im
Wesentlichen wie eine AG behandelt. Der Komplementär haftet mit seinem
9 Overhoff, A., Sanfleber-Decher, M., Schruff, W. (1990): Unternehmensformen und
Rechnungslegung, S. 225
- 6 -
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (PDF)
- 9783961160907
- Dateigröße
- 296 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Südwestfalen; Abteilung Meschede – Abteilung Meschede
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- Unternehmen Eigentum Multiplikatorverfahren Ertragswertverfahren Unternehmensbewertung
- Produktsicherheit
- Diplom.de