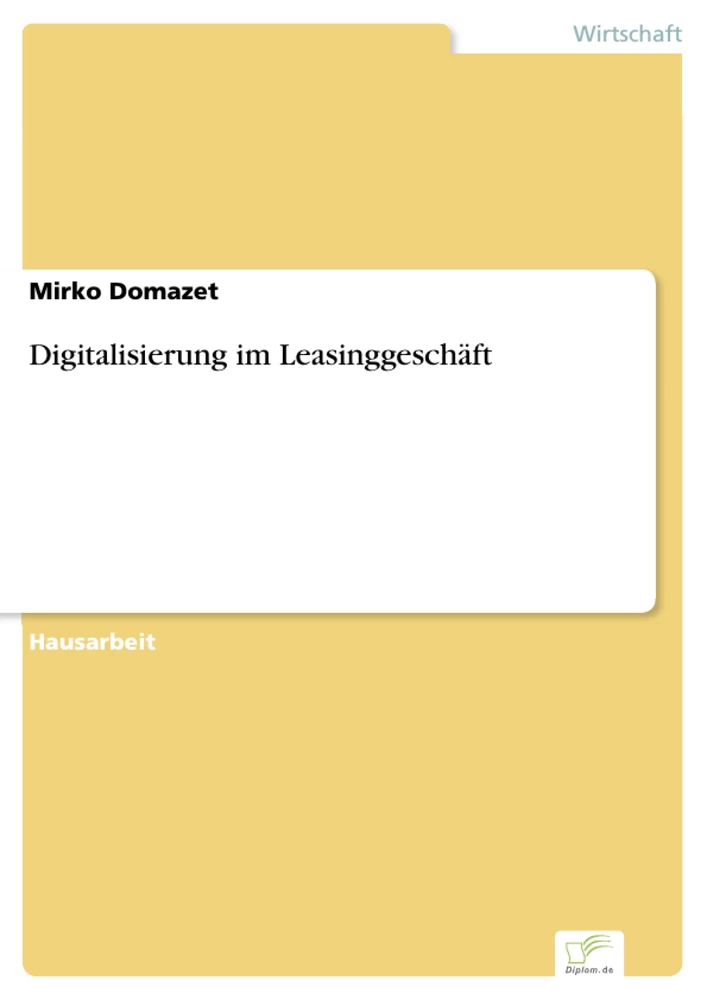Zusammenfassung
Als Akteur in der Wirtschaft sehen sich Leasinggesellschaften aktuell mit verschiedenen Themen konfrontiert. Eine davon ist die Digitalisierung und deren mögliche Auswirkungen auf ihre Geschäftsprozesse. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit hat sich der Verfasser insbesondere mit den Möglichkeiten beschäftigt, wie ein Leasinggeschäft online abgewickelt werden kann und welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Eigentumsübertragung, sowie laufende Abwicklung der Leasingbeziehung, ausübt. Dabei fokussiert er sich auf das Mobilienleasing und deren Objektgruppen, die nicht als Kraftfahrzeuge zu charakterisieren sind.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
II
Abkürzungsverzeichnis
CRM
Customer-Relationship-System
IT
Informationstechnologie
LSG
Leasinggesellschaft
SOA
Service Orientieted Architecture
III
Abbildungsverzeichnis
· Abbildung 1: Ein möglicher Prozess im Leasingun-
ternehmen
· Abbildung 2: 3 Ebenen-Modell einer SOA
Seite
1
2
1
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
und
Zielsetzung
Mit einem Anteil von 15 %
1
an den Gesamtinvestitionen ist das Leasinggeschäft
eine wichtige Finanzierungsform in Deutschland. Sie wird als Finanzdienstleis-
tung von Leasinggesellschaften (im nachfolgenden LSG bezeichnet) erbracht, die
damit zugleich zu den größten privaten Investoren in Deutschland zählen.
2
Als
Akteur in der Wirtschaft sehen sie sich aktuell mit verschiedenen Themen kon-
frontiert. Eine davon ist die Digitalisierung und deren mögliche Auswirkungen
auf ihre Geschäftsprozesse. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit möchte sich der
Verfasser insbesondere mit den Möglichkeiten beschäftigen, wie ein Leasingge-
schäft online abgewickelt werden kann und welche Auswirkungen die Digitalisie-
rung auf die Eigentumsübertragung, sowie laufende Abwicklung der Leasingbe-
ziehung, ausübt. Dabei fokussiert sich der Verfasser auf das Mobilienleasing und
deren Objektgruppen, die nicht als Kraftfahrzeuge zu charakterisieren sind. Die
untersuchten Objektgruppen machten im Jahr 2014 einen Anteil von ca. 30,0 %
3
am gesamten Neugeschäft des Mobilienleasings aus.
1.2. Gang der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Nach diesem ersten einlei-
tenden Kapital erfolgt in Kapitel zwei eine Einführung in das Mobilienleasing.
Danach folgt in Kapitel drei eine Präsentation des bestehenden Prozesses, der
durch einen Leasingantrag bei der Leasinggesellschaft angestoßen wird. Hierbei
untersucht der Verfasser, sowohl den fachlichen Aufbau, als auch dessen aktuelle
Ausgestaltung in den LSG. In Kapitel vier wird auf dem Ergebnis dieser Untersu-
chung angeknüpft und auf Basis bestehender Technologien Lösungsansätze zur
Beantwortung der Fragestellungen präsentiert. Zum Ende erfolgt in den letzten
beiden Unterkapiteln des Kapitels vier eine Betrachtung der Auswirkungen eines
komplett digitalisierten und automatisierten Leasingprozesses auf die laufende
Abwicklung, sowie Eigentümersituation am Leasingobjekt.
1
Vgl. BDL e.V., Leasing 2015, S. 33, (Dokument 2 der CD).
2
Vgl. BDL e.V., Leasing 2015, S. 10, (Dokument 2 der CD).
3
Vgl. BDL e.V., Leasing 2015, S. 35, (Dokument 2 der CD).
2
2. Einführung in das Mobilienleasing
Sämtliche mobilen materiellen Ausrüstung- oder Immaterialgüter werden als Mo-
bilien definiert.
4
Mit einem Gesamtvolumen von ca. 51,0 Mrd.
5
im Jahr 2015
machten Mobilien die größte Leasinggruppe in Deutschland aus. Das gesamte
Leasingvolumen in Deutschland umfasste 2015 zum Vergleich nur ca. 52,2 Mrd.
6
, sodass ca. 1,2 Mrd.
7
dem Immobilienleasing zuzuordnen sind. Demzufolge
ist das Mobilienleasing der bedeutendste Sektor im deutschen Leasinggeschäft.
Hauptursache hierfür ist die vergleichsmäßig seltene Leasingfähigkeit von Immo-
bilien, sowie der Anstieg innovativer strukturierter Finanzierungsformen als kon-
kurrierendes Substitut für Immobilieninvestitionen. Das Neugeschäft im Mobi-
lienleasing wird über fünf Vertriebswege generiert. Gemäß dem Report ,,Leasing
2015" vom Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen e.V. wird mit ca. 55,0
% der größte Anteil über Händler und Hersteller gefolgt vom eigenen Außen-
dienst mit ca. 29,0 % vertrieben. Lediglich ca. 10,0 % kommen über den Ver-
triebsweg Bank, sowie ca. 6,0 % über eigenständige Vermittler, deren Geschäfts-
model auf die Akquise von Leasingkunden ausgerichtet ist. Der geringste Anteil
wird mit unter einem 1,0 % über den Vertriebsweg E-Commerce erbracht. Bei
diesem Vertriebsweg kontaktiert der Interessent ohne Mitwirken eines Dritten die
LSG direkt über ihr eigenes Webportal. Der besondere Vorteil dieses Distributi-
onskanals ist es Objekte mit geringem Anschaffungswert wirtschaftlich effizient
vermarkten zu können.
8
Somit würde sich das Mobilienleasing durch ihr durch-
schnittliches Leasingvolumen von ca. 28.000
9
je Leasingobjekt für diesen Ver-
triebsweg besonders gut eignen. Ein Grund für die im Widerspruch stehende bis-
herige Ausprägung ist die fehlende Möglichkeit das Leasinggeschäft unmittelbar
nach der Beantragung auch online abzuschließen.
4
Vgl. Rinderknecht, Thomas M., (1984), Leasing von Mobilien, S. 12.
5
Vgl. Städtler, Arno, (2015), Leasing und Anlageinvestitionen, S. 5, (Dokument 9 der CD).
6
Vgl. Städtler, Arno, (2015), Leasing und Anlageinvestitionen, S. 5, (Dokument 9 der CD).
7
Vgl. Städtler, Arno, (2015), Leasing und Anlageinvestitionen, S. 5, (Dokument 9 der CD).
8
Vgl. BDL e.V., Leasing 2015, S. 39, (Dokument 2 der CD).
9
Eigene Berechnung, die auf Basis der gesamten Verträge, sowie des Gesamtvolumens aus dem
Jahr 2014 ermittelt wurde.
3.
Zu
ab
K
Pr
Q
W
su
sc
te
go
88
10
11
de
12
gle
so
. Vom Lea
3.1. Der ,,
ur Beantwo
bgewickelt w
Kreditentsche
rozess"
10
be
Quelle: Sauerl
Wie in Abbil
ung der Kun
chaftlich Be
es erfolgt de
olisten, wie
81/200s2
11
,
Vgl. Afb App
Diese beiden
enen europäisc
Die PEP-List
eich zum norm
onenkreis wird
asingantrag
,,Originatio
ortung der
werden kan
eidungsproz
ezeichnet w
Abbildung
land, Axel, (20
ldung 1 zu e
ndenstamm
erechtigten g
er Abgleich
e z.B. der E
der PEP
12
-
plication Servc
EG Verordnu
che Finanzinst
te enthält alle n
malen Bürger
d in der EG Ri
g zum Leas
on-Prozess"
Fragestellun
nn, möchte s
zess innerh
ird, beschäf
g 1: Ein mögli
016): Aufbau
(Dok
erkennen is
daten, die u
gemäß § 3
des wirtsch
EU Financia
- oder der O
cies (2015), S
ungen umfasse
titute keine G
natürliche Per
strengeren An
ichtlinie 2006/
3
singvertrag
"
ungen, ob u
sich der Ve
halb einer
ftigen.
icher Prozess i
von Vendor-L
kument 11 der
t beginnt de
unter ander
Geldwäsch
haftlich Ber
al Sanction
OFAC
13
-Lis
Steigerung der
en natürliche u
Geschäftsbezie
rsonen, die als
nforderungen
/70 definiert.
g
und wie ein
erfasser dies
LSG, der
im Leasingun
Leasing im Ze
r CD).
er Prozess a
em für die
hegesetz ben
rechtigten m
List gemäß
ste. Als Dri
r Automation,
und juristische
hung unterhal
s politisch exp
zur Geldwäsc
n Leasingge
ser Arbeit n
auch als
ternehmen.
ichen von Ind
als Erstens m
Identifizier
nötigt werde
mit den aktu
ß EG 2580/2
ittes folgt d
S. 3, (Dokum
e Personen, so
lten dürfen.
ponierte Perso
che unterliege
eschäft onli
näher mit de
,,Originatio
dustrie 4.0, S.
mit der Erfa
rung des wi
en. Als Zwe
uellen Emba
2001 und E
die Einholu
ment 1 der CD)
owie Staaten m
onen im Ver-
en. Dieser Per-
ine
em
on-
7,
as-
irt-
ei-
ar-
EG
ung
).
mit
-
4
von Bonitätsdaten von externen Anbietern, wie z.B. der Schufa Holding AG oder
der Creditreform AG. Kombiniert mit weiteren abgefragten Bonitätsangaben, die
in der unternehmensindividuellen Scorecard definiert sind, entwickelt die LSG im
vierten Schritt ein internes Scoring.
14
Das interne Scoring quantifiziert die Aus-
fallwahrscheinlichkeit des Interessenten.
15
Als Fünftes erfolgt ein Abgleich des
internen Scorings mit den unternehmensindividuellen Vergaberichtlinien. Befin-
det sich das Scoring nicht innerhalb der Vergaberichtlinien wird der Antrag abge-
lehnt. Alternativ erfolgt im sechsten Prozessschritt die Einholung interner und
externer Daten, um den Wiederveräußerungswert des Leasingobjekts bestimmen
zu können. Durch die Kombination von internem Scoring und dem Forderungsbe-
trag der LSG im Insolvenzfall des Leasingnehmers kann der Risikoparameter
Loss Given Default ermittelt werden. Das Loss Given Default zeigt die Verlust-
quote der LSG an die im Falle einer Zwangsverwertung nach Abzug des Verwer-
tungserlöses erreicht werden kann.
16
Mit dem internen Scoring und dem Loss
Given Default besitzt die LSG alle notwendigen Kennzahlen, um ein entspre-
chend maximales Obligo
17
, unter Berücksichtigung des Leasingobjekts als Si-
cherheit, ermitteln zu können. Ist das Obligo größer, als die Anschaffungskosten
des beantragten Leasingobjekts, erfolgt abschließend die Ausstellung eines Lea-
singvertrags in Schriftform
18
und falls nicht wird der Antrag abgelehnt. Somit
lässt sich festhalten, dass der gesamte Prozess der Antragprüfung bis zur Ver-
tragserstellung aus neun nacheinander folgenden Einzelschritten besteht von de-
nen bis zu einem Drittel durch die Zusammenarbeit mit Dritten erfolgt. Damit ein
Leasinggeschäft komplett online abgewickelt werden kann, bedarf es somit der
Bereitschaft aller im Leasingprozess beteiligten Unternehmen diesen automatisie-
ren zu wollen.
13
Die OFAC-Liste wird von dem Office of Foreign Assets Control Department der USA bestimmt
und enthält juristische und natürliche Personen, sowie Staaten mit denen ein Unternehmen mit Sitz
in den USA keine Geschäftsbeziehung unterhalten darf.
14
Vgl. Weichert, Thilo; Kamp, Meike, (2005), Scoringsysteme zur Beurteilung der Kreditwürdig-
keit, S. 50, (Dokument 10 der CD).
15
Vgl. Weichert, Thilo; Kamp, Meike, (2005), Scoringsysteme zur Beurteilung der Kreditwürdig-
keit, S. 25, (Dokument 10 der CD).
16
Vgl. Honal, Martin, (2009), Loss Given Default von Mobilien, S. 32.
17
Obligo ist im Finanzwesen ein Begriff für eine Verbindlichkeit bzw. einen Kreditrahmen, den
die Bank dem Kunden gewähren kann.
18
Vgl. Skusa, Nico R., (2012), Handbuch Leasing, S. 92.
5
3.2. Der ,,Origination-Prozess" in der Praxis
Im Nachfolgenden möchte der Verfasser dieser Arbeit sich näher mit der Umset-
zung des fachlichen ,,Origination-Prozesses" innerhalb einer LSG beschäftigen.
Studien belegen, dass der ,,Origination-Prozess" einer LSG überwiegend über
komplexe veraltete Informationstechnologiesysteme, die auch als Legacy Syste-
me
19
bezeichnet werden, abgewickelt wird.
20
Legacy Systeme erfordern einen
hohen Anteil manueller Tätigkeiten, sodass durchschnittlich 25 Personen im
,,Origination-Prozess" beteiligt sind.
21
Dieser hohe Anteil steigert die Wahr-
scheinlichkeit von menschlichen Fehlern und den damit verbundenen zusätzlichen
Kosten.
22
Allein während der Kundenkontoeröffnung werden durchschnittlich ca.
50,0 %
23
des anfallenden Papiers wieder verworfen. Eine komplette Onlineab-
wicklung des ,,Origination-Prozesses" besitzt somit ein hohes Kosteneinsparungs-
und Effizienzsteigerungspotential. Dennoch gibt es einige Prozessschritte die be-
reits heute ganz oder teilweise digitalisierbar sind. Hierzu zählt die Kunden-
stammdatenerfassung die über ein Webportal direkt vom Vermittler oder dem
Kunden online durchgeführt werden kann. Auch die weitere Verarbeitung, bei den
Prozessschritten ,,Abgleich mit Embargolisten" und ,,Anfrage externen Bonitäts-
daten", kann heutzutage digital und online durchgeführt werden.
24
25
Weitere Pro-
zessschritte, wie die Ermittlung des LGD oder des Obligos, können ebenfalls be-
reits heute mit spezialisierter IT-Software durchgeführt werden. Dies führt zu ei-
ner monolithischen und siloartigen IT-Systemlandschaft
26
, die sich in Form der
bereits beschrieben Legacy Systeme wiederspiegeln und bei LSG bis zu 90,0 %
des jährlichen IT-Budgets in Anspruch nehmen.
27
19
Legacy-Systeme sind alte eigenentwickelte Informationstechnologiesysteme, die sich durch eine
große Anzahl an Schnittstellen und einer hohen Komplexität auszeichnen.
20
Vgl. Byrnes, Steve; Donnary, Michael; Baez, Michael; u.a., (2015), Business Performance Index
2014/2015, S. 7, (Dokument 3 der CD).
21
Vgl. Byrnes, Steve; Donnary, Michael; Baez, Michael; u.a., (2015), Business Performance Index
2014/2015, S. 9, (Dokument 3 der CD).
22
Vgl. Byrnes, Steve; Donnary, Michael; Baez, Michael; u.a., (2015), Business Performance Index
2014/2015, S. 9, (Dokument 3 der CD).
23
Vgl. Byrnes, Steve; Donnary, Michael; Baez, Michael; u.a., (2015), Business Performance Index
2014/2015, S. 8, (Dokument 3 der CD).
24
Vgl. Creditreform AG (Hrsg.), (2011), Sanktionslisten, S. 1 (Dokument 9 der CD).
25
Vgl. Creditreform AG (Hrsg.), (2015), Chancen, Risiken minimieren, S. 4 (Dokument 8 der
CD).
26
Vgl. Manhart, Klaus; Zimmermann, Mark, (2009), SOA, BI, CRM, ECM, S. 49.
27
Vgl. Byrnes, Steve; Donnary, Michael; Baez, Michael; u.a., (2015), S. 7, (Dokument 3 der CD).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783961160754
- Dateigröße
- 692 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule RheinMain – Insurance & Finance
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Januar)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- Leasing Wirtschaft Eigentum Eigentumsübertragung Mobilienleasing
- Produktsicherheit
- Diplom.de