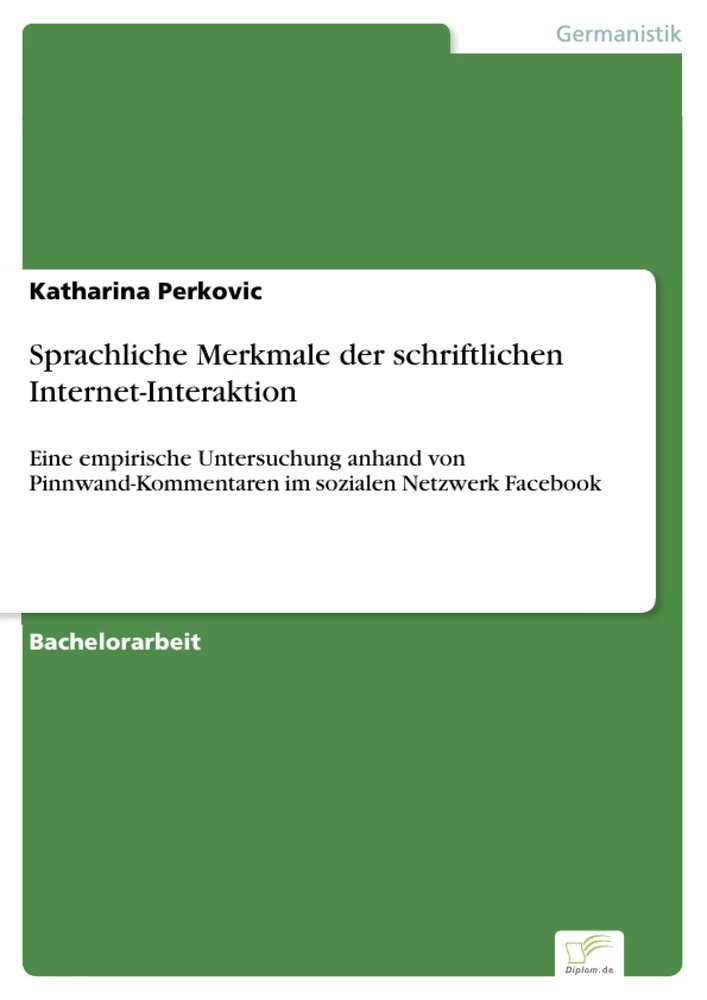Sprachliche Merkmale der schriftlichen Internet-Interaktion
Eine empirische Untersuchung anhand von Pinnwand-Kommentaren im sozialen Netzwerk Facebook
©2014
Bachelorarbeit
60 Seiten
Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen sprachlicher Gegebenheiten in der schriftlichen Internet-Interaktion. Der Hauptschwerpunkt bezieht sich hierbei auf sprachliche Merkmale innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook. Facebook ist ein weit verbreitetes soziales Netzwerk, das von vielen Menschen weltweit aktiv genutzt wird (vgl. Cantzler, Haupt, Oertel, 2010, 11). Nur wie kommunizieren wir dort, wenn wir online sind? Ändern wir unseren Schreibstil, sobald wir uns in einer virtuellen Welt befinden?
Zunächst wird das Medium Online-Kommunikation, sowie das damit einhergehende Internet näher beschrieben. Was genau können wir als Medium bezeichnen und wie funktioniert die Sprache im Internet? Es stellt sich die Frage, inwieweit wir unsere konventionelle Schreibart ablegen und der virtuellen Welt anpassen, sodass wir immer noch von jedem verstanden werden können (vgl. Dittmann, 2001, 27). Im weiteren Verlauf der Arbeit wendet sich die Autorin linguistischen Aspekten zu, die in der beschriebenen Facebook-Kommunikation vorliegen. Die Möglichkeit Pinnwand- Einträge zu kommentieren, lässt der linguistischen Analyse einen großen Freiraum. Unter besonderer Berücksichtigung der theoretischen Sachlage, werden in einer eigenen Studie ebenso sprachliche Merkmale bei Facebook herausgearbeitet und analysiert. In diesem praktischen Teil (4) werden anhand von Pinnwand-Einträgen sprachliche Merkmale sichtbar, die zunächst analysiert und schließlich ausgewertet werden. In dieser deskriptiven Vorgehensweise werden Pinnwand-Einträge von ausgewählten Facebook-Freunden zufällig selektiert. Diese werden schließlich kontrastiert und in Hinblick auf sprachliche Merkmale untersucht. Im Schlussteil werden die Ergebnisse der Studie zusammengefasst.
Zunächst wird das Medium Online-Kommunikation, sowie das damit einhergehende Internet näher beschrieben. Was genau können wir als Medium bezeichnen und wie funktioniert die Sprache im Internet? Es stellt sich die Frage, inwieweit wir unsere konventionelle Schreibart ablegen und der virtuellen Welt anpassen, sodass wir immer noch von jedem verstanden werden können (vgl. Dittmann, 2001, 27). Im weiteren Verlauf der Arbeit wendet sich die Autorin linguistischen Aspekten zu, die in der beschriebenen Facebook-Kommunikation vorliegen. Die Möglichkeit Pinnwand- Einträge zu kommentieren, lässt der linguistischen Analyse einen großen Freiraum. Unter besonderer Berücksichtigung der theoretischen Sachlage, werden in einer eigenen Studie ebenso sprachliche Merkmale bei Facebook herausgearbeitet und analysiert. In diesem praktischen Teil (4) werden anhand von Pinnwand-Einträgen sprachliche Merkmale sichtbar, die zunächst analysiert und schließlich ausgewertet werden. In dieser deskriptiven Vorgehensweise werden Pinnwand-Einträge von ausgewählten Facebook-Freunden zufällig selektiert. Diese werden schließlich kontrastiert und in Hinblick auf sprachliche Merkmale untersucht. Im Schlussteil werden die Ergebnisse der Studie zusammengefasst.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen sprachlicher Gegebenheiten in der
schriftlichen Internet-Interaktion. Der Hauptschwerpunkt bezieht sich hierbei auf
sprachliche Merkmale innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook. Facebook ist ein
weit verbreitetes soziales Netzwerk, das von vielen Menschen weltweit aktiv genutzt
wird (vgl. Cantzler, Haupt, Oertel, 2010, 11). Nur wie kommunizieren wir dort, wenn
wir online sind? Ändern wir unseren Schreibstil, sobald wir uns in einer virtuellen
Welt befinden?
Zunächst wird das Medium Online-Kommunikation, sowie das damit einhergehende
Internet näher beschrieben. Was genau können wir als Medium bezeichnen und wie
funktioniert die Sprache im Internet? Es stellt sich die Frage, inwieweit wir unsere
konventionelle Schreibart ablegen und der virtuellen Welt anpassen, sodass wir
immer noch von jedem verstanden werden können (vgl. Dittmann, 2001, 27).
Im weiteren Verlauf der Arbeit wende ich mich linguistischer Aspekte zu, die in der
beschriebenen Facebook-Kommunikation vorliegen. Die Möglichkeit Pinnwand-
Einträge zu kommentieren, lässt der linguistischen Analyse einen großen Freiraum.
Unter besonderer Berücksichtigung der theoretischen Sachlage, werden in einer
eigenen Studie ebenso sprachliche Merkmale bei Facebook herausgearbeitet und
analysiert. In diesem praktischen Teil (4) werden anhand von Pinnwand-Einträgen
sprachliche Merkmale sichtbar, die ich zunächst analysiere und schließlich auswerten
werde. In dieser deskriptiven Vorgehensweise werden Pinnwand-Einträge von
ausgewählten Facebook-Freunden zufällig selektiert. Diese werden schließlich
kontrastiert und in Hinblick auf sprachliche Merkmale untersucht.
Im Schlussteil stelle ich die Ergebnisse meiner Studie zusammen und versuche eine
Antwort auf all die gestellten Fragen zu finden. Es wird zudem deutlich, dass es
gewisse sprachliche Merkmale bei Facebook gibt, die unabdingbar sind.
1
2. Das Medium Online-Kommunikation
Um eine fundierte Analyse darlegen zu können, müssen wir uns zunächst vor Augen
halten, was das Medium Online-Kommunikation grundlegend beschreibt. Es gibt
allerhand Definitionen, die das Medium Online-Kommunikation beschreiben und
näher bringen können. Für jeden ist jedoch klar, dass ,,Medien gerade in Hinblick auf
Kommunikation eine Vermittler-Funktion haben" (Marx, Weidacher 2014, 50).
Ich stütze mich bei der Beschreibung des Mediums Online-Kommunikation auf die
Darlegungen von Marx und Weidacher (2014). Sie lehnen sich grundlegend in ihrer
Ausarbeitung auf McLuhans Medienbegriff: ,,All media are extensions of some
human faculty psychic or physical" (Marx, Weidacher, 2014, 48 zitiert nach:
McLuhan, Fiore 1967, 26). Demnach wird davon gesprochen, dass Medien weitaus
mehr als aus Fernsehen, Telefon, Internet oder Radio bestehen, denn auch Medien
dienen der Kommunikation, sowie der Verbreitung von Informationen. Medien
lassen sich in drei Kategorien einteilen (vgl. Marx, Weidacher, 2014, 50):
1. Verbreitungsmedien, 2. Kommunikationsmedien und 3. Speichermedien.
1. Unter Verbreitungsmedien verstehen die beiden eine Art von
Übertragungsmedien, die das Überwinden von räumlichen Entfernungen
ermöglichen. Diese Übertragung geschieht einseitig, da es das Ziel ist Informationen
von einem Sender an einen Empfänger zu vermitteln (vgl. Marx, Weidacher, 50).
Daher auch der Begriff der Übertragung. Trotz allem geht es nicht nur grundlegend
um die Überwindung von Distanzen, viel mehr nämlich auch um die Vergrößerung
des Adressatenkreises.
2. Kommunikationsmedien hingegen beschreiben den Austausch von Informationen
zwischen zwei Individuen (vgl. Marx, Weidacher, 51). Zunächst ging es um das
Ankommen der Information bei einem Empfänger hier spielt jedoch die zweiseitige
Kommunikation eine wichtige Rolle: der Kreis zwischen Sender und Empfänger.
Ebenso wird von einem ,,Wechsel der Rollen von Sender und Empfänger"
2
gesprochen (Marx, Weidacher 2014, 51). Dies zeigt uns, dass auch der Empfänger
aktiv an der Kommunikation teilnehmen kann und sich der Kreis zwischen Sender
und Empfänger sozusagen schließt.
3. Speichermedien hingegen beschreiben wie der Name aussagt, eine Möglichkeit
der Speicherung von Informationen. Im Gegensatz zur Überbrückung von
räumlichen Distanzen, geht es hierbei um die Überbrückung von zeitlichen
Distanzen. D.h., ,,wir müssen in solchen Fällen die Informationen für einen späteren
Zeitpunkt verfügbar halten, das heißt, wir müssen sie speichern" (Marx, Weidacher
2014, 51). Dadurch wird deutlich, dass wir in gewissen Situationen auf gewisse
Informationen zurückgreifen können. Um das Internet jedoch noch besser zu
verstehen, schaut man sich die Elemente eines Mediums nach Marx und Weidacher
(2014) an:
Sinnesmodalität:
die Sinnesorgane, die bei der
Verarbeitung der über das Medium
vermittelten Informationen beteiligt sind
Kanal:
die physikalische Grundlage des
Mediums bzw. der von ihm hergestellten
Verbindung
technischer Apparat
und seine Produkte:
die dem Medium zugrundeliegende
Technologie
Medieninstitution:
die soziale Institution, die das Medium
zur Verfügung stellt
Kommunikationsform/
mediale Gattung/
Textsorte:
die vom Medium ermöglichten und im
Medium gebräuchlichen kulturellen
Praxen der Informationsverbreitung und
Kommunikation
Semiotischer Modus/
Code:
die im Medium verwendbaren und
verwendeten Zeichenressourcen und -
systeme
Abb. 1: ,,Elemente eines technischen Mediums" (Marx, Weidacher, 2014, 52)
3
Demnach können wir bis jetzt festhalten, dass das Internet, also unsere beschriebene
Online-Kommunikation, sowohl Verbreitungs-, Kommunikations-, sowie
Speichermedium ist. Zudem können wir sagen, dass noch andere wichtige Faktoren
eine große Rolle spielen. Es wird gezeigt, dass der technische Apparat als Mediums-
Element den Kern jedes Mediums bildet (vgl. Marx, Weidacher, 53). Ohne jedoch
die anderen Elemente zu vernachlässigen, kann der Apparat alleine und ohne die
anderen Elemente nicht funktionieren. Da die Technologie keine zentrale Rolle in
dieser Arbeit darstellt, führe ich diese Definition nicht weiter fort. Trotz allem ist sie
nicht zu vernachlässigen, da sie einen wichtigen Teil des allgemeinen Begriffs des
Mediums darstellt.
Was in dieser Arbeit jedoch weitaus mehr in Betracht gezogen werden kann, ist der
semiotische Code aus der vorherigen Übersicht nach Marx und Weidacher (2014).
Denn in der schriftlichen Internet-Kommunikation werden Zeichen, sowie Bilder oft
Verwendung finden. Wie sollen wir auch im Alltag und in unserer natürlichen
Sprache, in einem normalen Gespräch, Zeichen und Bilder verwenden? Viel mehr
Verwendung finden diese semiotischen Zeichen im Internet (siehe dazu auch 2.1).
Um jedoch beim Begriff des Mediums zu bleiben, können wir nun noch eine weitere
Einteilung vornehmen, denn es wird nach Marx und Weidacher (2014) zwischen
primären, sekundären und tertiären Medien unterschieden (vgl. Marx, Weidacher,
2014, 54): Primäre Medien funktionieren ohne Einsatz eines technischen Gerätes.
Als Beispiele werden Mimik und Gestik genannt. Bei sekundären Medien ist der
Einsatz eines technischen Gerätes hingegen obligatorisch. Als Beispiel wird hier der
Fotoapparat genannt. Zuletzt beschreiben tertiäre Medien auch ein technisches Gerät,
das jedoch bei Sender und Empfänger verfügbar sein muss. So können wir nun
davon sprechen, dass das Medium Internet, sowie unsere beschriebene Online-
Kommunikation, als tertiäres Medium verstanden werden kann. Sender und
Empfänger bedienen sich eines technischen Gerätes, um eine gelungene
Kommunikation im Online-Netzwerk zu schaffen.
4
Um die Kommunikation weiter in den Vordergrund zu stellen, legen wir nahe, dass
Medien prägend auf die Durchführung kommunikativer Handlungen wirken (vgl.
Marx, Weidacher, 2014, 60). Es wird grundlegend festgestellt, dass Medien
schlichtweg die Kommunikation erleichtern, sowie überhaupt auch erst dadurch die
Möglichkeit einer Kommunikation besteht. Gehen wir davon aus, dass der Großteil
unserer Familie in einem anderen Land lebt, können wir ohne Probleme, sowie ohne
den Hinblick auf Zeitverschiebungen, Nachrichten verschicken, die binnen Sekunden
die andere Seite der Welt erreichen können (vgl. Cantzler, Haupt, Oertel, 2010, 8).
Marx und Weidacher (2014) erwähnen hierbei gewisse Kommunikationsformen.
Dafür legen sie fünf Kriterien nieder (nach: vgl. Ziegler 2002, 21 und Holly 1996,
11): Zeichentyp, Kommunikationsrichtung, Medium, Zeitlichkeit und Anzahl der
Kommunikationspartner. Bezieht man diese Kriterien nun auf das für uns wichtige
Medium Online-Kommunikation, spielen Zeitlichkeit und Kommunikationsrichtung
eine wichtige Rolle. Bei der Kommunikationsrichtung wird erwähnt, dass es wichtig
ist zwischen einseitiger und wechselseitiger Kommunikation zu unterscheiden,
sodass von monologischer, oder dialogischer Kommunikation gesprochen werden
kann (vgl. Marx, Weidacher, 2014, 59). Wenden wir dieses Kriterium nun auf unsere
Online-Kommunikation an, so können wir davon ausgehen, dass das Internet
einerseits als monologische, aber weitaus mehr als dialogische Kommunikation
verstanden werden kann. Hier können wir Facebook erwähnen. Einerseits
veröffentlicht man Einträge, sodass bei diesem Prozess von einer monologischen
Kommunikationsrichtung gesprochen werden kann. Die meisten Einträge bei
Facebook werden jedoch kommentiert, sodass eher von einer dialogischen
Kommunikationsrichtung ausgegangen werden muss, da andere Facebook-Mitglieder
auf Einträge reagieren (siehe dazu auch 2.3). Auch Marx und Weidacher (2014)
sprechen davon, dass es ,,eine komplexe Kommunikationsform mit monologischen
und dialogischen Elementen" gibt (Marx, Weidacher, 2014, 59). Diese Darlegung
kann gut mit dem sozialen Netzwerk Facebook in Verbindung gebracht werden.
5
Weiterhin wird in Bezug auf die Online-Kommunikation ein weiteres wichtiges
Kriterium vorgestellt: die Zeitlichkeit. Hierbei geht es um ,,die Unterscheidung von
synchronen und asynchronen Kommunikationssituationen" (Marx, Weidacher, 2014,
59). Als Beispiele werden Face-to-Face-Gespräche, sowie Briefe erwähnt. Bei einem
Gespräch scheint klar zu sein, dass Antworten direkt erwartet werden und man von
einer eher kurzen zeitlichen Dauer sprechen kann. Bei einem Brief sieht diese
zeitliche Dauer jedoch anders aus, da der Brief erst gelesen, beantwortet und dann
erst verschickt werden muss. Wenden wir dieses Kriterium nun wieder auf unsere
Online-Kommunikation an, fällt auf, dass man auch hier entweder die synchrone,
oder die asynchrone Kommunikation in Betracht ziehen kann. Marx und Weidacher
(2014) nehmen sich die E-Mail als Beispiel. ,,An sich sind diese auch asynchrone
Kommunikationsformen" (Marx, Weidacher, 2014, 60). E-Mails kann man ebenso
gut mit der Facebook-Kommunikation vergleichen. Entweder antworten beide
Kommunikationspartner schnell und rasch, sodass sich eine Art Gespräch entwickelt
(synchron), oder sie warten beide jeweils länger auf eine Antwort (asynchron, oder
aber auch ,,quasi-synchron" - siehe dazu auch 2.2).
Zu den weiteren Beschreibungen die folgenden werden ist es wichtig zu erwähnen,
dass das Internet als großes Netzwerk eine zentrale Rolle spielt. ,,Die Bezeichnung
,,Internet" ist die Abkürzung für ,,interconnected net", d.h. ,,in sich verbundenes
Netz" (Marx, Weidacher, 2014, 64). Es wird grundlegend davon gesprochen, dass es
sich um eine Art Netz handelt, das die Verbindung vieler Computer miteinander
beschreibt. Diese technische Verbindung ermöglicht uns eine Kommunikation von
einem Computer, zu mehreren Computern. Computer sind daher bei Sender, sowie
Empfänger ausschlaggebend, um eine Kommunikation herzustellen. Sie ,,fungieren
dabei als Eingabe-, Sende- und Empfangsgeräte und sind somit ein Teil des Mediums
Internet" (Marx, Weidacher, 2014, 71). Da die Technik den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde, bleibt sie weitestgehend unberücksichtigt, da sie keine zentrale
Rolle spielt. Vielmehr beschäftigt sich diese Arbeit mit sprachlichen Phänomen der
Internet-Interaktion, sodass wir nun im nächsten Abschnitt an das Thema Sprache im
Internet anknüpfen können.
6
2.1 Sprache im Internet
Um sprachliche Phänomene bei Facebook verstehen und vor allem erkennen zu
können, möchte ich zunächst grundlegend auf einige sprachliche Besonderheiten im
Internet aufmerksam machen. Auch in diesem Abschnitt werden ein paar wenige
Auffälligkeiten in sozialen Netzwerken angesprochen, die für die spätere Analyse
wichtig sind. Es wird deutlich, dass die mündliche Kommunikation einen großen
Einfluss auf unsere Schriftsprache ausübt. Der Versuch, mündliche Sprache mit der
schriftlichen im Internet in Verbindung zu bringen, birgt oft Schwierigkeiten auf
semantischer Ebene.
Marx und Weidacher (2014) beschäftigen sich nicht nur mit der beschriebenen
Technologie eines Mediums, sondern erwähnen ebenso Aspekte, die auf
linguistischer Ebene sehr interessant für diese Arbeit sind. Aufgrund dessen
beschäftigt sich auch der folgende Abschnitt mit den Darlegungen von Marx und
Weidacher (2014). Sie erwähnen sprachliche Phänomene im Internet, die aufgrund
von beschriebenen Beispielen deutlich gemacht werden. Interessant ist es, dass sie
von keiner speziellen Sprache im Internet sprechen, sondern es vielmehr
verschiedene Sprachstile gibt, die sich der jeweiligen Anwendung des Internets
anpassen, ,,zum Beispiel den umgangssprachlichen Stil in sozialen Netzwerken"
(Marx, Weidacher, 2014, 91). Laut Duden (2014) handelt es sich bei der
,,Umgangssprache" um eine ,,Sprache, die im täglichen Umgang mit anderen
Menschen verwendet wird". Dies kann man demnach so verstehen, dass das Internet
in sich verschiedene Bereiche besitzt, in denen man in Bezug auf unsere Sprache,
immer einen anderen Stil anwendet. So wird für diese Arbeit klar, dass das soziale
Netzwerk Facebook einen bestimmten Bereich im Internet beschreibt, in dem man
einen umgangssprachlichen Schreibstil entwickelt und präferiert (siehe dazu auch 3
und 3.1). Zu den internetspezifischen Merkmalen gehören zudem auch Akronyme,
oder aber auch Emoticons. Diese Verwendung ist ein Indiz dafür, dass es in der
Online-Kommunikation oft um Schnelligkeit geht, sodass Gesprächspartner oft zu
Abkürzungen oder ähnlichem neigen.
7
Es möchte in dieser Hinsicht gewährleistet werden, dass das eigentliche Face-to-
Face-Gespräch auch im Internet möglich sein kann. Bei einem Face-to-Face-
Gespräch wird mittels Mimik oder Gestik, oder eben auch durch spontane
Äußerungen ein Gespräch geformt, das spontan und synchron ist. Auch im Internet
werden die Merkmale eines Face-to-Face-Gespräches in vielerlei Hinsicht deutlich,
denn ,,Menschen tauschen sich aus, reagieren spontan und schnell und entwickeln
Routinen" (Marx, Weidacher, 2014, 92). Diese Routinen können als einheitliche
Basis verstanden werden, auf die Nutzer zurückgreifen, um online verstanden zu
werden. Marx und Weidacher (2014) erwähnen diesbezüglich die Kreativität eines
jeden Nutzers. Durch diese Kreativität sind ebenso Akronyme gekennzeichnet. Da
Akronyme meist aus einzelnen Buchstaben zweier oder mehrerer Wörter
zusammengesetzt sind, werden sie auch als Initialwörter bezeichnet (vgl. Marx,
Weidacher, 2014, 98). Die Verwendung dieser Initialwörter ist ein Zeichen dafür,
dass man das Internet, bzw. die Sprache des Internets beherrscht und sich online
ausdrücken kann (z.B. ,,afk" für ,,away from keyboard").
Nicht nur Akronyme, sondern auch Inflektive begegnen uns in der Online-
Kommunikation. ,,Inflektive sind Adaptionen aus der Comicsprache. Sie werden
meist in Asterisken oder spitze Klammern gesetzt und dazu verwendet, para- oder
non-verbale Handlungen sprachlich zu simulieren" (Marx, Weidacher, 2014, 100).
Hierfür werden innerhalb von Inflektiven Verbstämme ohne Flexionsendung genutzt
(vgl. Duden 2009, 599). Daher sind Inflektive ebenso ein Indiz dafür, schriftliche
Kommunikation mit der mündlichen auf eine Ebene zu setzen. Es fällt uns vor einem
Computer nicht leicht, Ironie, sowie Sarkasmus festzustellen, wenn dies nicht
deutlich gekennzeichnet wird. Ohne gewisse Anhaltspunkte können Äußerungen, die
im Internet getätigt werden, viele verschiedene Lesarten haben. Bei Facebook
werden Inflektive gerne in Verbindung mit Emoticons verwendet, um Emotionen
und Gefühle bei einer Äußerung verständlich zu machen (siehe dazu auch 2.3). Bei
Emoticons handelt es sich ,,um Zeichen (zumeist ikonische Gesichter), die verwendet
werden, um komplexe emotionale Sachverhalte und Handlungen kompakt und
effektiv darzustellen" (Marx, Weidacher, 2014, 101). Durch diese Ausdrucksweise
8
werden Gefühle und emotionale Ausdrücke (mit Hilfe von Ikonizität) leicht
vermittelt, da sie als konventionalisierte schriftliche Zeichen gekennzeichnet sind
(vgl. Marx, Weidacher, 111).
Des Weiteren werden Indikatoren für Adaptionsprozesse, für sprachliche Sensibilität
und Reflexion und für Oraliteralität erwähnt, die ebenso wichtig für die spätere
Analyse sein können. Bei den zuerst erwähnten Adaptionsprozessen, werden
,,sprachliche Ausdrücke, die in manchen Kommunikationsformen der Online-
Kommunikation international üblich geworden sind, aus Fremdsprachen für die
deutschsprachige Kommunikation im Internet übernommen" (Marx, Weidacher,
2014, 96). Hierzu zählen z.B. auch Abkürzungen (Akronyme, Kurzwörter oder
Ellipsen), die besonders gut in eine jeweilige Kommunikationsform passen. Ebenso
werden hier Merkmale sichtbar, die eher für eine mündliche Kommunikation
zutreffend sind. Gesprächsverläufe werden durch Apokopen, Assimilationen und
verschiedenen Formen der Zusammenziehung eines Wortes synchron und dialogisch.
Diesbezüglich wird eine Kommunikationsform im Internet geschaffen, die versucht
Intonation, sowie Lautstärke (Oraliteralität) aus der natürlichen mündlichen
Sprechweise zu adaptieren. Dadurch soll gewährleistet werden, dass der
Gesprächsverlauf auf allen Ebenen verstanden wird, so wie es bei einem Face-to-
Face-Gespräch sein sollte. Aus diesem Grund ist meist klar, dass ,,eine
normgerechte Schreibung im Netz eher eine untergeordnete Rolle spielt" (Marx,
Weidacher, 2014, 105). Wenn sich im Internet eine Art Chatgespräch entwickelt ist
es oft der Fall, dass sich Fehler einschleichen, die durch Schnelligkeit und durch
spontane Reaktionen, oft automatisch bedingt sind. Dennoch ,,finden wir
Selbstkorrekturen oder Rückmeldungen hinsichtlich der Rechtschreibung, wenn die
Verschreiber zu Irritationen führen könnten" (Marx, Weidacher, 2014, 105).
Gesprächspartner, die diese Fehler verbessern möchten, greifen oft zu verschiedenen
Methoden. Meistens wird das komplette Wort erneut aufgegriffen und richtig
geschrieben, oder durch Großbuchstaben, oder einem Sternchen markiert.
9
Ebenso spielt die Motivation der sozialen Anbindung eine wichtige Rolle. ,,Durch
die Übernahme soziolektaler oder dialektaler Ausdrucksformen verortet man sich
hingegen in sozial oder regional definierten Gruppen" (Marx, Weidacher, 2014, 96).
Online getätigte Ausdrücke werden somit auch der existierenden Kommunikation im
Rahmen der natürlichen Sprache angebunden. So findet man in Chat-Foren, die für
Jugendliche ausgelegt sind mehr umgangssprachliche Ausdrücke, die der
Jugendsprache zugeordnet werden können, als in Foren, die sich beispielsweise mit
wissenschaftlichen Texten beschäftigen. Laut Duden (2014) handelt es sich bei der
Jugendsprache um eine ,,Sondersprache der Jugendlichen". Diese Arbeit gibt im
weiteren Verlauf Aufschluss darüber, welche Ausdrücke als jugendsprachlich
gekennzeichnet sind. Nicht zu vernachlässigen ist die Übernahme fremdsprachlicher
Elemente, die eine sprachliche Anbindung an eine internationale ,,Internet-
Community" sicherstellen wollen (vgl. Marx, Weidacher, 96). Es werden
Fachtermini adaptiert, die in gewisser Hinsicht signalisieren, dass sich der Nutzer
dem Medium Internet anpasst und das Medium in seiner Schreibweise versteht.
Dazu werden lexikalische Lücken durch Anglizismen auf grammatischer Ebene der
deutschen Sprache angepasst. Verben können konjugiert und Nomen dekliniert und
somit angepasst werden. Durch diese Art der Anwendung entstehen Formen der
Komposition, Derivation, aber auch der Konversion und Kontamination. Es
entwickeln sich gewisse Wortartwechsel, wie z.B. bei Facebook der Ausdruck von
,,Post" zu ,,posten".
Wie kurz angesprochen wurde, enthalten schriftliche Kommunikationsverläufe im
Internet ebenso auch Aspekte aus dem mündlichen Sprachgebrauch. Da aber der
schriftliche Ausdruck nicht all die Elemente der mündlichen Sprache aufgreifen kann
(siehe Mimik und Gestik), ist die schriftliche Kommunikation stark eingeschränkt,
sodass man von einer ,,zerdehnten Kommunikationssituation" sprechen kann (vgl.
Ehlich 1983, 32). Das wichtige hierbei ist der Vergleich zur mündlichen Sprache mit
Hilfe eines vorhandenen Wahrnehmungsraumes. Befindet sich ein Gesprächspartner
außerhalb dieses Raumes, müssen Mittel gefunden werden, um diese Distanz
schriftlich überbrücken zu können.
10
Dieser Raum ermöglicht den Gesprächspartnern einen freien
Kommunikationsverlauf, sowie Elemente, auf die man meist ohne jegliche Probleme
referieren kann. Besitzen beide Gesprächspartner diesen Raum jedoch nicht, entsteht
eine Distanz, die die jeweilige Kommunikation stören kann. Folgende Tabelle macht
den Unterschied klar deutlich:
Mündliche Kommunikation
Schriftliche Kommunikation
Kopräsenz der Kommunizierenden
räumlich-zeitliche Distanz
synchron
asynchron
Interaktiv dialogisch
nicht interaktiv - monologisch
(tendenziell) persönlich
(tendenziell) unpersönlich
multimodal
monomodal
Abb. 2: ,,Eigenheiten mündlicher vs. schriftlicher Kommunikation" (Marx, Weidacher, 2014, 109
nach: Koch, Oesterreicher, 2008)
Diese Unterscheidung kann gut auf die genannte Abgrenzung zwischen Face-to-
Face-Gespräch und einer Kommunikation im Internet angewendet werden. Trotz der
genannten Punkte finden sich im Internet immer wieder neue Aspekte, die eher der
mündlichen Kommunikation entsprechen. ,,Je stärker die Kommunikation
dialogischer und synchroner erfolgt, desto häufiger lassen sich mündlichen Aspekte
des Sprachgebrauchs in der Internet-Kommunikation feststellen" (Marx, Weidacher,
2014, 110 nach: Runkehl, Schlobinski, Siever 1998, 116). Da die schriftliche
Kommunikation in dieser Hinsicht eingeschränkt ist, wird immer häufiger versucht,
diese Problematik zu lösen. Eine Anwendung sind hierbei z.B. Prozeduren des
Malfelds (vgl. Marx, Weidacher, 111). Bei dieser Anwendung kennzeichnet die
Oraliteralität einen wichtigen Aspekt schriftlicher Äußerungen, da durch
Buchstabeniterationen Intonation schriftlich nachgeahmt werden kann. Der
Gesprächspartner wird sozusagen mental gelenkt (vgl. Marx, Weidacher, 112), um
Äußerungen oder Ausdrücke richtig interpretieren und verstehen zu können.
11
Zusammenfassend können wir festhalten, dass es einerseits schwierig ist, eine
erfolgreiche Kommunikation im Internet zu schaffen, da viele Elemente im
schriftlichen Raum unberücksichtigt bleiben (z.B. fehlende Kopräsenz des
Gesprächspartners). Andererseits werden umso häufiger Elemente genutzt, die genau
diese Schwierigkeiten isolieren möchten, wie z.B. die Anwendung ikonischer
Gesichter, um Mimik und Gestik einzubringen, oder aber auch Tilgungen, bzw.
Abkürzungen, um einen schnellen Kommunikationsverlauf zu gewährleisten.
Ebenso wird deutlich, dass es keine einheitliche Sprache im Internet gibt, sondern
vielmehr einzelne Schreibstile, die sich im jeweiligen Bereich des Internets finden
lassen (wie z.B. die Umgangssprache in sozialen Netzwerken). Um einen genaueren
Einblick zu bekommen, beschäftigt sich der nächste Abschnitt knapp mit der
computervermittelten Kommunikation. Wir haben kennengelernt, dass das Internet
aus einer Art von Netz besteht, das mit vielen Computern gleichzeitig verbunden sein
kann. Auf dieser Ebene beginnt der erste Schritt der Kommunikation. Doch wie
funktioniert diese genau?
2.2 Computervermittelte Kommunikation
In Abschnitt 2.1 wurde deutlich, dass es gar nicht so schwer ist eine Kommunikation
im Internet herzustellen. Lediglich der Besitz eines internetfähigen Computers und
einer Tastatur reicht aus, um in eine virtuelle Welt eintauchen zu können und somit
mit anderen Menschen weltweit kommunizieren zu können. Auch Handys
(Smartphones) bieten heutzutage die Möglichkeit, das Internet zu nutzen und somit
mit anderen Menschen kommunizieren zu können (vgl. Schnitzer, 2012, 321). Wir
haben ebenso kennengelernt, dass sich eine Face-to-Face-Kommunikation von einem
virtuellen Gespräch im Internet stark abgrenzt. Der sichtlich deutlichste Unterschied
wird in Mimik und Gestik sichtbar, die durch die gegebene Distanz im Internet für
eine asynchrone Kommunikation stehen. Trotz der genannten Unterschiede stellt
dieses Kapitel einige Formen computervermittelter Kommunikation vor, die diese
Abgrenzungen zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation verdeutlichen
12
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (PDF)
- 9783961160730
- ISBN (Paperback)
- 9783961165735
- Dateigröße
- 6.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – Philosophische Fakultät – Institut für Sprache und Information
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Januar)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- Facebook Soziale Netzwerke Sprache Internet Internetsprache Linguistik Empirische Untersuchung Kommunikation Online-Kommunikation Sprachverwendung Schreibverhalten Sprache untersuchen Sprachuntersuchung Onlinemedium Sprache im Internet linguistische Aspekte computervermittelte Kommunikation Facebook-Kommunikation Facebook-Studie Sprachstudie
- Produktsicherheit
- Diplom.de