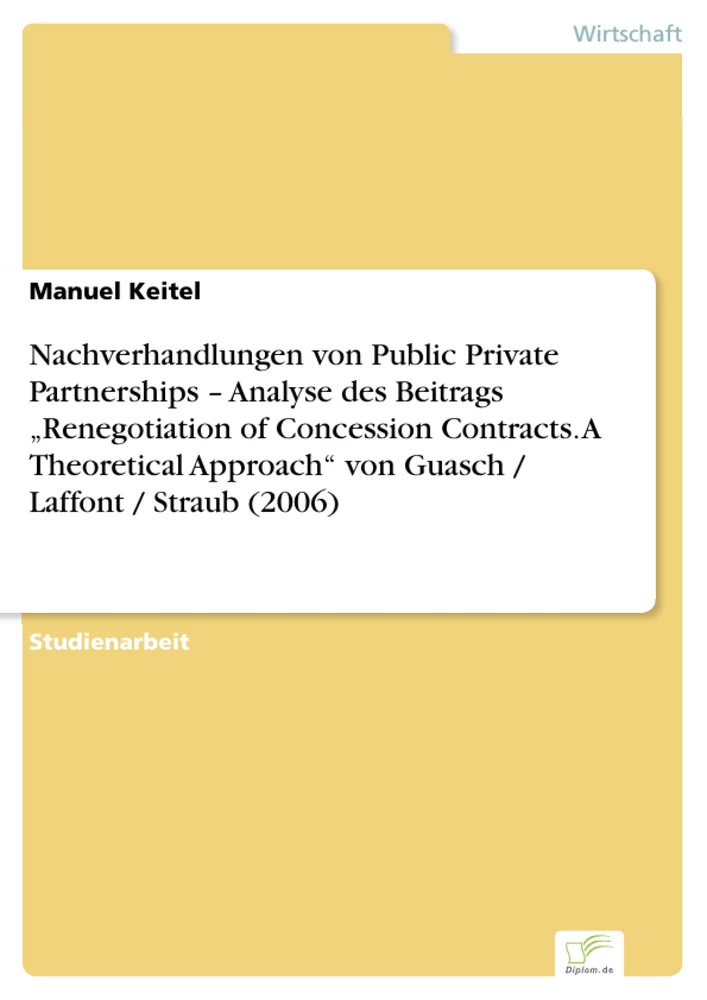Nachverhandlungen von Public Private Partnerships – Analyse des Beitrags „Renegotiation of Concession Contracts. A Theoretical Approach“ von Guasch / Laffont / Straub (2006)
©2015
Seminararbeit
19 Seiten
Zusammenfassung
In über 41% der Konzessionen (den Telekommunikationssektor ausgeschlossen), die bei Infrastrukturprojekten in Latein- und Mittelamerika in den Jahren 1985 bis 2000 vergeben wurden, kam es zu Nachverhandlungen. Am stärksten betroffen waren die Transportbranche und der Sektor Wasserversorgung/Abwasserentsorgung mit 55% bzw. 75% Nachverhandlungen. Im Durchschnitt traten diese bereits zwei Jahre nach Vertragsunterzeichnung auf (vgl. Guasch, 2004, S. 34). Auch in Großbritannien wurden 33% der Public Private Partnership (PPP) Projekte zwischen 2004 und 2006 nachverhandelt (vgl. Iossa und Martimort, 2012, S. 445).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Beitrag von Guasch et al. (2006), in dem mittels eines Regulierungsmodells die Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit von Nachverhandlungen von Konzessionsverträgen untersucht werden. Die Autoren erweitern dabei die Arbeiten von Laffont und Tirole (1993) und Laffont (2003), um auf dieser Basis ein Modell von firmen-initiierten Nachverhandlungen zu entwickeln. Neben den oben genannten Zahlen liefert vor allem die Tatsache, dass PPP in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein zu-nehmendes Wachstum verzeichneten, einen Anlass für eine solche Untersuchung. So stieg beispielsweise das Volumen der neu abgeschlossenen Verträge in der EU von 2000 bis 2008 um über 61% auf ca. 24,2 Mrd. Euro. Allein in 2008 wurden 115 neue Verträge unterzeichnet, wobei Großbritannien für die Jahre 1990 bis 2009 mit ca. 52% der Projektvolumina den mit Abstand größten Anteil daran hat. Deutschland folgt mit ca. 4% an vierter Stelle (vgl. Kappeler und Nemoz, 2010, S. 7–8).
In Kapitel 2 dieser Seminararbeit folgt eine ausführliche Analyse der Methodik und der Vorgehensweise von Guasch et al. (2006) bei der Modellentwicklung, sowie eine Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse aus dem Modell.
Das dritte Kapitel fasst die Arbeit zusammen und liefert eine Diskussion des Lösungsansatzes sowie mögliche Implikationen für die Praxis.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Beitrag von Guasch et al. (2006), in dem mittels eines Regulierungsmodells die Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit von Nachverhandlungen von Konzessionsverträgen untersucht werden. Die Autoren erweitern dabei die Arbeiten von Laffont und Tirole (1993) und Laffont (2003), um auf dieser Basis ein Modell von firmen-initiierten Nachverhandlungen zu entwickeln. Neben den oben genannten Zahlen liefert vor allem die Tatsache, dass PPP in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein zu-nehmendes Wachstum verzeichneten, einen Anlass für eine solche Untersuchung. So stieg beispielsweise das Volumen der neu abgeschlossenen Verträge in der EU von 2000 bis 2008 um über 61% auf ca. 24,2 Mrd. Euro. Allein in 2008 wurden 115 neue Verträge unterzeichnet, wobei Großbritannien für die Jahre 1990 bis 2009 mit ca. 52% der Projektvolumina den mit Abstand größten Anteil daran hat. Deutschland folgt mit ca. 4% an vierter Stelle (vgl. Kappeler und Nemoz, 2010, S. 7–8).
In Kapitel 2 dieser Seminararbeit folgt eine ausführliche Analyse der Methodik und der Vorgehensweise von Guasch et al. (2006) bei der Modellentwicklung, sowie eine Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse aus dem Modell.
Das dritte Kapitel fasst die Arbeit zusammen und liefert eine Diskussion des Lösungsansatzes sowie mögliche Implikationen für die Praxis.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
II
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Zeitlicher Ablauf des Vertragsangebotsprozesses ... 5
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Einfluss der Variablen auf die Wahrscheinlichkeit von firmen-initiierten
Nachverhandlungen ... 10
III
Abkürzungsverzeichnis
ÖPP
Öffentlich Private Partnerschaften
PPP
Public Private Partnerships
IV
Symbolverzeichnis
Unternehmensassets für das Projekt
Irreversible Investition / Fixkosten
Investitionen des Unternehmens
Umfang der privaten Kredite
Effizienzparameter
Effizienter
Vertragstyp
Ineffizienter
Vertragstyp
Grad des State Capture
Kostenparameter von Nachverhandlungen
Störterm
Güte der Bürokratie und Rechtsstaatlichkeit
Kosten für Staatsmittel
1
1
Einleitung
In über 41% der Konzessionen (den Telekommunikationssektor ausgeschlossen), die bei
Infrastrukturprojekten in Latein- und Mittelamerika in den Jahren 1985 bis 2000 vergeben
wurden, kam es zu Nachverhandlungen. Am stärksten betroffen waren die Transportbranche
und der Sektor Wasserversorgung/Abwasserentsorgung mit 55% bzw. 75% Nachverhandlun-
gen. Im Durchschnitt traten diese bereits zwei Jahre nach Vertragsunterzeichnung auf (vgl.
Guasch, 2004, S. 34). Auch in Großbritannien wurden 33% der Public Private Partnership
(PPP) Projekte zwischen 2004 und 2006 nachverhandelt (vgl. Iossa und Martimort, 2012,
S. 445).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Beitrag von Guasch et al. (2006), in dem
mittels eines Regulierungsmodells die Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit von Nach-
verhandlungen von Konzessionsverträgen untersucht werden. Die Autoren erweitern dabei die
Arbeiten von Laffont und Tirole (1993) und Laffont (2003), um auf dieser Basis ein Modell
von firmen-initiierten Nachverhandlungen zu entwickeln. Neben den oben genannten Zahlen
liefert vor allem die Tatsache, dass PPP in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein zu-
nehmendes Wachstum verzeichneten, einen Anlass für eine solche Untersuchung. So stieg
beispielsweise das Volumen der neu abgeschlossenen Verträge in der EU von 2000 bis 2008
um über 61% auf ca. 24,2 Mrd. Euro. Allein in 2008 wurden 115 neue Verträge unterzeichnet,
wobei Großbritannien für die Jahre 1990 bis 2009 mit ca. 52% der Projektvolumina den mit
Abstand größten Anteil daran hat. Deutschland folgt mit ca. 4% an vierter Stelle (vgl. Kappe-
ler und Nemoz, 2010, S. 78).
Engels (2013, S. 3) liefert für den Begriff der PPP bzw. Öffentlich Privaten Partnerschaften
(ÖPP) eine umfassende Definition:
,,ÖPP ist eine langfristige, vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen Öffentlicher Hand
und Privatwirtschaft zur wirtschaftlichen Erfüllung öffentlicher Aufgaben über den gesamten
Lebenszyklus eines Projektes. Die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Ressourcen [...]
werden von den Partnern in einem gemeinsamen Organisationsmodell zusammengeführt und
vorhandene Projektrisiken [...] angemessen verteilt."
Eine allgemeingültige Definition gibt es in Deutschland jedoch nicht. Unterschieden werden
können PPP zunächst nach der zugrundeliegenden rechtlichen Struktur. Neben dem Gesell-
2
schaftsmodell existiert das Vertragsmodell, in welches Konzessionsverträge einzuordnen sind.
In einem Betreibermodell geht das Asset dabei vorübergehend in Privatbesitz über, bleibt aber
Eigentum des Staates; die Details der Privatisierung werden in einem Vertrag festgehalten.
Üblicherweise werden Konzessionen für den Neubau oder die Erweiterung bzw. Modernisie-
rung eines Assets vergeben, oftmals für Zeiträume von 25 bis 30 Jahren (vgl. Europäische
Kommission, 2003, S. 24). Der Konzessionär besitzt damit in der Regel ein natürliches Mo-
nopol, welches der Staat mittels des Konzessionsvertrags zur Steigerung der sozialen Wohl-
fahrt beschränkt und verpflichtet sich, bestimmte Dienstleistungen gegenüber Dritten
(Verbrauchern bzw. Konsumenten) zu erbringen, wofür er im Rahmen der Konzessions-
vereinbarungen ein Nutzungsentgelt erhält.
Im Zuge der Vertragsvergabe hat der private Anbieter zunächst ein Interesse an einem mög-
lichst günstigen Gebot, um die Konzession zu erhalten. Nach der Unterzeichnung ändert sich
die Interessenslage des Unternehmens, welches nun höhere Nutzungsentgelte für sein Asset
anstreben wird. Da diese von den Konsumenten bezahlt werden, hat der Staat ein vergleichs-
weise geringes Interesse an einem starken Widerstand gegen ein solches Bestreben. Unter
Wohlfahrtsgesichtspunkten erscheinen PPP damit nicht in jedem Fall vorteilhaft.
Darüber hinaus scheint auch das Argument, PPP senkten die Kosten von Infrastrukturprojek-
ten, nicht zwangsläufig stichhaltig. So hat der Bundesrechnungshof (2014) in seinem Bericht
über ÖPP im Fernstraßenbau festgestellt, dass die Kooperation mit der Privatwirtschaft in den
untersuchten Fällen deutlich teurer als die Projektumsetzung durch die öffentliche Hand war.
Als Hauptgrund hierfür werden die höheren Finanzierungskosten der privaten Anbieter im
Vergleich zur staatlichen Finanzierung genannt. Die frühere Realisierbarkeit von Projekten
und die Tatsache, dass PPP nicht in die Staatsverschuldung eingehen, führt dennoch dazu,
dass solche Projekte politisch gefördert werden (vgl. Bundesrechnungshof, 2014, S. 3840).
Die grundlegende Literatur zu Regulierungsverträgen ging traditionell von vollständigen
Verträgen aus (vgl. Guasch et al., 2006, S. 57). Unter dieser Annahme wird das Ergebnis
einer potenziellen Nachverhandlung bei Vertragsschluss antizipiert, wodurch dieser gegen
eine solche abgesichert ist. Folglich ist ein unvollständiger Vertrag die Voraussetzung dafür,
dass in einem Modell Nachverhandlungen auftreten (vgl. z.B. Segal und Whinston, 2002).
Begründet sein kann diese Unvollständigkeit beispielsweise in vorhandenen Transaktionskos-
ten bei der Vertragsbildung oder einem mangelhaften Justizsystem (vgl. Tirole, 1999, S. 743).
3
Empirische Erkenntnisse über Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit von Nachverhand-
lungen liefern z.B. Guasch et al. (2003, S. 2829). Sie untersuchen anhand der Charakteristika
von Konzessionsverträgen in Latein- und Mittelamerika aus den Jahren 1989 bis 2000 die
Determinanten von Nachverhandlungen, die auf Initiative des Unternehmens hin durchgeführt
werden. Beschränkt auf den Transport- und Wasserversorgungssektor identifizieren die Auto-
ren beispielsweise Rezessionen, Wahlen oder das Fehlen einer geeigneten Regulierungsbe-
hörde als positive Einflussfaktoren, während unter anderem eine funktionsfähige Bürokratie
Nachverhandlungen unwahrscheinlicher machen.
Auf Grundlage derselben Daten untersuchen die Autoren in einer weiteren Arbeit die Deter-
minanten von Nachverhandlungen, welche jedoch von der Regierung initiiert werden. Dies
führt unter anderem zu anderen Ergebnissen bezüglich des Einflusses der privaten Finanzie-
rung sowie des Auftretens von Korruption beide Faktoren haben eine entgegengesetzte
Wirkung im Vergleich zu von Unternehmen verursachten Nachverhandlungen (vgl. Guasch et
al., 2007, S. 12831286). Eine Auswertung hinsichtlich des Verursachers ergibt, dass 58% der
beobachteten Nachverhandlungen vom Staat und 33% vom Unternehmen eingeleitet werden.
Die übrigen 9% gehen auf die Initiative beider Vertragspartner zurück. Ein Grund für diese
Verteilung könnte in der politischen Situation der betrachteten Länder liegen, da 79% der
staatlich initiierten Nachverhandlungen in zeitlichem Zusammenhang mit der ersten Wahl
nach der Vertragsunterzeichnung stehen (vgl. Guasch et al., 2007, S. 12761278).
In Kapitel 2 dieser Seminararbeit folgt eine ausführliche Analyse der Methodik und der Vor-
gehensweise von Guasch et al. (2006) bei der Modellentwicklung, sowie eine Zusammenfas-
sung der theoretischen Erkenntnisse aus dem Modell.
Das dritte Kapitel fasst die Arbeit zusammen und liefert eine Diskussion des Lösungsansatzes
sowie mögliche Implikationen für die Praxis.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (Paperback)
- 9783956367595
- ISBN (PDF)
- 9783956369094
- Dateigröße
- 393 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Ulm – Institut für Controlling
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Juni)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- Public Private Partnerships Konzessionsverträge Nachverhandlungen
- Produktsicherheit
- Diplom.de