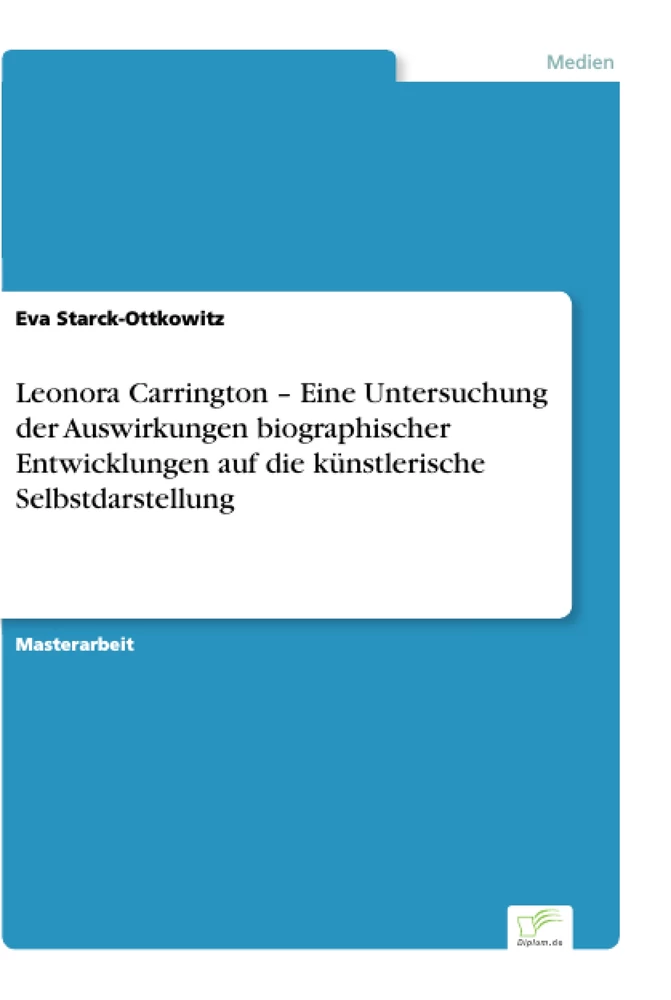Leonora Carrington – Eine Untersuchung der Auswirkungen biographischer Entwicklungen auf die künstlerische Selbstdarstellung
©2016
Masterarbeit
106 Seiten
Zusammenfassung
Diese interdisziplinäre Masterarbeit beschäftigt sich mit der surrealistischen Künstlerin Leonora Carrington und ihren Selbstdarstellungen. Wie diese sich auf ihre Identitätsentwicklung beziehen, sollte im Laufe der Arbeit herausgefunden werden. Hierzu wurden zum einen die Bildhermeneutik nach Panofsky für die Untersuchung der Selbstdarstellungen herangezogen, zum anderen die objektive Hermeneutik nach Oevermann für die Analyse der Lebensdaten der Künstlerin. Als Bindeglied zwischen der kunsthistorischen und der sozialwissenschaftlichen Methode fungiert die Indentitätstheorie Erik H. Eriksons, unter deren Berücksichtigung die gesamte Arbeit aufgebaut ist.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2
1. Einleitung
Diese Arbeit befasst sich mit einem interdisziplinären Thema, das sowohl in die Be-
reiche der Pädagogik als auch in diejenigen der Kunstgeschichte hineinreicht. Vor-
rangig geht es um die Entwicklung der Selbstbildnisse
1
der surrealistischen Künstle-
rin Leonora Carrington (1917-2011) in Kohärenz mit der Entwicklung ihrer Identi-
tät. Somit soll hier ein kunsthistorisches Thema mithilfe kunstgeschichtlicher und
sozialwissenschaftlicher Methoden der Bildhermeneutik und der objektiven Her-
meneutik und einer pädagogischen Fragestellung untersucht werden. Die Kunstge-
schichte hat bisher noch kein klares Regelwerk für das Behandeln von Biographien
und deren möglicher Tragweite für die Interpretation des Oeuvres einer Künstlerin
oder eines Künstlers aufgestellt. Doch genau dies, der Zusammenhang zwischen Bi-
ographie und Oeuvre, soll bei dieser Arbeit im Vordergrund stehen. Ob es möglich
ist, eine Biographie aus der pädagogischen Disziplin heraus in Zusammenhang mit
einem künstlerischen Lebenswerk zu deuten, soll im Verlauf der Arbeit herausgefun-
den werden. Bei Leonora Carrington sind rein objektiv immer wieder Bezüge her-
stellbar, die deutlich erkennen lassen, dass sie eigene Lebensphasen und eigene Er-
lebnisse aus ihrer Biographie in ihre Kunst überträgt. Aus diesem Grund, weil bereits
ohne wissenschaftliche Methoden klare Verbindungen zwischen Kunst und Leben
herstellbar sind, stehen sie und ihre Selbstbildnisse im Mittelpunkt dieser Arbeit. Die
anhand ihrer Selbstbildnisse erkennbare Entwicklung soll mit ihrer Biographie ver-
glichen werden, um zu untersuchen, in wie weit letztere möglicherweise Auswirkun-
gen auf Stil und Bildthema hatte.
Sowohl aus den Sozialwissenschaften als auch aus der Kunstgeschichte soll jeweils
eine Methode zum Einsatz kommen: Zum ersten wird die Bildhermeneutik genutzt,
1
Das Selbstbildnis ist eingeteilt in verschiedene Kategorien, für diese Arbeit ist jedoch nur das
Selbstbildnis in Assistenz relevant, da Leonora Carringtons Werke in diesem Kontext ausschließlich
in dieser Form erstellt wurden. Hierzu zählen das Selbstbildnis als Signatur, das Selbstbildnis im Bild
und das Identifikationsporträt. Letzteres trifft die Darstellungen Leonora Carringtons von sich selbst
präzise. Der Künstler/die Künstlerin zeigt sich selbst im Bild involviert, er identifiziert sich also mit
einer am Bildgeschehen beteiligten Person; vgl. Schweikhart, Gunter: Das Selbstbildnis im 15. Jahr-
hundert, in: Italienische Frührenaissance und nordeuropäisches Spätmittelalter. Kunst der frühen
Neuzeit im europäischen Zusammenhang, hg. v. Joachim Poeschke, München 1993, S. 7-11, hier S.
11. Trotz des Autorenbezugs zum 15. Jahrhundert besitzt die Definition von Schweikhart auch für die
Werke Leonora Carringtons noch Gültigkeit nicht zuletzt durch die bei ihr immer wiederkehrenden
Bezüge zur Renaissance. Darum wird im Folgenden von Selbstbildnissen gesprochen werden, wenn
es um die drei in dieser Arbeit zentralen Werke Leonora Carringtons geht.
3
um die Selbstbildnisse von Leonora Carrington zu analysieren. Das Drei-Stufen-
Modell von Erwin Panofsky (1892-1968) stellt dabei die geeignetste Methode dar, da
sie in der Kunstgeschichte etabliert ist und sich immer wieder bewehrt hat. Das Drei-
Stufen-Modell befasst sich zunächst mit der vorikonographischen Beschreibung,
dann mit der ikonographischen Analyse und zuletzt mit der ikonologischen Interpre-
tation. Die reine Beschreibung dessen, was man sieht, die Bedeutung dessen, was
man sieht, und die anschließende Interpretation bezogen auf den historischen Kon-
text der Entstehungszeit ermöglichen es, den eigentlichen Inhalt eines Werkes fun-
diert und umfassend begreifen zu können.
2
Um dies zu unterstützen und eine Verbin-
dung zu den Sozialwissenschaften herstellen zu können, werden weitere Ansätze von
Christian Rittelmeyer (geb. 1940) und Michael Parmentier (geb. 1943) mit einflie-
ßen: Die strukturale und die kontextuelle Interpretation untersuchen den Aufbau und
den Kontext der Entstehung eines Bildes und können dadurch Ansätze unterstützen,
die durch das Stufenmodell Panofskys gefunden wurden.
3
Die psychologi-
sche/mimetische Interpretation geht noch einen Schritt weiter: Der Betrachter soll
sich in den Künstler/die Künstlerin hineinversetzen und hinterfragen, was die Dar-
stellung für den Künstler/die Künstlerin selbst bedeutet, was er/sie sich dabei gedacht
hat.
4
Um Überinterpretationen zu vermeiden, soll diese Betrachtungsweise aber nur
am Rande berücksichtigt und nicht explizit als eigene Methodik durchgeführt wer-
den. Sie wird in die Analyse mit dem Drei-Stufen-Modell eingearbeitet. Auf die in
der Kunstgeschichte üblichen ausführlichen Vergleiche mit anderen Künst-
lern/Künstlerinnen der gleichen Epoche wird in dieser Arbeit weitestgehend verzich-
tet werden. Andere surrealistische Künstler/innen werden zwar am Rande Erwäh-
nung finden, aber es wird kein direkter Vergleich von Werken stattfinden. Denn es
geht in dieser Arbeit nicht darum, Belege für Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu
anderen surrealistischen Künstlern/Künstlerinnen zu finden, sondern vorrangig um
die Entwicklung Leonora Carringtons in Biographie und Selbstbildnis. Aus diesem
Grund wird die Methode nach Panofsky weniger detailliert durchgeführt, als es nor-
malerweise üblich wäre sie dient hier als Grundlage für die Betrachtung der Bild-
2
Vgl. Bätschmann Oskar: Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik: Die Auslegung von
Bildern, 6. gegenüber der 5. unveränd. Aufl., Darmstadt 2009, S. 69.
3
Rittelmeyer,
Christian und Parmentier, Michael: Bildhermeneutik, in: Einführung in die Pädagogi-
sche Hermeneutik. Mit einem Beitrag von Wolfgang Klafki, Darmstadt 2001, S. 72-104, hier S. 72
und S. 76 f.
4
Vgl. ebd., S. 82 ff.
4
werke. Somit lässt sich sagen, dass ein pädagogisch-sozialwissenschaftliches For-
schungsinteresse im Vordergrund steht.
Zum Zweiten wird die Objektive Hermeneutik nach Ulrich Oevermann (geb. 1940)
als Methode herangezogen, um die objektiven Daten des Lebens von Leonora Car-
rington von Geburt an bis 1947 zu untersuchen. 1947 ist das letzte Selbstbildnis ent-
standen, das somit den zeitlichen Abschluss für diese Arbeit bildet. Die Autobiogra-
phie Carringtons, Down Below, soll am Rande auch in diese Arbeit einfließen und als
Quelle für die eigene Sichtweise der Künstlerin auf ihre Erlebnisse bezogen auf ei-
nen Anstaltsaufenthalt 1940 dienen. Durch das gleichnamige Selbstbildnis zum sel-
ben Thema, das noch im Jahr des Anstaltsaufenthaltes entstanden ist, lassen sich
möglicherweise Parallelen feststellen, die den Fokus der Künstlerin auf bestimmte
Aspekte des Anstaltsaufenthaltes verdeutlichen können. Die Objektive Hermeneutik
dient der Analyse der Lebensdaten von Leonora Carrington. Dies ist höchst relevant
für die Darstellung einer Identitätsentwicklung innerhalb der Selbstbildnisse und
bildet gleichzeitig das Forschungsinteresse, die Motivation, die der Arbeit zugrunde
liegt. Die Objektive Hermeneutik betrachtet den Text (hier die objektiven Daten) als
eine autonome Struktur. Mit ihrer Hilfe soll aufgedeckt werden, was der objektive
Sinn des Textes ist.
5
Dabei werden die eigenen Aussagen in der Autobiographie au-
ßer Acht gelassen. Denn es muss beachtet werden, dass Leonora Carrington auch
fiktive Literatur veröffentlicht hat, sodass der Wahrheitsgehalt ihrer eigenen Aussa-
gen ausführlich durch Archivarbeit zu prüfen wäre. Das durch die objektiven Le-
bensdaten von Leonora Carrington Konstituierte soll im Laufe der Arbeit rekonstru-
iert werden.
6
Die objektiven Daten sind als Konstrukt vorsichtig zu behandeln, da
keinerlei persönliche Sichtweisen der betroffenen Person eingearbeitet sind. Sie müs-
sen also so neutral wie möglich formuliert und ohne Vorbehalt durch den Leser/die
Leserin untersucht werden. Das Leben Carringtons wird daraufhin sequentiell be-
trachtet: Satz für Satz wird analysiert, um eine Kreisbewegung der Interpretation
durch Vorkenntnisse des Fortgangs der Biographie zu vermeiden.
7
Die Recherche
der historischen und kontextuellen Bedingungen steckt den Rahmen ab, in dem sich
die Interpretation bewegt (zum Beispiel: Wie werden Frauen im Surrealistenzirkel
5
Vgl. Garz, Detlef und Uwe Raven: Theorie der Lebenspraxis. Einführung in das Werk Ulrich
Oevermanns, Wiesbaden 2015, S. 139
6
Vgl. ebd.
7
Vgl. ebd., S. 139 f. und S. 145
5
betrachtet? Was bedeutet ein Anstaltsaufenthalt um 1940?). Daraufhin werden alle
möglichen Lesarten eines Datums betrachtet in Bezug auf die Frage, welche Bedeu-
tung hinter den Worten stecken könnte. Das Endergebnis bildet die objektive Kon-
struktion einer von der Verfasserin/dem Verfasser eingebetteten Sinnstruktur und
daraus eine für jede/n Leser/in nachvollziehbare Deutung des Geschriebenen nach
der Bildung von Hypothesen bezogen auf das Forschungsinteresse. Diese vermutete
Sinnstruktur muss daraufhin an weiteren Textsequenzen überprüft werden, bis eine
Sinnstruktur, eine Entwicklungsrichtung im Leben, festgelegt werden kann, die dem
Text zugrunde liegt.
8
Beide Forschungsmethoden zusammen bilden eine umfassende
Analyse der relevanten Werke auf der einen und sorgen für ein tiefgehendes Ver-
ständnis des Lebens Leonora Carringtons auf der anderen Seite.
Das Oeuvre von Leonora Carrington ist im Ganzen sehr vielseitig. Zu Beginn wirken
ihre Darstellungen noch eher naturgetreu, als wären sie in der Realität genau so auf-
findbar. Davon entfernt sie sich mit der Zeit jedoch immer mehr. Während der surre-
alistische Einfluss anfangs nur angedeutet erscheint, wird er mit der Entwicklung
ihrer Malweise immer klarer: Ihre Hinwendung zum Traumhaften und Unbewussten
wird beispielsweise durch Mischwesen Hybride oder Groteske ersichtlich. Die
Wahrnehmung und die Wirkung der Darstellung werden vorranging behandelt ge-
genüber der Schönheit ihrer äußeren Erscheinung. Auch religiöse Praktiken, Mystik
und Alchemie kommen in den Werken Carringtons zum Tragen. Die anfänglich hel-
len, klar und strukturiert aufgebauten Gemälde werden immer mystischer, dunkler
und Strukturen sind schwer lesbar. Diese spätere Werkphase wird, wie im Folgenden
erläutert werden wird, für diese Arbeit aber keine Rolle spielen. Leonora Carringtons
Anlehnung an den niederländischen Künstler Hieronymus Bosch (1450-1516) ist
anhand von Mischwesen und anhand des Bildaufbaus in einigen Werken deutlich
erkennbar. Das letzte für diese Arbeit relevante Werk zeigt diese Verbindungen noch
auf. Innerhalb ihres Oeuvres befasst sich Leonora Carrington auch mit Skulptur, die
in dieser Arbeit aber keine weitere Erwähnung finden wird, da der Fokus dieser Ar-
beit auf die Selbstbildnisse gerichtet ist. Die Bezüge zu ihrem eigenen Leben sind
deutlich aus ihren Werken ablesbar. So stellt sie zum Beispiel Max Ernst (1891-
8
Vgl. ebd., S. 153
6
1976) dar, als sie zusammenleben, sie malt alte Frauen, als sie selbst älter wird, und
sie stellt sich selbst in drei Werken bildlich dar.
Um diese drei Werke soll es in dieser Arbeit gehen: Das erste nennt sich ,,Self-
Portrait Inn of the Dawn Horse" (1937/38) (Abb. 1), das zweite, das sich wie
allein schon am Titel erkennbar auf die gleiche Lebensphase wie auch Carringtons
Autobiographie bezieht, heißt ,,Down Below" (1941) (Abb. 3) und das dritte be-
zeichnet sie als ,,Chiki, ton pays" (1947) (Abb. 10). Diese Werke bilden den Kern der
nachfolgenden Überlegungen. Das Interesse der Arbeit liegt darin, eine Entwicklung
in Carringtons Biographie mit einer Entwicklung in ihren Selbstbildnissen in Korres-
pondenz zu setzen. Dies kann zum einen durch ihre überlieferten Lebensdaten, zum
anderen durch die Analyse ihrer Selbstbildnisse gelingen. Zu den ersten Phasen ihrer
Identitätsfindung wird das ,,Self-Portrait Inn of the Dawn Horse" herangezogen, zu
ihrem Anstaltsaufenthalt ,,Down Below" und zu einer späteren Lebensphase ,,Chiki,
ton pays". Diese Werke bilden den Rahmen, der es ermöglicht, eine stilistische und
möglicherweise auch eine persönliche Entwicklung Carringtons aufzuzeigen. Die
Identitätstheorie von Erik H. Erikson (1902-1994) soll hierbei in ihren Grundzügen
einfließen und eine Grundlage für die Betrachtung der Persönlichkeitsentwicklung
Carringtons bilden. Sie stellt jedoch nur ein Teilgebiet dar, mit dessen Hilfe das ei-
gentliche Thema dieser Arbeit die Frage nach der Übereinstimmung von Biogra-
phie und Selbstbildnissen fundiert untersucht werden kann. Um die Identitätstheo-
rie Eriksons in vollem Umfang verstehen und auf Leonora Carrington anwenden zu
können, wird sie mit ihren Phasen in einem eigenen Kapitel vorgestellt. Gerade diese
Identitätstheorie erscheint hierfür geeignet, da sie aus der Psychoanalyse abgeleitet
wurde und somit zu dem surrealistischen Themenfeld passt: Der Surrealismus arbei-
tet viel mit der Psychoanalyse und bezieht sich immer wieder auf Sigmund Freuds
(1856-1939) Theorien. Da Freud selbst sich aber nur indirekt mit der Identität be-
schäftigt hat und den Begriff eher umging, bezieht sich die Arbeit auf seinen Schüler
Erikson. Um eine Identitätsentwicklung Carringtons neben ihrer stilistischen Ent-
wicklung aufzeigen zu können, ist die Bezugnahme zu einer Identitäts- oder Ent-
wicklungstheorie unumgänglich.
Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Auf welche Weise beeinflusst Le-
onora Carringtons Biographie die Selbstbildnisse in ihrem künstlerisch-malerischen
7
Werk? Es gibt des Weiteren mehrere Fragestellungen, die sich als eine Art roter Fa-
den durch die Arbeit ziehen und die es im Laufe der Untersuchungen zu beantworten
gilt: In wie weit zeigt sich eine Identitätsentwicklung in den Selbstbildnissen von
Leonora Carrington? Wie verändert sich der Stil von Leonora Carrington innerhalb
ihrer Selbstbildnisse? Wie stark ist die Veränderung des Stils von den Entwicklungen
innerhalb des Surrealismus beeinflusst worden und ist diese damit ausschließlich ein
Produkt der zeitlichen Umstände? In welchem Verhältnis stehen die Entwicklung
ihres Stils und die Entwicklung ihrer Identität? Welche Verbindungen lassen sich
zwischen Stil- und Identitätsentwicklung aufzeigen?
Zu den Fragen nach dem Anstaltsaufenthalt und nach der Stilentwicklung lassen sich
im Voraus bereits Thesen aufstellen: Die Identitätsentwicklung Carringtons schlägt
sich in der Themenwahl ihrer Selbstbildnisse nieder. Der Stil Carringtons steht in
Korrespondenz mit ihrer Identitätsbildung: Je weiter ihre Identitätsbildung voran-
schreitet, desto kleinteiliger und detaillierter werden ihre Darstellungen. Weitere
Thesen werden sich im Erstellungsprozess der Arbeit bilden lassen.
Zum Forschungsstand lässt sich sagen, dass es generell nur wenige interdisziplinäre
Arbeiten in den Fächern Pädagogik/Kunstgeschichte gibt. Daher lassen sich auch
speziell zu diesem Thema keine anderen Arbeiten finden. Oevermann und Freud
haben selbst Arbeiten zu Künstlerbiographien verfasst, diese aber nicht mit kunsthis-
torischen Methoden verknüpft. Zu den einzelnen Themengebieten Objektive Her-
meneutik, Bildhermeneutik, Identitätstheorie (nach Erikson) und Leonora Carrington
ist, wie aus den begleitenden Fußnoten ersichtlich, Literatur vorhanden, die auch
herangezogen wird, um die Arbeit zu untermauern. Bezüglich der Methoden lässt
sich sagen, dass es eine Verbindung beider hermeneutischer Ansätze der Bildher-
meneutik und der Objektiven Hermeneutik bisher noch nicht gegeben hat. Zwar
wurden Bildwerke mit der Objektiven Hermeneutik untersucht, jedoch wurden die
Objektive Hermeneutik und die Bildhermeneutik als eigenständige Methoden bisher
noch nicht mit dem Ziel der Beantwortung einer oder mehrerer Fragestellungen
kombiniert. Zudem soll durch die Analyseschritte in dieser Arbeit herausgefunden
werden, ob es zukünftig sinnvoll ist, Künstlerbiographien mit der Methode der Ob-
jektiven Hermeneutik zu untersuchen oder ob diese eher ungeeignet ist. Dies soll
aber nur exemplarisch gelten, da diese Arbeit lediglich ein Beispiel für die Kombina-
8
tion der Methoden ist. Um eine allgemeingültige Aussage hierzu treffen zu können,
müssten viele verschiedene Künstlerbiographien zusammen mit ihrem Oeuvre unter-
sucht werden. Dagegen ist es nicht Ziel der Arbeit, eine reine Biographie oder eine
Stilkritik zu Leonora Carrington und ihrem Oeuvre zu schreiben. Auch soll keine
Kritik an der Kunstgeschichte bezüglich des Umgangs mit Künstlerbiographien ge-
übt werden. Im Kontext dieser Arbeit soll nur ein Vorschlag für einen anderen inter-
disziplinären Umgang mit Künstlerbiographien gemacht werden. Dies ist lediglich
der Ort für die Erprobung einer neuen Herangehensweise zum erweiterten Verständ-
nis von Künstler/in und Oeuvre.
Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt gestaltet: Auf die Einleitung folgt die Erläute-
rung des methodischen Vorgehens. Hierfür werden zunächst die Methoden vorge-
stellt, zuerst die Bildhermeneutik und dann die Objektive Hermeneutik. Daraufhin
wird ein Einblick in die Identitätstheorie nach Erik H. Erikson gegeben, da diese die
Grundlage für die Untersuchung der Biographie und der Selbstbildnisse Leonora
Carringtons bildet. Ansätze anderer Identitätstheorien sollen hierbei nicht berück-
sichtigt werden, da diese Arbeit ihren Fokus begründet auf Erikson legt. Den vierten
Abschnitt bildet der Surrealismus. Die Ansichten des entsprechenden Künstlerkreises
werden hier betrachtet und können bereits einen Beitrag zu der späteren Analyse der
Stilentwicklung Carringtons leisten. Ihre Zeitgenossen und die Geschichte der Zeit
werden hier untersucht. Der fünfte Abschnitt über Leonora Carrington bildet den
Kern dieser Arbeit, da es um die eigentliche Analyse von Werk und Biographie geht:
Unter Punkt 5.1 wird die bildhermeneutische Analyse der Werke durchgeführt und
unter Punkt 5.2 die Analyse der objektiven Lebensdaten mithilfe der Objektiven
Hermeneutik. Der sechste Punkt wird beide Analyseschritte zusammenführen und
die Ergebnisse der verschiedenen Analysen einander gegenüberstellen. Im letzten
Schritt soll zum einen das Gelingen der Anwendung der Methoden bewertet und zum
anderen ein Ausblick auf weiterführende Arbeiten oder Forschungsansätze gegeben
werden.
9
2. Methodisches Vorgehen
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, orientiert sich die Arbeit methodisch sowohl
an Panofsky und Rittelmeyer/Parmentier als auch an Oevermann. Die beiden Ansätze
der Bildhermeneutik und die Objektive Hermeneutik sollen im Folgenden vorgestellt
werden, damit die späteren Analyseschritte, bezogen auf Biographie und Werke Le-
onora Carringtons, nachvollziehbar sind.
2.1 Bildhermeneutik
Erwin Panofsky gilt als Begründer des Drei-Stufen-Modells zur Interpretation von
Kunstwerken. Dieses Modell wird in der Kunstgeschichte genutzt, um sowohl die
äußere Form eines Werkes zu analysieren als auch die Bedeutung und die Interpreta-
tion dessen Schritt für Schritt fundiert herauszuarbeiten. Es ist wie folgt aufgebaut:
Die vorikonographische Beschreibung benennt unter anderem Format und Maße ei-
nes Kunstwerkes, untersucht den Bildaufbau sowie die Strukturen und Formen des
Dargestellten.
9
Es geht im ersten Schritt also um die reine Beschreibung des äußeren
Ausdrucks eines Werkes. Wichtig ist hierfür die praktische Erfahrung der Betrachte-
rin/des Betrachters, die dargestellten Gegenstände und Handlungen müssen ihm/ihr
bekannt sein. Der Stil, die Darstellungsweise von Gegenständen und Handlungen in
den verschiedenen historischen Kontexten, muss dem Anwender/der Anwenderin
vertraut sein (,,Stil-Geschichte").
10
Im zweiten Schritt, der ikonographischen Analy-
se, werden die Bildthemen benannt, die sich aus den äußeren Formen erkennen las-
sen.
11
Die einzelnen Formen und Farben eines Werkes werden zusammengeführt und
die Bedeutungen herausgelesen. Der Betrachter/die Betrachterin muss Textquellen
kennen oder wissen, wo diese zu finden sind, um diesen Schritt ausführen zu können.
Die Art und Weise sowie die Gegenstände, mithilfe derer Künstler/Künstlerinnen
bestimmten Bildthemen in den verschiedenen historischen Kontexten Ausdruck ver-
liehen haben, müssen bekannt sein (,,Typen-Geschichte").
12
Im dritten und letzten
Schritt, der ikonologischen Interpretation, wird der Gehalt der Ausdrucksgestalten
untersucht, also die Bedeutung dessen, was im ersten und zweiten Schritt erkannt
9
Vgl. Bätschmann 2009 (wie Anm. 2), S. 58
10
Vgl. ebd., S. 69
11
Vgl. ebd., S. 58
12
Vgl. ebd., S. 69
10
wurde.
13
Einfach gesagt, handelt es sich in diesem Schritt um Menschen- und Ge-
schichtskenntnis. Der Betrachter/die Betrachterin muss die Handlungsmuster und die
Eigenschaften der Menschen kennen und nachvollziehen können, um zu verstehen,
welchen symbolischen Gehalt ein Kunstwerk zum Ausdruck bringt (,,Geschichte
kultureller Symptome").
14
Insgesamt geht die Ikonographie von einem vom Künst-
ler/von der Künstlerin intendierten Sinn aus, der einer Darstellung zugrunde liegt.
Nur so lässt sich der Inhalt eines Werkes vom Betrachter/von der Betrachterin in
einem Sinnzusammenhang deuten. Bestimmte Attribute und deren Bedeutungen
können ein Wegweiser zu einer möglichen Deutung sein, die aber meist nur dann
erfolgt, wenn eine Textquelle der bildlichen Darstellung vorausgeht.
15
Gibt es keine
Textquelle, auf die sich das Werk bezieht, kann der Inhalt beziehungsweise der in-
tendierte Sinn auch benannt werden, jedoch können weitere Sinnzusammenhänge
bestehen, die der Rezipient/die Rezipientin nicht erkennt oder entschlüsseln kann.
16
Diese Sinnstrukturen und weitere Analyseschritte wurden auch von Rittelmeyer und
Parmentier bearbeitet. Die Bildhermeneutik bietet nach Rittelmeyer und Parmentier
viele verschiedene Forschungsfelder. Hier sind jedoch lediglich die Bereiche der
historischen Bildanalyse und der Analyse von Kunstwerken von Relevanz, mit deren
Hilfe sich historische Veränderungen abbilden und in Bezug auf ihre jeweilige Epo-
che deuten lassen.
17
Die elementaren Methoden, die in die nachfolgende Analyse der
Bildwerke einbezogen werden, sind die strukturale, die kontextuelle und die psycho-
logische oder auch mimetische Interpretation.
Die strukturale Interpretation bezieht sich auf den Eindruck, den ein Bildwerk in sei-
ner gesamten Komposition auf den Betrachter macht. Hierbei werden die Ikonogra-
phie, also ,,(...) der Zweig der Kunstgeschichte, der sich mit dem Sujet (Bildgegen-
stand) oder der Bedeutung von Kunstwerken im Gegensatz zu ihrer Form beschäftigt
(...)"
18
, die Anordnung einzelner Elemente im Verhältnis zueinander und die Farb-
wahl in die Überlegungen mit einbezogen.
19
Dieses Vorgehen ähnelt also sehr der
13
Vgl. ebd., S. 58 f.
14
Vgl. ebd., S. 69
15
Vgl. ebd., S. 65 f.
16
Vgl. ebd.
17
Rittelmeyer und Parmentier 2001 (wie Anm. 3), S. 72
18
Panofsky, Erwin: Ikonographie und Ikonologie. Bildinterpretation nach dem Dreistufenmodell,
Köln 2006, S. 36
19
Vgl. Rittelmeyer und Parmentier 2001 (wie Anm. 3), S. 74 f.
11
vorikonographischen Untersuchung bei Panofsky. Die kontextuelle Interpretation
will das Werk im Zusammenhang mit seiner Entstehungszeit deuten. Die Merkmale
jener Zeit müssen hierfür herausgearbeitet werden. Die grundlegenden Fragestellun-
gen lauten hier: Warum hat der Künstler/die Künstlerin ausgerechnet diese Darstel-
lungsweise und keine andere gewählt? Was zeichnet sie in Bezug auf ihre Epoche
aus? Haben zeitgenössische Künstler/Künstlerinnen ähnliche Darstellungsweisen
gewählt? Der Betrachter/die Betrachterin muss sich dafür Hintergrundwissen über
die jeweilige Zeit aneignen, um die Symboliken hinter den einzelnen ikonographi-
schen Bildelementen in einem allgemeinen Zusammenhang entschlüsseln zu kön-
nen.
20
Hier lassen sich Parallelen zu der ikonologischen Interpretation bei Panofsky
ziehen. Bei der psychologischen oder mimetischen Interpretation wird das Abgebil-
dete als ein vom Künstler subjektiv wahrgenommener, visueller Eindruck verstan-
den. Dieser muss vom Betrachter/von der Betrachterin erkannt und verstanden wer-
den, er/sie muss sich also in die Gedanken und Gefühle des Künstlers/der Künstlerin
hineinversetzen.
21
Dieser Interpretationsansatz kann zu Fehldeutungen führen, da der
Betrachter/die Betrachterin Symbole falsch interpretieren oder mit Bedeutungen be-
legen könnte, die der Künstler/die Künstlerin nicht bezwecken wollte. Daher kann
dieser Ansatz nur peripher mit einfließen und der Anwender muss sich und seine
Interpretationsansätze immer wieder in Frage stellen.
22
Grundlage dieser Arbeit bildet das Drei-Stufen-Modell von Panofsky. Die Ansätze
von Rittelmeyer und Parmentier werden zwar in die Betrachtungen mit einfließen,
sind kunsthistorisch jedoch nicht immer korrekt (siehe psychologische/mimetische
Interpretation), sodass sie nicht als Hauptregelwerk für diese Arbeit gelten können.
2.2 Objektive Hermeneutik
Die von Ulrich Oevermann 1969 begründete Objektive Hermeneutik bildet das zwei-
te Standbein dieser Arbeit. Die Objektive Hermeneutik bezieht ihre Gültigkeit aus
Ausdrucksgestalten, also aus allen ,,Fußspuren", die Menschen in dieser Welt hinter-
lassen. Diese Ausdrucksgestalten müssen allerdings protokolliert sein, der symboli-
20
Vgl. ebd., S. 76 f.
21
Vgl. ebd., S. 82 ff.
22
Zu dem Abschnitt über die Methode nach Rittelmeyer/Parmentier siehe Starck, Eva: Die Geschichte
der Universität. Ein bildhermeneutischer Blick auf das Verhältnis von Professor und Student, (= Ba-
chelorarbeit an der Phil. Fak. der CAU), Kiel 2014, S. 2 f.
12
sche Gehalt und die äußere Abbildung müssen somit existieren, um sie untersuchen
zu können.
23
Die Untersuchung unterliegt dabei einem gewissen Regelwerk. Die
latente Sinnstruktur, diejenige Struktur, die unbewusst von demjenigen/derjenigen,
der/die sie erschaffen hat, in die Ausdrucksgestalt eingebettet wurde, wird vom For-
schenden rekonstruiert und in ihrem äußeren Zusammenhang, dem Kontext der Situ-
ation, interpretiert. ,,Dass Lebenspraxis [...] immer schon als eine Sequenzfolge zu
verstehen ist, als ein regelgeleiteter Ablauf und ein Ineinanderübergehen von Ver-
gangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem [...]"
24
, erklärt sich in der Betrachtung
von Biographien und wird durch die Analyse derjenigen von Leonora Carrington
belegt werden. Ein Ereignis in der Vergangenheit eines Menschen wirkt hinein bis in
die Gegenwart und kann seine Zukunft verändern. Somit hat die Biographie eines
jeden Menschen etwas an sich, was sie einzigartig werden lässt.
25
Keine Biographie
ist mit einer anderen identisch, nicht einmal die von Zwillingen, die in ein und der-
selben Familie aufwachsen, dieselbe Schule besuchen und dieselben sozialisatori-
schen Bedingungen haben. Denn die Wahrnehmung bleibt individuell, die durchleb-
ten Situationen sind verschieden interpretiert und verarbeitet worden und damit auch
die gemachten Erfahrungen, die die Gegenwart und die Zukunft beeinflussen. Es
lässt sich daher sagen, dass das menschliche Leben in aufeinander folgende Sequen-
zen unterteilt werden kann. Die Objektive Hermeneutik ist wiederum ihrerseits ,,[...]
dem Wechselspiel von Neuem, Emergenz und Krise einerseits, und Vorbestimmtem,
Determiniertem und Routinen andererseits [...]"
26
nachempfunden. Welche Methode
könnte also geeigneter sein, die Biographie eines Menschen zu untersuchen, als die-
jenige, die genauso aufgebaut ist, wie das Leben selbst? Die Datenauswertung steht
im Mittelpunkt der Objektiven Hermeneutik. Die Datenerhebung ist dabei zweitran-
ging anzusiedeln, da die Methodik der Auswertung für die korrekte Interpretation
und somit für das Ergebnis eines Falls eine bedeutendere Rolle spielt als die Qualität
des Protokolls an sich.
27
Die Vorgehensweise läuft folgendermaßen ab: Das in Text-
form vorliegende Protokoll wird auf eine bestimmte Fragestellung hin sequenziell
interpretiert. Die einzelnen Sequenzen, die sich aus Sinneinheiten ableiten, werden
unabhängig voneinander analysiert und gedeutet. Im Laufe der sich mehrenden Se-
23
Vgl. Garz und Raven 2015 (wie Anm. 5), S. 138
24
Garz und Raven 2015 (wie Anm. 5), S. 139
25
Vgl. ebd., S. 140
26
Ebd., S. 140
27
Vgl. ebd., S. 142 f.
13
quenzinterpretationen werden einzelne Deutungen bezüglich der anfangs festgelegten
Fragestellung erarbeitet, verändert oder negiert, bis sich verschiedene Lesarten ent-
wickeln. Diese Lesarten müssen intersubjektiv verständlich, also für andere nach-
vollziehbar sein, um bestehen zu bleiben. Während der gesamten Sequenzanalyse
darf die- oder derjenige, die oder der sie anwendet, nicht vorgreifen und somit keine
Vorkenntnisse über den weiteren Verlauf der Biographie einbringen. Jede Sequenz
wird unabhängig von den darauffolgenden interpretiert, da sonst eine kreisförmige
Bewegung entstehen kann man sucht in diesem Fall lediglich Belege für eine im
Voraus getroffene Annahme und ist nicht mehr offen für neue Lesarten. Ist bei dem
Forschenden bereits Wissen über den Kontext der Sequenzen vorhanden, darf dieses
nicht mit in die Analyse einbezogen werden. Bei der Sequenzanalyse ist die Qualität
wichtiger als die Quantität. Die Detailgenauigkeit spielt für die Entwicklung und das
Belegen beziehungsweise das Widerlegen von Lesarten eine größere Rolle als die
Anzahl der Sequenzen oder objektiven Daten. Diese Sequenzen und Daten können je
nach Relevanz gewählt werden, der Forschende unterliegt also keinem gezielten
Auswahlverfahren.
28
Zusammengefasst geht es bei der Objektiven Hermeneutik um die Rekonstruktion
einer latenten Sinnstruktur in einem Protokoll in Bezug auf eine konkrete Fragestel-
lung. In Bezug auf die objektiven Lebensdaten von Leonora Carrington scheint die
Objektive Hermeneutik das ideale Verfahren zur Entschlüsselung der Verbindung
von Oeuvre und Biographie zu bieten.
3. Identität nach Erik H. Erikson
Erik Homburger Erikson hat ein Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung for-
muliert, welches die Entwicklungsphasen eines Menschen im Reifungsprozess dar-
stellt. Dieses Stufenmodell soll bei der Betrachtung der Biographie Leonora Carring-
tons dabei helfen, ihren Entwicklungsprozess nachzuvollziehen und mögliche Erklä-
rungen für die gewählte Machart der Selbstbildnisse und vor allem die Art der Ver-
änderungen dieser zu liefern.
28
Vgl. ebd., S. 143-147
14
Zunächst soll nun der Begriff der Identität so erläutert werden, wie Erikson ihn ver-
steht, um seine Theorie grundlegend verstehen zu können. Seine Definition stützt
sich auf Annahmen von Sigmund Freud und William James (1842-1910).
29
Das Ich
wird hier als ,,[...] bewusstes, autonomes und intentionales Agens begriffen [...]"
30
.
Zum Ersten formuliert Erikson Identität als ,,Ich-Gefühl", als aktives Ich, das sich
imstande fühlt, bewusst zu handeln, beteiligt ist an äußeren Geschehnissen und sich
nicht dem Schicksal ausgeliefert fühlt. Dieses bewusste Ich muss gleichzeitig in einer
Beziehung zu Anderen stehen, um sich vergleichen und abgrenzen, um die eigene
Realität wahrnehmen zu können. Zum Zweiten bezeichnet Erikson Identität als ein
Zusammenwirken vom ,,persönlichen Ich" dem Wissen um die eigene Existenz und
die eigenen bestehenden Wesenszüge und der Umwelt, also dem soziokulturellen
Umfeld. Die Identität und ihre Entwicklung werden von diesem Umfeld beeinflusst.
Und zum Dritten wird die Identität geprägt von den immer wiederkehrenden Prozes-
sen der Anpassung an die Umwelt. Für die Ausbildung einer Identität ist es also not-
wendig, grundlegende Eigenschaften und Charakterzüge zu behalten, jedoch gleich-
zeitig das Bedürfnis nach Weiterentwicklung aufrechtzuerhalten.
31
Somit ist die
Identitätsbildung ein lebenslang andauernder Prozess und ein Wechselspiel von Er-
haltung und Erneuerung. Das ,,Identitätsgefühl" lässt den Menschen sich selbst als
etwas Beständiges und Dauerhaftes erleben, was in einer ,,Ich-Identität" mündet. Die
Ich-Identität ist das Bewusstsein darüber, dass alle Anpassungsprozesse gleich oder
zumindest ähnlich ablaufen, dass es Aspekte gibt, die immer bestehen bleiben. Diese
Kontinuität zu bewahren, die grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale unter wech-
selnden äußeren Bedingungen nicht zu verlieren, ist die Hauptaufgabe während des
Prozesses der Identitätsbildung.
32
Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass die
Identität nach Erikson sowohl auf der Kontinuität grundlegender Persönlichkeits-
merkmale als auch auf der ständigen Anpassung an die Umwelt beruht.
Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung leitet sich aus der Theorie der
psychosexuellen Entwicklung nach Freud ab und ist Teil seiner Theorie der lebens-
langen Entwicklung. Aus der Theorie Freuds übernimmt er die Prämissen, dass das
29
Vgl. Noack
Juliane: Erik H. Eriksons Identitätstheorie, (= Pädagogik: Perspektiven und Theorien,
Bd. 6), Oberhausen 2005, S. 209
30
Ebd., S. 209
31
Vgl. ebd., S. 210 f.
32
Vgl. ebd., S. 212
15
Unbewusste Träume und Tätigkeiten im Tagesbewusstsein beeinflusst und dass Er-
fahrungen in der frühen Kindheit die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen.
33
Al-
lerdings findet bei Erikson eine Verschiebung des Schwerpunktes vom Psychischen
zum Psychosozialen hin statt, wie sich allein schon in der Bezeichnung der Theorie
zeigt. Erikson geht es darum, ,,soziale Leitbilder", also Eltern, Großeltern usw., und
den einzelnen Menschen in einem Verhältnis der gegenseitigen Beeinflussung zu
betrachten.
34
Aus dem Zusammenwirken von Gruppen- und Ich-Identitäten bildet
sich das aus, was Erikson als Realität begreift. Somit ließe sich behaupten, dass
Erikson eine konstruktivistische Sicht auf den Realitätsbegriff postuliert, wenn er
annimmt, dass sich die Welt aus individuellen Wahrnehmungsmustern konstituiert.
35
Die Persönlichkeit eines Menschen beinhaltet nach Erikson seine Ich-Identität. Die
Ich-Entwicklung findet im Gleichschritt mit den Stufen der psychosozialen Entwick-
lung statt, endet aber mit der Adoleszenzphase. Die erste Phase der Ich-Entwicklung
wird als ,,Introjektion" bezeichnet, bei der das Kind durch die Interaktion mit einer
festen Bezugsperson sich selbst und die Abgrenzung zu anderen Menschen wahrzu-
nehmen lernt.
36
Die grundlegenden Bedürfnisse werden im Idealfall befriedigt, so-
dass sich ein überwiegend positives Gefühl bezogen auf die eigene Existenz beim
Kleinkind bemerkbar macht.
37
In der zweiten Phase, der ,,Identifikation", beruft das
Kind sich nicht mehr nur auf eine feste Bezugsperson, sondern erweitert sein Spekt-
rum auf andere Familienmitglieder, von denen es Verhaltensweisen, Charakterzüge
oder ähnliches übernimmt. Diese Übernahme findet unbewusst statt und variiert in-
dividuell.
38
Hierfür muss eine Abgrenzung von der ersten Bezugsperson vollzogen
werden, damit das Kind lernt, für eigene Handlungen die Verantwortung zu über-
nehmen. Die dritte Phase, die ,,Identitätsbildung", findet überwiegend in der Adoles-
zenz statt und ist wichtig, um eigene Standpunkte, Eigenschaften und Handlungs-
muster zu entwickeln, um nicht länger von den Identifikationen mit anderen sozialen
Leitbildern abhängig zu sein.
39
Bis der Mensch ein Identitätsgefühl entwickelt, ver-
gehen laut Erikson 20 Jahre. In der Adoleszenz muss ein Gleichgewicht hergestellt
33
Vgl. Noack, Juliane: Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus, in: Schlüsselwerke der Identitäts-
forschung, hg. v. Benjamin Jörissen und Jörg Zirfas, Wiesbaden 2010, S. 37-54, hier S. 37
34
Vgl. ebd., S. 38
35
Vgl. Noack 2005 (wie Anm. 28), S. 66 ff.
36
Vgl. ebd., S. 176
37
Vgl. ebd., S. 177
38
Vgl. ebd. 176 f.
39
Vgl. ebd.
16
werden zwischen dem, was man durch die Prägung in seiner Vergangenheit gewor-
den ist, und dem, was man in der Zukunft werden will. All das wird schließlich ab-
geglichen mit der eigenen Außenwirkung, mit dem, was, subjektiv vermutet, andere
über die eigene Identität denken und wie sich die eigene Identität gegenüber anderen
unterscheidet. Die Bewusstwerdung über das eigene Selbst und das Vergleichen mit
Gleichaltrigen sowie das Suchen neuer Vorbilder außerhalb der Familie lösen die
reine Identifikation mit innerfamiliären Bezugspersonen ab, und die Ich-Identität
bildet sich aus.
40
Im Folgenden sollen nun die acht Stufen der psychosozialen Entwicklung nach
Erikson skizziert werden. All diese Phasen sind Teil der Entwicklung einer Ich-
Identität nach Erikson. Die Theorie ist im Ganzen höchst normativ, da es entweder
eine positive oder viel mehr ,,gesunde" Entwicklung der Identität gibt oder aber eine
negative, die zur Entstehung von psychischen Krankheitsbildern führen kann. Die
aus der Kindheit gewonnenen Erfahrungen bilden nach Erikson die Grundlage für die
Bewältigung des Lebens als Erwachsener. Eine eindeutige Definition des Begriffs
,,Identität" ist schwer greifbar. Sie schließt sich zusammen aus den eigenen, indivi-
duellen Erfahrungen und Werten des einzelnen Menschen einerseits und den histori-
schen Entwicklungen und dem Wertesystem seines soziokulturellen Umfeldes und
der Gesellschaft, in der er aufwächst, andererseits.
41
Der einzelne Mensch prägt also
seine Umwelt ebenso wie die Umwelt den einzelnen Menschen prägt. Diese Symbio-
se besitzt so lange Kontinuität und Gültigkeit, wie es Menschen und Gesellschaften
gibt.
3.1 Kindheit
Ur-Vertrauen versus Ur-Misstrauen (erstes Lebensjahr)
Die erste Phase der psychosozialen Entwicklung bildet die Grundlage für eine ,,ge-
sunde Persönlichkeit".
42
Sie bezieht sich auf die aus der Psychoanalyse stammende
,,orale Phase", in der das Kind seine Umwelt über den Mund wahrnimmt. Als Kurz-
40
Vgl. ebd., S. 212 ff.
41
Vgl. ebd., S. 124
42
Vgl. Erikson, Erik H.: Identität und Lebenszyklus, 27. Aufl., Frankfurt am Main 2015, S. 63
17
zusammenfassung ließe sich sagen, dass das Kind ist, was es bekommt.
43
Das meiste
Erleben bezieht sich in der ersten Hälfte dieser Phase auf die Nahrungsaufnahme, das
Aufnehmen der Muttermilch. Das Saugen wird jedoch auch auf andere Gegenstände
übertragen, alles wird in den Mund genommen. Darum wird diese Phase auch als
,,Einverleibungs-Phase" bezeichnet.
44
Die Mutter ist daher also die Gebende und das
Kind das Nehmende. Dass das Kind lernt, dass es durch bestimmtes Verhalten Nah-
rung bekommt, also eine Reaktion bei der Mutter auslöst, ist essenziell für die späte-
re eigene Entwicklung der Fähigkeit zu geben.
45
Die Beziehung zwischen Mutter und
Kind ist hierbei aber wechselseitig. Das heißt, wenn die Mutter die Bedürfnisse des
Kindes nicht deuten kann, fühlt sich das Kind vernachlässigt, sodass sein Verhältnis
zur Umwelt geschädigt werden kann. Das Kind zieht noch keine Grenze zwischen
sich selbst und seiner Mutter, es nimmt sich als Teil der Bezugsperson und damit
nicht als Einzelwesen wahr. Ganzheitlich gesehen ist das Verhalten der Mutter ge-
genüber dem Kind zusätzlich von der eigenen Kultur geprägt, sodass das Kind meist
so behandelt wird, wie es für das Hineinwachsen in die Kultur notwendig ist.
46
Damit
das Vertrauen in sich selbst und in die Umwelt des Kindes wachsen kann, ist die
Qualität der Mutter-Kind-Bindung wichtiger als die Quantität. Eine Erziehung im
traditionellen Sinn der Kultur scheint hierbei erfolgreich zu sein; wenn das Kind fest-
stellt, dass hinter jeder Handlung ein Sinn verborgen ist, lässt sich das Vertrauen des
Kindes fundierter ausbilden. Ebenso scheint die Religion beziehungsweise der Glau-
be an etwas Größeres, auf das man sich verlassen kann, die Vertrauensbildung beim
Kind positiv zu beeinflussen.
47
In der zweiten Hälfte dieser Entwicklungsphase kommt es zu einer Krise, in der das
Kind lernt, über andere Körperteile als nur den Mund seine Umwelt wahrzunehmen.
Der Bewegungsspielraum des Kindes wird größer, das Zahnwachstum beginnt und es
kann Dinge visuell und akustisch aufnehmen und unterscheiden.
48
Somit hat das
Kind ein immer größer werdendes Bedürfnis nach Aufnahme jeglicher Art. Es muss
zudem mit der Veränderung im Mundbereich zurechtkommen. Es beginnt sich selbst
43
Vgl. ebd., S. 98
44
Vgl. ebd., S. 64
45
Vgl. ebd., S. 65
46
Vgl. ebd., S. 64 f.
47
Vgl. ebd., S. 72-75
48
Vgl. ebd., S. 67 f.
18
als eigenes Wesen wahrzunehmen und identifiziert sich nicht mehr mit der Mutter.
Zusätzlich wird der in den ersten Wochen und Monaten höchst enge Kontakt zwi-
schen der Mutter und ihrem Kind weniger, da sie sich wieder intensiver mit anderen
Dingen beschäftigt.
49
Wenn zur gleichen Zeit das Stillen beendet wird, kann es beim
Kind zu einer Depression kommen, da es die Situation als Liebesentzug und großen
Verlust empfinden kann. So kann sich ein Ur-Misstrauen manifestieren.
50
Aus die-
sem Ur-Misstrauen können sich im späteren Leben Verlustängste und Esssüchte
entwickeln. Wenn das Kind in dieser oben beschriebenen Krise jedoch nicht sich
selbst und seinen negativen Gefühlen überlassen bleibt, sondern von der Mutter be-
sonders liebevolle Zuwendung erfährt, wächst ein Gefühl des Vertrauens. Dieses
bezieht sich sowohl auf die Versorgungssicherheit und die Sicherheit in der äußeren
Welt als auch auf das Kind selbst, die Leistungsfähigkeit der Organe und die Fähig-
keit, die Bezugsperson als Versorger/Versorgerin halten zu können.
51
Hierbei kann
aber auch ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen, das später durch jegliche Sehnsüch-
te und Hoffnungen Ausdruck findet. In Verbindung mit den darauffolgenden ,,[...]
Phasen führt [diese erste Phase] beim Erwachsenen zu einer Kombination von Glau-
ben und Realismus."
52
Autonomie versus Scham und Zweifel (zweites und drittes Lebensjahr)
In der zweiten Phase kommt es zur Entwicklung der eigenen Autonomie, für die das
in der ersten Phase entstandene Vertrauen die Grundlage bildet. Hier geht es um die
Erkenntnis des eigenen Willens, sodass das Kind in dieser Phase mehr oder weniger
ist, was es will.
53
Das Kind lernt nun, dass es festhalten und loslassen kann, weil es
sich körperlich verändert und stärker wird. Dies überträgt sich ebenfalls auf die Psy-
che, sodass das Kind einen eigenen Willen ausbildet.
54
Festhalten und Loslassen
spielt hier auch für das soziale Leben eine große Rolle: Je nach Entwicklung kann
das Festhalten einem Akt des Erdrückens und Unterdrückens, aber auch des Umsor-
gens und liebevollen Haltens gleichkommen.
55
Ebenso kann das Loslassen als
49
Vgl. ebd., S. 68
50
Vgl. ebd., S. 69
51
Vgl. ebd., S. 70
52
Ebd., S. 70
53
Vgl. ebd., S. 98
54
Vgl. ebd., S. 76
55
Vgl. ebd., S. 80 f.
19
Gleichgültigkeit oder Toleranz verstanden werden. Erikson wendet auf diese Phase
den aus der Psychoanalyse stammenden Begriff ,,Analität" an. Denn in dieser Zeit
lernt das Kind, seine Ausscheidungen ansatzweise zu kontrollieren und so damit um-
zugehen, wie seine Kultur es ihm vorlebt.
56
Wird das Kind zu früh und zu streng von
den Windeln entwöhnt, kann dies zu starkem Widerstand oder großer Frustration
führen, worauf das Kind mit sichtbarem Rückschritt in Verhaltensweisen der ersten
Phase oder Scheinentwicklung reagiert.
57
Mit 24 bis 28 Monaten beginnt das Kind
sich seiner Autonomie bewusst zu werden. Zu dieser Zeit sollte nicht mit der Sau-
berkeitserziehung begonnen werden, weil das Kind seinen Willen gegen den der El-
tern stellt und das Gefühl des gebrochenen Willens in dieser Anfangszeit einen
schlechten Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung darstellt.
58
Das Kind lernt,
dass es ein Individuum ist und sollte in dieser Erkenntnis mit seinem eigenen Willen
zunächst uneingeschränkt akzeptiert werden.
Diese zweite Phase ist geprägt von Widersprüchen: Die Entwicklung des Kindes
bildet hier den Grundstein für seine Einstellung gegenüber Liebe und Hass, Folg-
samkeit und Eigensinn, Auslebung seines Selbst und Unterdrückung.
59
,,Aus einer Empfindung der Selbstbeherrschung ohne Verlust des Selbstgefühls
entsteht ein dauerndes Gefühl von Autonomie und Stolz; aus einer Empfindung
muskulären und analen Unvermögens, aus dem Verlust der Selbstkontrolle und
dem übermäßigen Eingreifen der Eltern entsteht ein dauerndes Gefühl von
Zweifel und Scham."
60
Wecken die Eltern im Kind Schamgefühle für die nicht schnell genug erlernte Sau-
berkeit, hat das Kind Schuldgefühle und empfindet sich selbst als klein. Dies hat
wiederum Einfluss auf die Wahrnehmung des Kindes, das soeben lernt sich aufzu-
richten und zu stehen, bezüglich seiner eigenen Stärke im Verhältnis zu seiner Um-
gebung. Was für das Kind mit Scham belegt ist, wird nun umso interessanter, sodass
es zur heimlichen Auslebung dieser Dinge kommt.
61
Wenn das Kind seinen Wunsch
nach Betasten und Untersuchen von Dingen nicht ausleben kann, wendet es diesen
56
Vgl. ebd., S. 76 f.
57
Vgl. ebd., S. 78
58
Vgl. ebd., S. 83
59
Vgl. ebd., S. 78
60
Ebd., S. 78 f.
61
Vgl. ebd. 2015, S. 79 f.
20
nach innen, was zu Selbstkritik und einem verfrüht entwickelten Gewissen führen
kann. Dies äußert sich meist durch die Bildung eines Zwangscharakters oder einer
Scheinautonomie.
62
Wenn die Eltern dem Kind gegenüber jedoch sowohl akzeptie-
rend als auch bestimmt auftreten, kann sich die Autonomie frei ausbilden und es
kann sich selbst und anderen gegenüber Akzeptanz entwickeln. Was die Eltern dem
Kind vorleben, was sie für Werte vermitteln, prägt das Kind und lässt es in eine ähn-
liche Richtung streben. Die Autonomie des Kindes spiegelt also das Selbstgefühl der
Eltern wider.
63
Hierfür spielt die soziale und gesellschaftliche Einbindung der Eltern
eine wichtige Rolle: Wenn das Kind erlebt, dass die Eltern sozial eingebunden sind,
sich gegenseitig respektvoll behandeln, zur politischen Obrigkeit und zum Arbeitge-
ber ein gutes Verhältnis haben, glaubt das Kind an die eigene Autonomie. Reagieren
die Eltern aber wiederum mit Frustration auf die eben genannten Aspekte, kann dies
im Kind zu Scham und Zweifel führen. Akzeptanz der hierarchischen Position in der
Gesellschaft seitens der Eltern ist in dieser Phase besonders wichtig.
64
Die Autono-
mie des Kindes ist eng verknüpft mit der Autonomie des Erwachsenen in Beruf, Poli-
tik und Gesellschaft.
65
Heterogenität und Homogenität müssen sich in dem, was vor-
gelebt wird, die Waage halten, wenn die Konstitution der Autonomie im Kind erfolg-
reich sein soll.
Initiative versus Schuldgefühl (drittes bis sechstes Lebensjahr)
Wie in der zweiten Phase bereits angedeutet, gehen das Lebensgefühl und die Ein-
stellung der Eltern auf das Kind über. Die Eltern sind die direkten Vorbilder für das
Kind. Diese Phase ließe sich so zusammenfassen, dass das Kind ist, was es sich in
seiner Phantasie vorstellen kann.
66
In dieser Phase entwickelt sich der Bewegungsap-
parat des Kindes erneut weiter, sodass es sich weitläufiger betätigen kann, und es
verbessert seine Sprache. Beides zusammen führt zur Ausbildung einer ausgeprägten
Phantasie- und Traumwelt, die im Kind auch Angst auslösen kann.
67
Diese Krise darf
aber die Initiative des Kindes nicht einschränken, da sie den Ausgangspunkt für den
Wunsch nach Eigenständigkeit und Leistung darstellt. Wenn die Krise überstanden
62
Vgl. ebd., S. 81
63
Vgl. ebd., S. 84
64
Vgl. ebd., S. 85
65
Vgl. ebd., S. 113
66
Vgl. ebd., S. 98
67
Vgl. ebd., S. 87
21
ist, lernt das Kind, Unterschiede deutlicher wahrzunehmen. Größe, Geschlecht und
Rolleneinteilungen stehen hier im Fokus. Nun findet auch die erste Begegnung mit
der ,,infantilen Sexualität" statt, während der das Kind erkennt, dass ein großer Un-
terschied zwischen ihm und seinem Vater (beim Jungen) beziehungsweise ihm und
seiner Mutter (beim Mädchen) besteht.
68
Erikson erwähnt an dieser Stelle den von
Freud erforschten Ödipus-Komplex, laut dem sich die erste sexuelle Regung bei
Mädchen auf den Vater und bei Jungen auf die Mutter bezieht und aus der eine Eifer-
sucht auf Mutter oder Vater erwachsen kann. Mädchen erkennen hier, dass sie ge-
genüber den Jungen durch den fehlenden Phallus benachteiligt sind, da sie in man-
chen Kulturen dadurch niemals mit den Männern gleichgestellt werden können.
69
In dieser Phase entwickelt das Kind die ersten Ziele bezüglich sozialer Stellung so-
wie den Ehrgeiz, diese Ziele zu erreichen. Da dies mit dem Eintritt in die Schule zu-
sammentrifft, verändert sich die Persönlichkeit des Kindes. Einstige Wünsche und
Sehnsüchte werden durch das Anpassen an das Schulsystem unterdrückt. Dies ergibt
sich zum einen aus der Erziehung und zum anderen aus der geistigen Neuausrich-
tung, die durch die Biologie, hier den Aufschub der Geschlechtsreife, und die Psy-
che, dort die unterdrückten Wünsche aus der Kindheit, bedingt sind.
70
Auch in dieser
Phase kommt es zu einer erneuten Krise, wenn das Kind sich selbst als Gegner der
Älteren sieht und diese übertrumpfen möchte. Durch den Kampf gegen den Vater
(beim Jungen) beziehungsweise gegen die Mutter (beim Mädchen) und die durch die
altersbezogene Hierarchie bedingte Niederlage kommt es beim Kind zu Schuld- und
Angstgefühlen. Sie führen beim Jungen zur Angst vor Penisverlust und beim Mäd-
chen zur Gewissheit, ihn bereits verloren zu haben. All dies sieht das Kind als Folge
seiner sexuellen Phantasien bezüglich Vater oder Mutter.
71
Um diese Situation zu
verlassen, suchen sich die Kinder meist andere Vorbilder in ihrer Umwelt, identifi-
zieren sich aber weiterhin mit Mutter oder Vater. Dem Geschlecht entsprechend,
kann jedoch auf diese Phase reagiert werden, indem der Vater mit dem Sohn oder die
Mutter mit der Tochter durch gemeinsame Interessensbildung und Aktivitäten gegen-
seitige Solidarität und Akzeptanz bildet.
72
So kann sich aus dieser Krise heraus
68
Vgl. ebd., S. 90
69
Vgl. ebd., S. 90 f.
70
Vgl. ebd., S. 92
71
Vgl. ebd., S. 93
72
Vgl. ebd., S. 96 f.
22
schließlich ein Gewissen entwickeln, das die Initiative antreibt. Dieses kommt aber
nur zustande, wenn das Kind in sich selbst und sein Leben in Abhängigkeit Vertrau-
en hat. Die Angst, dass Verstöße entdeckt werden könnten, wächst, und das Kind
empfindet Schuld für schlechte Gedanken. Daraus kann sich mit der Zeit moralisches
Denken ausbilden.
73
Gehen die Eltern zu streng mit ihrem Kind um, kann das Gewis-
sen rigide werden. Auch wenn die Eltern bei sich selbst andere Maßstäbe anlegen als
beim Kind und Regeln überschreiten, die für das Kind gelten, kann es dazu kommen,
dass das Kind meint, das Leben bestehe aus Selbstherrlichkeit und Machtausübung.
Vergeltung und Ausbeutung anderer Menschen versteht das Kind unter diesen Um-
ständen später als moralisch korrekt.
74
Durch Schwierigkeiten in dieser Phase kann
es später dazu kommen, dass der Mensch sich selbst in Rollen drängt, die seinem
Wesen nicht entsprechen, oder er sich selbst unter Leistungsdruck setzt, um seine
Initiative zu demonstrieren. All dies kann in psychosomatischen Erkrankungen resul-
tieren.
75
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Initiative des Kindes mit der
Einstellung der Menschen in seinem direkten und weiteren Umfeld korrespondiert.
Es ist eine Art Lebensgefühl und Lebenseinstellung, die von der Gesellschaft ausge-
hen und vom Kind wahrgenommen werden.
76
Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl (sechstes Lebensjahr bis Pubertät)
In der vierten Phase entwickelt das Kind neue Fähigkeiten; es möchte neben dem
bekannten Spiel auch etwas Sinnvolles schaffen. Es ließe sich sagen, dass das Kind
ist, was es lernt.
77
Hier kommt die Initiative des Kindes zum Tragen: Es macht Dinge
nach, die es bei anderen beobachtet. Allerdings wird es für das Kind durch die stark
ausgeprägte Pluralisierung immer schwieriger zu erfassen, in welche Richtung seine
Initiative geht. Auch die Schule scheint nicht in die reale Welt eingebunden zu sein,
sondern stellt eher einen abgetrennten Lebensbereich dar, in dem andere Wünsche,
Misserfolge und Regeln bestehen als in der Außenwelt.
78
Hier sollte das Kind zum
einen spielerisch an das Lernen herangeführt werden, um den Spaß daran nicht zu
verlieren, zum anderen sollte das Kind mit Konzentration und Disziplin bei der Sa-
73
Vgl. ebd., S. 94 f.
74
Vgl. ebd.
75
Vgl. ebd., S. 95 f.
76
Vgl. ebd., S. 113
77
Vgl. ebd., S. 98
78
Vgl. ebd., S. 99 f.
23
che bleiben. Wenn das Kind nach und nach mit logischen und lebenspraktischen Zu-
sammenhängen konfrontiert wird, bekommt es ein Gefühl der Teilhabe an der Er-
wachsenenwelt. Scheitert die Zusammenführung von Spaß und Ernsthaftigkeit sowie
Unterweisung und Selbstständigkeit bezüglich des Lernens, kann sich das Kind ent-
weder von den Anweisungen anderer ein Leben lang abhängig machen oder aber es
verliert die Lust am eigenständigen Lernen.
79
Das Spiel hat bei Kindern in dieser und
den vorangehenden Phasen zudem eine ganz andere Bedeutung als die der Entspan-
nung und Ablenkung, die es bei Erwachsenen hat. Über das Spiel hat das Kind die
Möglichkeit, schwierige Situationen und Erlebnisse zu verarbeiten. Beherrscht es im
Spiel die Dinge, entwickelt das Kind das Gefühl, dass es auch die Dinge des realen
Lebens beherrscht.
80
Neben der Konzentration auf Schule und Spiel beginnt das Kind
in dieser Stufe den ,,Werksinn" zu entwickeln, den Erikson als Gefühl der eigenen
Nützlichkeit beschreibt. Das Kind möchte etwas sehr gut beherrschen und dadurch
eine Bedeutung für die Gesellschaft entwickeln. Bezogen auf den psychoanalyti-
schen Begriff des Latenzstadiums lenkt der junge Mensch seinen Wunsch nach El-
ternschaft auf den Werksinn um. Er überbrückt so die Zeit bis zur Geschlechtsreife.
81
Erlebt das Kind in dieser Zeit Enttäuschungen oder wird zu früh in diese Phase hin-
eingedrängt, kann dies zu Selbstzweifeln und einem Selbstgefühl der Mangelhaf-
tigkeit führen. Das unterstützende und fördernde Einwirken von Eltern und Lehrerin-
nen/Lehrern kann das Kind jedoch auffangen und neuerlich motivieren.
82
Doch auch
hier bestehen verschiedene Gefahren, die zu einer fehlerhaften Entwicklung führen
können: Das Kind könnte den Eindruck bekommen, es könne die Erwartungen der
Lehrer/Lehrerinnen nicht erfüllen. Es könnte sich aber auch dem Lehrer/der Lehrerin
gegenüber zu unterwürfig verhalten, um bevorzugt zu werden, was sich in einem
verfrühten Identitätsgefühl niederschlagen würde. Oder aber es könnte keine Freude
an der Arbeit beziehungsweise am Lernen entwickeln, wenn es nie auf etwas stolz
war, was es vollbracht hat.
83
In dieser Phase gibt es zwar keine direkten Krisen, wie
sie das Kind in den anderen Phasen oft durchleben muss, da die bisher präsenten
Triebe nun schlummern. Aber trotzdem ist dieses Stadium relevant in Bezug auf Ge-
rechtigkeit und Zusammenarbeit mit anderen, sodass sich hier ein grundlegendes
79
Vgl. ebd.
80
Vgl. ebd., S. 101 f.
81
Vgl. ebd., S. 102 f.
82
Vgl. ebd., S. 103 f.
83
Vgl. ebd., S. 104 f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (Paperback)
- 9783956367199
- ISBN (PDF)
- 9783956368677
- Dateigröße
- 6.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Christian-Albrechts-Universität Kiel – Allgemeine Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Juni)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- leonora carrington eine untersuchung auswirkungen entwicklungen selbstdarstellung
- Produktsicherheit
- Diplom.de