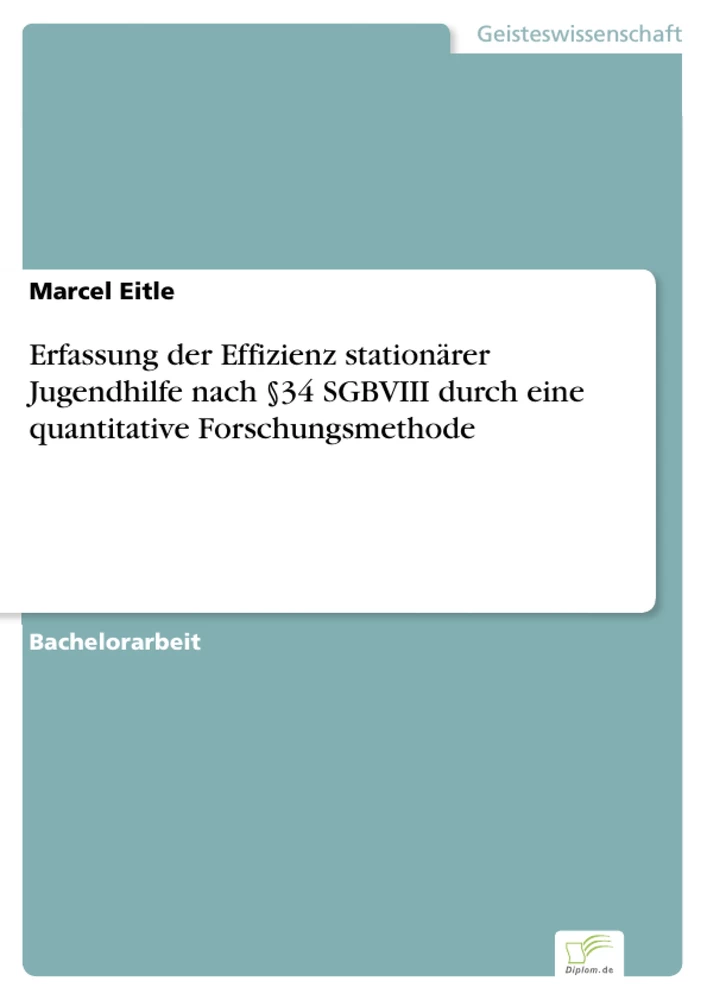Erfassung der Effizienz stationärer Jugendhilfe nach §34 SGBVIII durch eine quantitative Forschungsmethode
©2015
Bachelorarbeit
95 Seiten
Zusammenfassung
Die Sozialarbeit ist eine am Klientel orientierte, dienstleistungserbringende Maßnahme, die als oberste Direktive das Ziel verfolgt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Wahl effektiver Maßnahmen - im Blick auf das Individuum - ist in der sozialen Arbeit die grundlegende Voraussetzung für eine optimale Kosten-Nutzen-Relation. Doch stellt sich die Frage, was effektive Maßnahmen sind? Wie lässt sich Effektivität messen? Wer beurteilt die Effektivität und Effizienz solcher Maßnahmen?
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Wirkungsweise der stationären Jugendhilfe.
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Wirkungsweise der stationären Jugendhilfe.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
i
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ... 1
2. Theoretischer Teil ... 3
2.1. Allgemeine Einführung in die Jugendhilfe ... 3
2.1.1. Geschichte der Jugendhilfe ... 3
2.2. Allgemeine Einführung in die stationäre Jugendhilfe ... 4
2.2.1. Ziel- und Aufgabensetzung der Kinder- und Jugendhilfe ... 5
2.2.2. Rechts- und Regelungsgrundlagen der stationären Hilfen zur
Erziehung im Bundesländervergleich ... 6
2.2.3. Trägerschaften der Jugendhilfe ... 8
3. Qualitätssicherung in der Jugendhilfe ... 10
3.1. Der Qualitätsbegriff ... 10
3.2. Unterschied zwischen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung .. 12
3.3. Effizienz und Effektivität ... 12
3.4. Nutzen des Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen ... 13
3.5. Instrumente der Qualitätssicherung in der Jugendhilfe ... 14
3.5.1. Der Hilfeplan... 14
3.5.2. Die Entgelt-,Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen ... 16
4. Vertiefende Einführung in das Qualitätsmanagement ... 20
4.1. Dimensionen der Qualitätssicherung ... 20
4.2. Verfahren und Methoden des Qualitätsmanagements ... 21
4.2.1. Total-Quality- Management (TQM) ... 21
4.2.2. Das E.F.Q.M.- Modell ... 22
4.2.3. Balance- Scorecard ... 23
4.2.4. Benchmarking ... 24
4.2.5. Interne Evaluation ... 25
4.2.6. DIN EN ISO 9000 ff. ... 26
ii
5. Störungsbilder des Klientel stationärer Jugendhilfeeinrichtungen ... 27
5.1. Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens ... 29
5.2. Störungen des Sozialverhaltens / Aggressiv-dissoziale Störungen ... 34
5.3. Tic-Störungen ... 36
5.4. Enuresis ... 39
5.5. Lese-und Rechtschreibschwäche ... 42
5.6. Depression ... 44
5.7. Die Posttraumatische Belastungsstörung ... 47
5.8. Somatoforme Störungen ... 48
5.9. Selbstverletzendes Verhalten ... 50
6. Konsequenzen für die Heimarbeit ... 52
7. Untersuchung durchgeführter Studien ... 54
7.1. Würzburger Jugendhilfe-Evaluationsstudie (WJE) - Die Wirksamkeit
von heilpädagogisch- therapeutischen Hilfen ... 54
7.1.1. Ergebnisse der Studie ... 56
7.1.2. Kritische Anmerkungen ... 57
7.2. Jugendhilfe - Effekt-Studie (JES) ... 57
7.2.1 Ergebnisse der Studie ... 59
7.2.2. Kritische Anmerkungen ... 60
7.3. Evaluationsstudie erzieherischer Hilfen (EVAS) ... 60
7.3.1. Ergebnisse der Studie ... 61
7.3.2. Kritische Anmerkungen ... 62
8. Empirischer Teil... 63
8.1. Begründung der Empirischen Untersuchung ... 63
8.2. Hypothesen ... 64
8.3. Beschreibung des Datenerhebungsinstruments ... 64
8.4. Kodierung des Datenerhebungsinstrument ... 65
8.5. Beschreibung der Stichprobe ... 68
iii
8.6. Durchführung der empirischen Studie ... 69
9. Ergebnisse ... 70
10. Diskursive Überprüfung der Hypothesen ... 76
10.1. Überprüfung von H1 ... 76
10.2. Überprüfung von H2 ... 78
10.3. Methodenkritische Betrachtung ... 78
11. Fazit und Ausblick ... 80
12. Literaturverzeichnis ... 81
iv
Abkürzungsverzeichnis
Abs. = Absatz
ABR = Akute Belastungsreaktion
ADS = Aufmerksamkeitsdefizitstörung
ADHS = Aufmerksamkeitsdefizit/-Hyperaktivitätsstörung
AGKJHG = Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes
AVT = apparative Verhaltenstherapie
BVkE = Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienst der
Erziehungshilfen e.V.
DIN EN ISO = DIN = Deutsches Institut für Normung; EN = Europäische
Normen; ISO = Internationale Organisation für Normung
DKJP = Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Psychosomatik und Psychotherapie e.V.
DSMIV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV
DSH = Deliberate Self-Harm
EFQM = European Foundation for Quality Management
EVAS = Evaluationsstudie erzieherischer Hilfen
FST = Fremde- Situations- Test
H = Hypothese
HKS = Hyperkinetische Störung
HKJGB = Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
v
ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems
JES = Jugendhilfe - Effekt- Studie
KJVO = Kinder- und Jugendeinrichtungsverordnung
KJHG = Kinder und Jugendhilfe Gesetz
LJHA = Landesjugendhilfeausschuss
LKJHG = Landesausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz
NPO = Non Profit Organisation
NSSV = Nicht- suizidale Selbstverletzung
PDCA = Plan-Do-Check-Act
PTB = Posttraumatische Belastungsstörung
QM = Qualitätsmanagement
SGBV = Sozial Gesetz Buch
SMART = Specific Measurable Accepted Realistic Timely
TQM = Total -Quality- Management
v = Variable
VwVJugHiE = Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für
Soziales für den Betrieb von Jugendhilfeeinrichtungen
WJE = Würzburger Jugendhilfe - Evaluationsstudie
ÜBBZ = Überregionales Beratungs- und Behandlungszentrum Würzburg
vi
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Qualitätsdimensionen in der Jugendhilfe ... 21
Abbildung 2: Bewertung der Wohnsituation ... 72
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Darstellung der Deskriptivstatistischen Daten des 13.Item ... 72
Tabelle 2 Darstellung der Deskriptivstatistischen Daten zum 14. und
15. Item ... 73
Tabelle 3 Darstellung der Deskriptivstatistischen Daten zum 18.Item ... 74
Tabelle 4 Darstellung der Deskriptivstatistischen Daten zum 19.Item ... 74
1
1. Einleitung
Im Bereich der freien Marktwirtschaft stehen aktiennotierte Unternehmen
dauerhaft unter dem Druck ihrer Aktionäre effizient und wirtschaftlich zu
arbeiten. Qualitätsmanagementsysteme und Evaluationsprozesse sind für
dieses Arbeitsfeld unabdingbar.
Im Bereich der sozialen Arbeit nahm Qualitätsmanagement, Ökonomisierung
und Wirtschaftlichkeit lange keine Rolle ein. Erst mit Einführung des KJHG,
SGBVIII und der darin verankerten Pflicht zur Qualitätsentwicklung wurde die
soziale Arbeit in die Verantwortung genommen, die Effektivität und Effizienz
ihrer Leistungen zu begründen. Nicht nur sozialpolitisch, auch
gesellschaftlich wurde der Wunsch lauter, resultierend aus verschiedensten
Skandalen der letzten Jahre, die Wirksamkeit der Jugendhilfemaßnahmen zu
belegen. Vor allem die stationären Jugendhilfeeinrichtungen spüren diesen
Druck.
Die Wahl effektiver Maßnahmen, im Blick auf das Individuum, sind in der
sozialen Arbeit die grundlegende Voraussetzung für eine optimale Kosten-
Nutzen-Relation. Die Sozialarbeit ist eine Klientel orientierte,
dienstleistungserbringende Maßnahme, die als oberste Direktive das Ziel
verfolgt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Doch stellt sich die Frage, was
effektive Maßnahmen sind? Wie lässt sich Effektivität messen? Wer beurteilt
die Effektivität und Effizienz solcher Maßnahmen?
Mit diesen Fragen habe ich mich, während der Vorbereitung zur Themenwahl
meiner Bachelorarbeit, beschäftigt. Um diese zu beantworten, muss zuerst
geklärt werden, wer Empfänger der Leistung ist. Sind es die Kostenträger?
Ist es die Gesellschaft, die eine gesellschaftliche Eingliederung fordert? Oder
ist es der junge Mensch selbst, der nach §1 Abs.1 SGBVIII "ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit"
1
hat. Für
mich ist klar, dass Effizienz und Effektivität vorwiegend an den Kindern und
Jugendlichen gemessen werden muss. Dafür bedarf es eines ausgereiften
Systems, der Klientel orientierten Evaluation, anhand dessen auch der
1
Nomos Gesetze (2012) S.1809
2
Anspruch der Belegbarkeit von Wirksamkeit der Maßnahmen für die
Gesellschaft und den Kostenträger erfüllt wird.
In dem empirischen Teil meiner Bachelorarbeit habe ich unter Nutzung eines
quantitativen Datenerhebungsinstruments versucht, mit Hilfe ehemaliger
Heimkinder, evaluationsrelevante Daten im Bereich der Effektivität und
Effizienz der stationären Maßnahmen zu erhalten. Im Vorfeld habe ich mich
daher im ersten Teil meiner Arbeit ausführlich mit den dafür nötigen
theoretischen Grundlagen auseinandergesetzt, um die relevanten Fragen zu
erschließen. Mir war es wichtig aufzuzeigen, mit welchen Kindern und
Jugendlichen die stationäre Jugendhilfe arbeitet, was Qualität in der
Jugendhilfe bedeutet und wie diese gesichert werden kann, welche
gesetzlichen Grundlagen für die soziale Arbeit existieren und relevant sind.
Außerdem, welche empirischen Befunde zum Thema Effektivität und
Effizienz der stationären Maßnahme nach §34 bzw. §27 ff. SGBVIII
existieren.
3
2. Theoretischer Teil
2.1. Allgemeine Einführung in die Jugendhilfe
2.1.1. Geschichte der Jugendhilfe
Bezüglich der Geschichte der Jugendhilfe, ist der mit ihr einhergehende
durchlebte Wandel der sozialen Arbeit, auf viele Faktoren zurückzuführen.
Dazu zählen ökonomische, sozialpolitische, gesellschaftliche,
wissenschaftliche, wirtschaftliche, sowie kulturelle Einflüsse. Der Grundstein
der heutigen Jugendhilfe findet sich im 13. Jahrhundert, in Form von kirchlich
geführten Findel- und Waisenhäusern oder den Armenfürsorgeeinrichtungen.
Von einer geglückten Resozialisierung und Beendigung "der Maßnahme"
sprach man damals, wenn die "Zöglinge" selbst für ihre Almosen betteln
konnten. Pädagogische Konzepte und Grundhaltungen fanden sich damals
noch nicht. Ziel dieser Einrichtungen war lediglich, die verwaisten Kinder vor
dem Tod zu bewahren. Mit Pestalozzi und Rosseau veränderte sich die Art
der Waisenhäuser grundlegend, neue Erkenntnisse in der frühkindlichen
Entwicklung und Erziehung führten zur Gründung der sogenannten Armen-
Erziehungsanstalten. Bedeutender Unterschied zu den Waisenhäusern,
deren Handeln auf Zucht und Ordnung basierte, war die bei Pestalozzi im
Mittelpunkt des Handelns stehende Liebe, auch zu verstehen als
Beziehungsarbeit. Der Begriff des Heimes, existiert erst seit Anfang des 20.
Jahrhunderts. Mit Beginn der 70er Jahre etablierte sich der familienähnliche
Charakter der Heimerziehung, der bis heute kennzeichnend für die stationäre
Jugendhilfe ist. Dieser Entwicklungsprozess wurde maßgeblich durch die
SOS-Kinderdorfbewegung und deren pädagogischen Prinzipien beeinflusst.
Die Rahmenbedingungen wurden bis zum heutigen Zeitpunkt immer weiter
differenziert und ausgebaut. Die Reformierung der heutigen Heimerziehung
wurde vor allem durch die in den letzten Jahren bekanntgewordenen
Missbrauchsfälle im Zeitraum von 1945-1970 vorangetrieben. Deutlich wird
dies vor allem in den strukturellen Bedingungen und der Qualifizierung der
Mitarbeiter. Die Tendenz zur Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen ist
aber rückläufig, seit mehreren Jahrzenten werden teilstationäre- und
ambulante Maßnahmen ausgebaut, um eine Unterbringung in Heimen zu
4
vermeiden. Einerseits aufgrund der gestiegenen Kosten und anderseits aus
pädagogischen Gesichtspunkten.
2
2.2. Allgemeine Einführung in die stationäre Jugendhilfe
Unter den nach §27 SGBVIII stationären/ familienersetzenden Hilfen zur
Erziehung versteht man nach §33,34 SGBVIII folgende Angebote der
Jugendhilfe
1. Familienorientierte Hilfe wie Pflegefamilien oder professionelle
Pflegefamilien nach §33 SGBVIII. Konzepte dieser Hilfeform können unter
anderem eine Kurzzeitpflege in Krisensituationen, Übergangspflege aufgrund
von vorübergehenden schwierigen Verhältnissen in der Herkunftsfamilie oder
Dauerpflege sein.
2. Gruppenorientierte Hilfe, wie die Heimerziehung und sonstige betreute
Wohnformen nach §34 SGBVIII. Konzeptionelle Ausrichtungen können
Wohneinheiten in Zentralheimen, dezentrale Wohngruppen, auf bestimmte
Therapieansätze spezialisierte Wohngruppen, auf Zielgruppen beschränkte
Wohngruppen oder auch familienähnliche Wohnformen sein.
Gedacht ist diese Art der Hilfe für Minderjährige, die in ihren
Herkunftsfamilien unzureichend gefördert, versorgt werden oder
Misshandlung erfahren und so eine Sicherung der Lebens- und
Entwicklungsbedingungen der Kinder- und Jugendlichen durch die
Personensorgeberechtigten nicht ausreichend gewährleistet werden können-
rechtlich begründet, wenn Eltern ihren, nach Artikel 6 des Grundgesetzes,
elterlichen Pflichten nicht mehr nachkommen. Gründe für die Aufnahme in
eine stationäre Hilfe können erhebliche Entwicklungsdefizite,
Sozialverhaltensstörungen und delinquentes Verhalten und psychische
Störungen, die zu einer Überforderung der Erziehungsberechtigten führen,
sowie körperliche- und psychische Misshandlungen sein. Im Unterschied zu
der in §32 SGVIII beschriebenen teilstationären Hilfe, findet die stationäre
2
vgl. Günder, R. (2011) S.20-38
vgl. Jordan, E.; Maykus, S.; Stuckstätte, E.C. (2012) S.25-88
5
Betreuung Tag und Nacht statt. Eine Aufnahme der Minderjährigen erfolgt
auf Grundlage des §36 SGBVIII, nur mit Zustimmung der Eltern. Die Wahl
der Hilfe findet unter Berücksichtigung des Wunsch-und Wahlrechts §5
SGBVIII statt. Ausnahme ist die akute Kindeswohlgefährdung nach §1666
BGB, bei der durch das Familiengericht die Maßnahme, der in §42 SGBVIII
geregelten sozialpädagogischen Intervention Inobhutnahme - angeordnet
wird. Inobhut kann in einer Bereitschaftspflegefamilie, einer Einrichtung eines
öffentlichen oder freien Trägers oder in einer sonstigen geeigneten
Wohnform genommen werden. Die Durchführung gehört zu den Aufgaben
des Jugendamtes, die in dem Schutzauftrag, abgeleitet aus dem Artikel 6
Abs.2 des Grundgesetzes und der Wächterfunktion §8a SGBVIII des
Jugendamtes, beschrieben werden. Die Jugendhilfe arbeitet Klientel
zentriert. Das heißt, dass neben der Arbeit am Minderjährigen, die
Elternarbeit von entscheidender Bedeutung ist. Ziel ist es, Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten um die Minderjährigen in ihre Herkunftsfamilien
zurückzuführen. Die individuelle Hilfe, auf die jeweilige Problematik
angepasst Rahmen, wird im sogenannten Hilfeplan §36 SGVIII
festgeschrieben. Auf diesen werde ich später nochmals genauer eingehen.
Eine weitere Art der Fremdunterbringung von Minderjährigen ist die
Adoption, geregelt in den §§1741 BGB. Im §50 SGBVIII.
3
2.2.1. Ziel- und Aufgabensetzung der Kinder- und Jugendhilfe
Die Ziel-und Aufgabensetzung der Kinder-und Jugendhilfe ergibt sich aus §1,
Absatz 1 SGBVIII. Die Jugendhilfe hat die Aufgabe, ein umfassendes
präventives und für akute Schwierigkeiten junger Menschen, passendes
Leistungsangebot zu schaffen, um den individuellen Entwicklungsanspruch
junger Menschen zu fördern und den Sozialisationsprozess und die
gesellschaftliche Integration zu gewährleisten. Dies soll unter
Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen stattfinden. Pluralisierte
Lebensverhältnisse sind bspw. an verschiedenartigen Wertorientierungen
und veränderteren familiäreren Lebensformen erkennbar. Um der
Verpflichtung gerecht zu werden, besteht ein vielseitiges Leistungsangebot
der Kinder- und Jugendhilfe, das sich auf Grundlage des §27 SGBVIII in
3
vgl. Jordan, E.; Maykus, S.; Stuckstätte, E.C. (2012) S.227-244 und S.189-190
6
verschiedensten Formen zeigt, unter anderem im Bereich der ambulanten
Jugendhilfe mit streetwork, sozialpädagogischer Familienhilfe, Quartiers- und
Stadtteilarbeit, in teilstationären Angeboten wie den heilpädagogischen
Tagesstätten, stationären Hilfen wie den Pflegefamilien oder Heimen oder
durch die Eingliederungshilfen wie z.B. der Frühförderung.
4
2.2.2. Rechts- und Regelungsgrundlagen der stationären Hilfen zur
Erziehung im Bundesländervergleich
Jeder kommunale Spitzenverband auf Landesebene ist verpflichtet nach §78f
SGBVIII
5
mit allen Leistungserbringern Rahmenverträge abzuschließen.
Zudem hat jedes Bundesland verschiedene Regelungsgrundlagen erarbeitet,
die ich im folgenden aufzeigen möchte.
1. In Baden- Württemberg finden sich spezifische Regelungen im
Landesausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz - LKJHG. Es
umfasst 30 Paragraphen, die Rahmenbedingungen für die stationäre
Jugendhilfe schaffen sollen.
6
2. In Bayern finden sich spezifische Regelungen in verschiedenen fachlichen
Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschuss - LJHA, wie beispielsweise
die fachlichen Empfehlungen zur Heimerziehung gemäß §34 SGBVIII
7
.
3. Berlin setzt Regelungsgrundlagen bezüglich der Bau-, Ausstattungs- und
Personalstandards.
4. Das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes -
AGKJHG im Verbund mit verschiedenen Regelungen zu Raum- und
Personalstandards sowie Kriterien für die Betriebserlaubnis stellen
differenzierte Regelungen in Brandenburg dar.
8
4
vgl. Jordan, E.; Maykus, S.; Stuckstätte, E.C. (2012) S. 19-24, vgl. Nomos Gesetze (2012)
S. 1818
5
vgl. Nomos Gesetze (2012) S.1839
6
vgl. Landesrecht BW (2005)
7
vgl. Bayerische Landesjugendamt (2014)
8
vgl. Land Brandenburg (2014)
7
4. Bremens Regelungen finden sich in den "Richtlinien für den Betrieb von
Einrichtungen und zu Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen in Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen
gemäß §§45 bis 48a SGBVIII im Lande Bremen."
9
5. In Hamburg existiert die Globalrichtlinie GR J 8/04 - Hilfe zur Erziehung,
Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe für seelische behinderte
Kinder und Jugendliche.
10
6. Für Hessen finden sich spezifische Regelungen im Hessischen Kinder-
und Jugendhilfegesetzbuch - HKJGB und in den Richtlinien für Kinder- und
Jugendheime in Hessen.
11
7. Mecklenburg- Vorpommern hat ein Gesetz zur Ausführung des Achten
Buches des Sozialgesetzbuches- Kinder- und Jugendhilfe
(Landesjugendhilfeorganisationsgesetz - KJHG-Org M-V)
12
8. In Niedersachsen wurden verschiedene Orientierungshilfen
niedergeschrieben, wie beispielsweise Hinweise für die Erteilung der
Betriebserlaubnis von Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen
nach §§45 ff SGBVIII durch das Landesamt.
13
9. Nordrhein- Westfalen hat im Landschaftsverband Rheinland spezifische
Regelungen für die Betriebserlaubnis einer Einrichtung nach §45 SGBVIII. Im
Landschaftsverband Westfalen- Lippe wurden Hinweise ausgearbeitet zu
allen relevanten Bereichen.
10. In Rheinland-Pfalz existiert ein Landesgesetz zur Ausführung des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes - AGKJHG.
14
9
Freie Hansestadt Bremen (2008) S.1
10
vgl. Freie Hansestadt Hamburg (2004)
11
vgl. Landesjugendwohlfahrtsausschluss (1982)
12
vgl. Land Mecklenburg- Vorpommern (2006)
13
vgl. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Außenstelle Hannover (2011)
14
vgl. Land Rheinland-Pfalz (1993)
8
11. Das Saarland hat die Richtlinien zur Wahrnehmung der Aufgaben zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen durch das
Landesjugendamt gemäß §§45-48a SGBVIII.
15
12. Für Sachsen gilt die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales für den Betrieb von Jugendhilfeeinrichtungen
- VwVJugHiE.
16
13. In Sachsen- Anhalt existieren Richtlinien für Hilfen zur Erziehung,
Eingliederungshilfen für behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge
Volljährige und den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege
und in Einrichtungen entsprechend dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.
17
14. Für Schleswig- Holstein gilt die Landesverordnung zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Kinder- und
Jugendeinrichtungsverordnung - KJVO.
18
15. In Thüringen existieren Fachliche Empfehlungen zur Arbeit in
stationären und teilstationären Thüringer Einrichtungen, die gemäß §§45 bis
48 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGBVIII) einer Betriebserlaubnis durch
das Landesjugendamt bedürfen.
19
2.2.3. Trägerschaften der Jugendhilfe
Der Öffentliche Träger ist verantwortlich für die gesamte Jugendhilfestruktur
und ist Anlaufstelle für die Leistungsberechtigten. Die Aufgaben der
Jugendhilfe finden sich in §2 SGBVIII. Das Jugendamt hat die Aufgabe, die
für den subjektiv Berechtigten nötige Hilfe zu gewähren und unter
Berücksichtigung des §5 SGBVIII Wunsch- und Wahlrechts, einen, dem
Bedarf angemessenen Leistungserbringer zu finden. Leistungen nach §27
SGBVIII werden vorrangig von freien Trägern erbracht. Zu den großen
Verbänden freier Träger gehören die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, der
Paritätische Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz, die
15
vgl. Land Saarland (2001)
16
vgl. Land Sachsen (2006)
17
vgl. Land Sachsen- Anhalt (1994)
18
vgl. Landesregierung Schleswig- Holstein (1994)
19
vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (1992)
9
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sowie das Diakonische
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Delegation der
Leistungen beinhaltet u.a. die, nach § 4 SGBVIII festgeschriebene
Verpflichtung der öffentlichen Jugendhilfe, mit den freien Trägern
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Nach dem Subsidaritätsprinzip,
festgehalten im zweiten Absatz des §4 SGBVIII, soll die öffentliche
Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn diese ein anerkannter
freier Träger leisten kann. Zudem soll für eine Trägervielfalt nach §3 SGBVIII
gesorgt werden und die freien Träger sind nach §4 Abs.3 SGBVIII und § 74
SGBVIII zu fördern und aktiv an Entscheidungen zu beteiligen.
Beteiligungsformen sind unter anderem, der nach §71 SGBVIII
Jugendhilfeausschuss oder die in §80 SGBVIII beschriebene
Jugendhilfeplanung. Welche Anforderungen an die freien Trägers gestellt
werden, findet sich in §75 SGBVIII. Dieser Prozess wir auch als
Dreiecksverhältnis bezeichnet zwischen Leistungsberechtigtem, dem
Jugendamt in der Vermittler- und Organisationsrolle und dem freien Träger
als Leistungserbringer. Wichtige Begriffe für die Arbeit der Jugendhilfe sind
das Subsidiaritätsprinzip, Selbstverwaltungsprinzip und das Prinzip der
Gemeinwirtschaft.
20
20
vgl. Jordan, E.; Maykus, S.; Stuckstätte, E.C. (2012) S.316-327, vgl. Nomos Gesetze
(2012) S. 1809-1840
10
3. Qualitätssicherung in der Jugendhilfe
3.1. Der Qualitätsbegriff
Von Qualität in der sozialen Arbeit spricht man, wenn die Hilfe in ihrer
strukturellen, prozessualen Beschaffenheit auf die individuellen Bedürfnisse
des Leistungsempfängers zugeschnitten ist und damit zur Verbesserung von
Auffälligkeiten und Schwierigkeiten bewusst beiträgt und vom Klienten/
Kunden als zufriedenstellend bewertet wird. Qualität ist immer subjektiv und
abhängig von der Betrachtungsweise, den Bedürfnissen, Wünschen und
Ansprüchen des Einzelnen.
Um Qualität zu erreichen, müssen die relevanten Kernprozesse einer
Einrichtung identifiziert werden. Ein Beispiel für solch einen Kernprozess in
der sozialen Arbeit ist die Beratung. Um diese beschreibar zu machen,
bedarf es folgender Elemente:
1. In der Einführungsphase sollte aufgezeigt werden, weshalb die
Bearbeitung des genannten Kernprozesses wichtig ist. Für die Beratung ist
dies, mit Blick auf den Begriff der Dienstleistung, einfach zu erklären. Zudem
sollte definiert werden, für welche Zielgruppe der Prozess gilt und welche
Erwartungen die Zielgruppe an diesen stellt.
2. Im Folgeschritt sollten mögliche erreichbare Ziele festgelegt werden. Im
Bezug auf die Beratung würde in Frage kommen, dass der Klient über seinen
gesetzlichen Anspruch, Handlungsspielraum Bescheid weiß und anhand
dessen mit dem Berater eine zielführende Lösung vereinbaren kann.
3. Als dritter Schritt, sollten die Qualitätskriterien der jeweiligen
Qualitätsdimension erarbeitet werden. In der Strukturqualität soll der Frage
nachgegangen werden, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden
müssen, um den Kernprozess erfolgreich bewältigen zu können. Im Bereich
der Prozessqualität soll der Kernprozess hinsichtlich der Qualität beleuchtet
werden. Es soll geklärt werden, was benötigt wird, um den Kernprozess
qualitätsvoll abzuarbeiten. Bei der Ergebnisqualität sollen die Indikatoren
geklärt werden, an denen die Zielerreichung messbar gemacht werden kann.
Mögliche Prozesskriterien könnten eine wertschätzende Atmosphäre sein
und die Erfassung aller relevanten Daten, sowie die Erstellung einer
11
Vereinbarung über die Lösungsschritte. Im Bereich der Strukturqualität
könnten eine qualifizierte Fachkraft und geeignete Räumlichkeiten relevante
Punkte darstellen.
4. Als letzter Bearbeitungspunkt muss eine Qualitätssicherung des
Kernprozesses sichergestellt werden.
21
Unter der klassischen Form der Qualitätssicherung in der sozialen Arbeit
versteht man Methoden wie die Konzeption, Dokumentation, Supervision,
Fort-und Weiterbildungen, Teamarbeit sowie die Kooperation mit externen
Einrichtungen.
22
Qualitätssicherungsprozesse in der Kinder- und Jugendhilfe
basieren auf Hilfeplänen, Entgelt-,Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen
und der Partizipation der Leistungsbeteiligten. Durch den zunehmenden
ökonomischen Anspruch sozialer Dienstleistungen ihre Angebote/
Leistungen und deren Ergebnisse transparenter, effektiver und effizienter zu
gestalten, im Zusammenhang mit der sozialpolitischen und gesetzlichen
Forderung nach Qualitätsmanagementsystemen, etablieren sich in
Einrichtungen der sozialen Arbeit zunehmend Qualitätsmanagement - QM
Methoden aus der freien Wirtschaft. Auf diese Entwicklung ist auch die
Zunahme von betriebswirtschaftlich- pädagogisch ausgelegten
Studiengängen, wie der des Sozialmanagers, zurückzuführen. Durch das QM
soll ganz allgemein die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen der
Kunden gesteigert werden.
23
Zur Erreichung des gesteckten Zieles der
Qualität, bedarf es unterschiedlicher Maßnahmen, sogenannten
Qualitätskriterien, die in ihrer Summe erfolgreiches QM darstellen sollen.
24
21
vgl. Meinhold, M.; Matul, C.(2001) S.18-21
22
vgl. Heindl, H.; Klessinger, N.; Knab, E.; Krettek, C.; Macsenaere, M.; Müller, A.; Patzelt,
H.; Reidel, H.; Westerbarkei, A. (2000) S.14
23
vgl. Hummel, U. (2004) S.22
24
vgl. Hummel, U. (2004) S. 38, S.22
12
3.2. Unterschied zwischen Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung
Qualitätssicherung beschreibt die Summe der Maßnahmen, die nötig sind,
um die Qualität einer Dienstleistung oder eines Produktes zu überprüfen oder
zu steigern. Der Prozess der Qualitätssicherung lässt sich am besten durch
den PDCA - Kreislauf
25
(Plan-Do-Check-Act) nach Deming erklären. Ein
Kernprozess wird in der Qualitätssicherung beschrieben und definiert (Plan),
nach der Durchführung (Do) wird dann seine Wirksamkeit bewertet (Check)
um ihn dann letztlich zu verbessern und optimieren (Act).
Unter Qualitätsmanagement versteht man die Sicherung und
Weiterentwicklung der einzelnen methodischen Konzepte und Strukturen
einer Einrichtung, die in ihrer Summe das Ziel verfolgen, die Erwartungen
und Anforderungen des Kunden zu erfüllen und die Prozesse wirtschaftlicher
und effizienter zu gestalten. Qualitätsmanagement soll mithilfe eines
mehrdimensionalen Blicks auf die Qualitätsdimensionen für eine
Beständigkeit und Verbesserung der qualitativen Standards sorgen. Die
Leistungsangebote sollen formalisiert, standardisiert, transparent und
messbar gemacht werden.
26
3.3. Effizienz und Effektivität
Unter dem Begriff der Effektivität versteht man die Wirksamkeit,
Zielbezogenheit einer Leistung. Sie kann mit einem Soll-Ist Vergleich
überprüft werden. Die Effizienz hingegen beschreibt ihre Wirtschaftlichkeit im
Kontext eines optimalen Kosten- Nutzen- Verhältnisses der Leistung. Ziel der
Effizienz ist ein "möglichst günstiges Verhältnis zwischen eingesetzten Inputs
(Ressourcen, Leistungen) und den erzielten Outputs (Ergebnisse,
Wirkungen, Zufriedenheit)."
27
Wirtschaftlich betrachtet verursachen Faktoren
aus der Prozess- und Strukturqualität Kosten, anhand derer die Effizienz
einer Leistung gemessen werden kann. Die Effektivität lässt sich anhand der
25
vgl. Hummel, U. (2004) S. 23-24
26
vgl. Meinhold, M.; Matul, C.(2001)S.29-30 , vgl. Hummel, U. (2004) S.22-23 vgl. Ross, K.
(2005) S.19
27
Meinhold, M.; Matul, C.(2001) S.58
13
Ergebnisqualität evaluieren, da durch diese Aussagen über den Nutzen der
Dienstleistung getroffen werden können.
28
3.4. Nutzen des Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen
Ökonomisierung, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, all das sind
Begriffe, die in den letzen Jahren für einen Wandel in der sozialen Arbeit
gesorgt haben. Non-Profit Einrichtungen müssen zunehmend
betriebswirtschaftlich denken und handeln, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Der Wettbewerbsdruck untereinander nimmt zu. Durch verringerte
Ressourcen wächst die Gefahr eines
Qualitätsverlustes. Aufgrund dessen
gewinnt das Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen an
zunehmender Bedeutung.
Die Vorteile von Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen zeigen sich
vor allem in der daraus resultierenden Transparenz für die soziale Arbeit.
Soziale Einrichtungen sind Dienstleistungsunternehmen, das heißt der
Kunde, Klient, Leistungsempfänger steht im Mittelpunkt des Handelns.
Qualitätsmanagement prüft und verbessert die Schnittstellen sozialer
Einrichtungen, optimiert Prozesse und Abläufe und führt somit zu einer
Qualitätssteigerung.
QM sorgt dafür, das Prozesse messbar und überprüfbar gemacht werden
und kann dadurch klare Fakten hervorbringen, die Interventionen
rechtfertigen und den gesellschaftlichen und politischen Druck mindern
können.
Die Wichtigkeit eines QM-Systems zeigt sich auch im Bereich der
Ehrenamtlichen. Durch die schwindenden Personalressourcen, Probleme mit
Reputation, Innovationsfähigkeit und Identität von gemeinnützigen
Organisationen, ist freiwilliges Engagement unverzichtbar. Da diese
Personen im Regelfall keine Profession in diesem Arbeitsfeld erlangt haben,
hat Freiwilligenmanagement als Teil des Qualitätsmanagement die Aufgabe
Qualität, Effektivität und Effizienz trotzdem aufrecht zu erhalten und zu
sichern. Der QM- Gedanke im Bereich des Freiwilligenmanagement zeigt
28
vgl. Ross, K. (2005) S.19, Meinhold, M.; Matul, C.(2001) S.57-59
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783956365669
- ISBN (Paperback)
- 9783956369100
- Dateigröße
- 606 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, früher: Berufsakademie Heidenheim – Sozialwesen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- Heimarbeit Jugendhilfe Wirksamkeit Stationäre Jugendhilfe Effektivität Effizienz Soziale Arbeit Würzburger Jugendhilfe Evaluationsstudie Empirische Studie
- Produktsicherheit
- Diplom.de