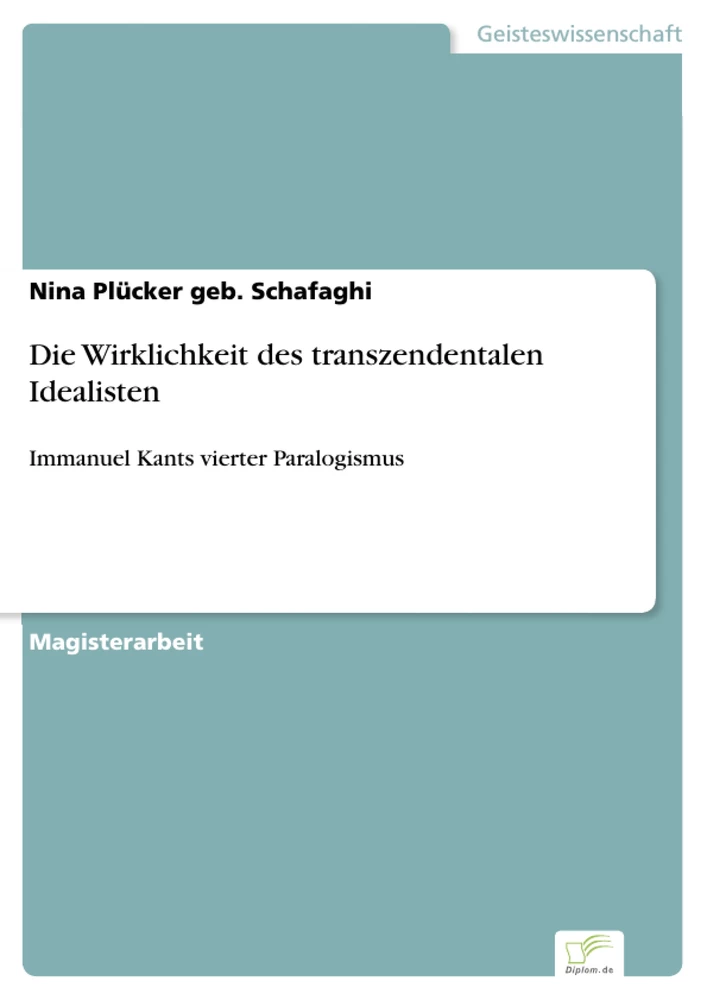Die Wirklichkeit des transzendentalen Idealisten
Immanuel Kants vierter Paralogismus
©2011
Magisterarbeit
58 Seiten
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem vierten Paralogismus der kantischen Schrift Kritik der reinen Vernunft aus dem Jahre 1781. In diesem vierten Abschnitt der kritischen Auseinandersetzung mit der rationalen Psychologie behandelt Kant die Aussagen Descartes, die in ihrer Konsequenz zum Außenweltskeptizismus führen. Ziel dieser detaillierten Betrachtung ist die Widerlegung des skeptisch empirischen Idealismus Descartes, der zwar der Wahrnehmung innerer Prozesse Unmittelbarkeit zuweist, die Wahrnehmung äußerer Prozesse aber als mittelbar beschreibt. Dazu entwickelt Kant eine dualistische Theorie, nach der die äußeren Erscheinungen Bestandteil des Bewusstseins sind und die unmittelbare Wahrnehmung empirischer Wirklichkeit darstellen. Dahingehend stellt sich nun die Frage, ob Kants Lösung zur Skeptizismus-Problematik auch eine angemessene Reaktion auf die Inhalte Descartes darbietet. Als Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll diese Fragestellung im Verlauf der anstehenden Untersuchung an Hand einer Gegenüberstellung der beiden Theorien sowie der Ausführung beider Argumentationsstränge behandelt werden.
Allerdings veröffentlichte Kant sein Werk sechs Jahre nach Erscheinen dieser Buchausführung in einer überarbeiteten Form neu, wobei er den Abschnitt der Paralogismen verkürzte und die darin enthaltene Widerlegung des Idealismus vorverlegte. Die diesbezüglich entstandenen Unterschiede der ersten und zweiten Auflage werden im Anschluss an die formale Betrachtung des vierten Paralogismus und die Darlegung seiner inhaltlichen Struktur näher erläutert. Doch zuvor erörtert die thematische Einführung die Bedeutung der Paralogismen im Kontext zur gesamten Schrift.
[...]
Allerdings veröffentlichte Kant sein Werk sechs Jahre nach Erscheinen dieser Buchausführung in einer überarbeiteten Form neu, wobei er den Abschnitt der Paralogismen verkürzte und die darin enthaltene Widerlegung des Idealismus vorverlegte. Die diesbezüglich entstandenen Unterschiede der ersten und zweiten Auflage werden im Anschluss an die formale Betrachtung des vierten Paralogismus und die Darlegung seiner inhaltlichen Struktur näher erläutert. Doch zuvor erörtert die thematische Einführung die Bedeutung der Paralogismen im Kontext zur gesamten Schrift.
[...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem vierten Paralogismus der kantischen
Schrift Kritik der reinen Vernunft aus dem Jahre 1781. In diesem vierten Abschnitt
der kritischen Auseinandersetzung mit der rationalen Psychologie behandelt Kant die
Aussagen Descartes, die in ihrer Konsequenz zum Außenweltskeptizismus führen.
Ziel dieser detaillierten Betrachtung ist die Widerlegung des skeptisch empirischen
Idealismus Descartes, der zwar der Wahrnehmung innerer Prozesse Unmittelbarkeit
zuweist, die Wahrnehmung äußerer Prozesse aber als mittelbar beschreibt. Dazu
entwickelt Kant eine dualistische Theorie, nach der die äußeren Erscheinungen
Bestandteil des Bewusstseins sind und die unmittelbare Wahrnehmung empirischer
Wirklichkeit darstellen. Dahingehend stellt sich nun die Frage, ob Kants Lösung zur
Skeptizismus-Problematik auch eine angemessene Reaktion auf die Inhalte
Descartes darbietet. Als Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll diese Fragestellung
im Verlauf der anstehenden Untersuchung an Hand einer Gegenüberstellung der
beiden Theorien sowie der Ausführung beider Argumentationsstränge behandelt
werden.
Allerdings veröffentlichte Kant sein Werk sechs Jahre nach Erscheinen dieser
Buchausführung in einer überarbeiteten Form neu, wobei er den Abschnitt der
Paralogismen verkürzte und die darin enthaltene Widerlegung des Idealismus
vorverlegte. Die diesbezüglich entstandenen Unterschiede der ersten und zweiten
Auflage werden im Anschluss an die formale Betrachtung des vierten Paralogismus
und die Darlegung seiner inhaltlichen Struktur näher erläutert. Doch zuvor erörtert die
thematische Einführung die Bedeutung der Paralogismen im Kontext zur gesamten
Schrift.
Bei der hier ausgewählten Primärliteratur Kritik der reinen Vernunft handelt es sich
um eine transzendentalphilosophische Erkenntnistheorie, da Kant sich mit den
Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis auseinandersetzt, die in der
Beschaffenheit des Erkenntnissubjektes dem Menschen - zu suchen sind. Das Ziel
dieser Schrift ist es, die Erkenntnisgrenzen an Hand einer Analyse der möglichen
Methoden herauszuarbeiten. Damit behandelt die Arbeit zugleich die erste der vier
kantischen Fragen in seinem System der kritischen Philosophie: Was kann ich
wissen? Die drei darauffolgenden Fragen, die in seinen weiteren Arbeiten
2
3
beantwortet werden, lauten: Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der
Mensch? In ihrer Gesamtheit stellen sie die Themenbereiche der Philosophie dar.
Für Kant ist Erkenntnis die notwendige Folge von Urteilen, sodass er die
Erkenntnisfähigkeit mit dem Urteilsvermögen gleichsetzt. Als Urteil definiert er Sätze,
die den Verstehensprozess einleiten, indem sie einem Subjekt ein Prädikat
hinzufügen. Diesbezüglich wird zunächst zwischen analytischen und synthetischen
Urteilen differenziert. Während das hinzugefügte Prädikat des analytischen Urteils
bereits im Subjektbegriff enthalten ist, fügen synthetische Urteile dem Subjekt ein
Prädikat hinzu, welches zuvor nicht in dem Begriff enthalten war und bieten damit
eine tatsächlich neue Erkenntnis im Sinne einer Wissensergänzung. Diese
Erweiterungsurteile werden wiederum in die reine und empirische Erkenntnis
unterteilt, wobei die empirische Erkenntnis, welche sich in synthetischen Urteilen a
posteriori ausdrückt, als zweifellos möglich anerkannt wird. Die Begründung liegt in
der kantischen Interpretation von Erfahrung, wonach sie das Fundament der
Erkenntnis bildet: ,,Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist
gar kein Zweifel; [...]"
1
Kants kritische Untersuchung hat daher die Möglichkeit von synthetischen Urteilen a
priori zum Gegenstand, über welche die Metaphysik ihre Antworten ergründet. Auf
Grund dieser eingehenden Auseinandersetzung mit der Metaphysik, in der Kant ihre
Vorgehensweisen und Ziele kritisch untersucht, um sie schließlich in eingegrenzter
Form als Wissenschaft zu legitimieren, handelt es sich bei der Kritik der reinen
Vernunft neben dem erkenntnistheoretischen Aspekt außerdem um eine
wissenschaftstheoretische Erörterung. In diesem Zusammenhang verfasst Kant in
der ersten Auflage seines Werkes - im Rahmen der transzendentalen Dialektik, die
auf das entsprechende Traktat über die Analytik folgt und somit die zweite Abteilung
der transzendentalen Logik darstellt - die vier Paralogismen der reinen Vernunft.
Diese sogenannten Fehlschlüsse beziehen sich auf die Lehren der rationalen
Psychologie, die Kant in Folge seiner Kritik als Scheinwissenschaft entlarvt. Nun
zählt die rationale Psychologie zur klassischen Ontologie und darin zur speziellen
Metaphysik, sodass Kant mit seiner Kritik an ihrer Lehre eben diesen klassischen
Bereich der Metaphysik als nicht wissenschaftlich deklariert.
1
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B 1.
Die vier Paralogismen sind als erstes von drei Hauptstücken in dem zweiten Buch
der transzendentalen Dialektik untergebracht, welches sich ,,Von den dialektischen
Schlüssen der reinen Vernunft"
2
nennt. Die Überschrift verrät bereits, dass es sich
bei diesem Abschnitt um Schlussfolgerungen der reinen Vernunft handelt, die sich
lediglich auf die formale Logik stützten, die Kant als ,,Logik des Scheins"
3
degradiert.
Kants Ausführungen zufolge sind dialektische Schlüsse dieser Art aus zwei Gründen
erkenntnistheoretisch unbrauchbar: zum einen verhindern sie durch ihren
analytischen Charakter eine zusätzliche Wissenserweiterung und zum anderen
verkennen sie die Grenzen der Vernunft, indem sie diese über den Rahmen ihres
natürlichen Gebrauchs hinaus anwenden. Bereits im Vorfeld der eigentlichen
Auseinandersetzung erläutert Kant, dass es sich bei der zweiten Abteilung der Logik
um eine Kritik dieser dialektischen Erschließung von Verstand und Vernunft handelt,
welche die Täuschung hinsichtlich der scheinbaren Erweiterungsurteile aufzeigen
soll.
4
Die Kritik basiert auf der Unterscheidung von Erkenntnissen, wie sie die
empirischen Erweiterungsurteile liefern, und Aussagen, die zwar in der Natur der
Vernunft liegen aber nur zu Scheinerkenntnissen führen, da ihre reale Möglichkeit
umstritten bleibt.
Die transzendentalen Ideen, wie Kant sie nennt, resultieren aus der Fähigkeit der
Vernunft, Schlüsse zu ziehen und repräsentieren in ihrer Vollendung das
Unbedingte, das sich aus der Synthesis bedingter Erkenntnisse ergibt. Diese
begrenzten Erkenntnisse entspringen dem Verstand, bei dem Vorgang an Hand von
Begriffen klare Vorstellungen aus der sinnlichen Wahrnehmung zu bilden. In ihrem
Streben nach Totalität vervollständigt die Vernunft schließlich die Urteile, die sich aus
den reinen Verstandesbegriffen ergeben, indem sie daraus synthetische Erkenntnis
bildet und gelangt auf diese Weise zu den Ideen, die den Erkenntnissen des
Verstandes Einheit gewähren. Folglich kann die Vernunft als das Vermögen
beschrieben werden, dass mittels Prinzipien die Einheit der Verstandesregeln schafft,
während der Verstand mittels Regeln die Einheit der Erscheinungen schafft.
5
Nun kann diesen Begriffen der Vernunft, anders als bei denen des Verstandes,
weder eine reine, noch eine empirische Anschauung zugeordnet werden. Das
begründet auch die Tatsache, dass ihnen niemals objektive Erkenntnis zugestanden
2
Ebd., B 396.
3
Ebd., B 86.
4
Vgl. ebd., B 88.
5
Vgl. ebd., B 359.
4
5
wird. Folglich lassen sich die Ideen der reinen Vernunft, die das Unbedingte in der
Reihe der Bedingungen darstellen, in ihrer möglichen Existenz nicht beweisen, weil
ihnen kein Gegenstand in der räumlichen Anschauung korrespondiert.
6
Mit dieser
Feststellung verneint Kant aber auch generell die Möglichkeit, ausschließlich an
Hand von Kategorien Erweiterungsurteile zu bilden und setzt demgemäß die
Anschauung der Erkenntnis voraus. Die Rechtfertigung dieser These begründet
seine Definition von Kategorien, nach der sie bloße Gedankenformen sind. Diesen
reinen Verstandesbegriffen wird erst dann objektive Realität zuteil, wenn ihnen ein
entsprechendes Objekt in der Erfahrung gegeben ist. Somit ist die Anschauung,
durch die ein Objekt vorgestellt wird, ein gleichwertiger und vor allem notwendiger
Aspekt der Erkenntnis, neben dem Verstand. In der Konsequenz lässt sich
zusammenfassen, dass Erkenntnis in Form eines synthetischen Urteils aus der
Kombination von Anschauung und Begriff resultiert. Dabei stellen Raum und Zeit die
Formen der Sinnlichkeit dar, während die Kategorien die Formen des Denkens
beschreiben. Nur im Zusammenspiel dieser beiden Aspekte ist die Möglichkeit eines
Erweiterungsurteils gegeben.
7
Allerdings bestätigen die Ideen des absoluten Ganzen hinsichtlich aller möglichen
Erfahrung die Logik des Denkens durch ihre systematische Erschließung und zeigen
ihre Relevanz als notwendige Vorstellungen im praktischen Gebrauch der Vernunft,
indem sie dem Verstand als regulative Prinzipien dienen.
8
Durch die Differenzierung
zwischen der Notwendigkeit einer Idee und der Möglichkeit ihrer Entität, weist Kant
auch zugleich auf die eigentliche Problematik bezüglich dieser Begriffe der reinen
Vernunft hin, die darin besteht, dass ihnen - seitens der spekulativen Metaphysik -
reale Existenz zugesprochen wird, obwohl ihnen kein Objekt der Erfahrung
entspricht.
Die im Rahmen der kantischen Untersuchung erörterten Ideen der reinen Vernunft
beschreiben die drei Themengebiete der speziellen Metaphysik, die sich mit Fragen
der Psychologie, Kosmologie und der Theodizee - der Rechtfertigung Gottes -
auseinandersetzten. Die Metaphysik versucht sich dieser Bereiche ausschließlich
über die Vernunft bewusst zu werden und stellt den diesbezüglich existierenden,
empirischen Wissenschaften die entsprechenden rationalen Lehren entgegen. Das
6
Vgl. ebd., B 365.
7
Vgl. ebd., B 288.
8
Vgl. ebd., B 672.
Resultat der vermeintlichen Wissenschaften ist die konstitutive Auffassung der Ideen
von Seele, Welt und Gott, welche Kant in den drei Hauptstücken des zweiten Buches
behandelt, das oben bereits namentlich erwähnt und in der transzendentalen
Dialektik untergebracht ist.
Kant unterscheidet hinsichtlich der drei Hauptstücke zwischen drei verschiedenen
Formen von Vernunftschlüssen, die der Kategorie der Relation angehören und damit
das Verhältnis der Urteile zueinander bestimmen: die kategorischen, die
hypothetischen und letztlich die disjunktiven Schlüsse der reinen Vernunft. Mittels
dieser logischen Formen schließt die Vernunft auf ihr Erkenntnissystem der
transzendentalen Ideen, indem sie von der Selbsterkenntnis über die Welterkenntnis
zur Erkenntnis Gottes aufsteigt.
9
Dabei ordnet Kant in seiner systematischen
Gliederung die kategorische Art zu schließen als die erste Klasse von dialektischen
Schlüssen ein, denen sich die rationale Psychologie, bei dem Versuch, Erkenntnis
über die Seele zu erlangen, bedient. Auf Grund des transzendentalen Fehlers, den
diese Syllogismen beinhalten, bezeichnet Kant sie als transzendentale
Paralogismen. Die hypothetische Form von Vernunftschlüssen klassifiziert er an
zweiter Stelle und nennt sie wegen der Widersprüche, die sich bei dem Versuch
ergeben, aus der reinen Vernunft Wissen über das Weltganze zu erlangen, ,,Die
Antinomie der reinen Vernunft"
10
. Die dritte Klasse überschreibt Kant schließlich mit
dem ,,Ideal der reinen Vernunft"
11
, da die Konsequenz dieser disjunktiven
Syllogismen die Vorstellung eines alles bedingenden Urwesens ist.
12
Als die erste Klasse der soeben aufgeführten Triade ergründet die rationale
Psychologie das Wesen der Seele über die Synthesis der kategorischen
Vernunftschlüsse, die Kant als Paralogismen der reinen Vernunft bezeichnet. Grund
für seine Kritik ist die Objektivierung des bloßen Bewusstseinsausdrucks Ich denke,
das die Grundlage der rationalen Seelenlehre bildet und nach Kant zwar alle
Gedanken begleitet, aber selbst nicht Objekt der Selbstanschauung sein kann.
Zudem handelt es sich bei dieser Grundlage der rationalen Psychologie, die den
Anspruch erhebt, eine reine Wissenschaft zu sein, indem sie von allem Empirischen
abstrahiert, um eine innere Erfahrung. Diesen Umstand rechtfertigt Kant allerdings,
9
Vgl. ebd., B 394.
10
Ebd., A 405.
11
Ebd., B 595.
12
Vgl. ebd., B 398.
6
7
indem er darauf hinweist, dass es sich bei diesem Ausdruck nicht um eine
empirische Erkenntnis handelt, sondern um die Bedingung der Möglichkeit jeder
Erfahrung, die wiederum transzendental ist.
13
Während die Transzendentalphilosophie Kants nun den Ausdruck der inneren
Wahrnehmung rein formal als die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins
auffasst, die das Mannigfaltige einer Anschauung unter die synthetische Einheit der
Apperzeption bringt, objektiviert die rationale Seelenlehre die Vorstellung des
denkenden Selbst und schreibt dem angeblichen Verstandesbegriff an Hand von
Paralogismen Eigenschaften zu, deren reale Möglichkeit umstritten bleibt. Diesen
Vorgang kritisiert Kant als Hypostasierung der Gedanken.
14
Seiner Erkenntnistheorie
entsprechend ist die äußere Anschauung Voraussetzung der objektiven Realität.
15
Folglich liegt der Grund für das Scheitern der rationalen Psychologie darin, dass sie
dem Subjekt der Vorstellung Ich denke objektive Realität zuspricht, ohne eine
beharrliche Anschauung davon vorzuweisen. Auf dieser Grundlage schließt sie
schließlich, unter Anwendung der Urteilskategorien, in Paralogismen auf die
Eigenschaften dieses transzendentalen Subjekts und gelangt auf diese Weise zu der
unbedingten Vorstellung der unsterblichen Seele, die Kant als transzendentalen
Schein negiert und nur im Sinne einer regulativen Idee zulässt.
Bei der Erschließung der Idee gelangt die rationale Seelenlehre, unter Abänderung
der Reihenfolge über die Kategorie der Relation, zu der scheinbaren Erkenntnis,
dass die Seele eine denkende Substanz ist und ebnet damit die Grundlage aller
weiteren dialektischen Schlüsse. Es folgen die Urteilskategorien der Qualität,
Quantität und Modalität, die jeweils auf den Substanzbegriff der Seele angewandt
werden und auf diese Weise folgende Scheinerkenntnisse herleiten: die Seele ,,[...]
sei Substanz, der Qualität nach einfach, numerisch identisch sowie Gegenstand des
Verhältnisses zu nur möglichen Objekten im Raum."
16
Aus dieser Topik, wie Kant die
vier kategorisch erschlossenen Scheinerkenntnisse zusammenfasst, leitet die
rationale Seelenlehre alle ihre Begriffe ab, die schließlich zu der Annahme führen,
die Seele sei unsterblich.
17
13
Vgl. ebd., B 401.
14
Vgl. ebd., A 395.
15
Vgl. ebd., B 291.
16
Heidemann, Dietmar Hermann: Kant und das Problem des metaphysischen Idealismus, S. 50.
17
Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B 402.
Die Gemeinsamkeit der Paralogismen liegt wie oben bereits beschrieben darin, dass
mit keinem der Ergebnisse der jeweils vier Paralogismen wirkliche Erkenntnis
vorliegt, da die rationale Psychologie den Fehler begeht, von den Bedingungen der
Möglichkeit des denkenden Subjektes auf dessen unbedingte Existenz zu schließen,
womit der Bewusstseinsausdruck Ich denke objektiviert und als eigenständige,
denkende Substanz vom Körper separiert wird. Die darauf folgenden Schlüsse
knüpfen an diese Vorstellung an und scheitern notwendigerweise.
Allerdings existiert auch ein erheblicher Unterschied zwischen dem vierten
Paralogismus, der dieser Arbeit zu Grunde liegt, und den übrigen Fehlschlüssen.
Während die ersten Paralogismen die Seele als vom Körper unabhängige denkende
Substanz manifestieren sollen, stellt der Paralogismus der Modalität auf Grund der
Unsicherheit bezüglich der Existenz räumlicher Erscheinungen das Verhältnis der
Seele zu Körpern im Raum in Frage.
18
Wegen der ungewissen Existenz äußerer Erscheinungen repräsentiert dieser letzte
von vier Paralogismen den skeptischen Idealismus Descartes, der nur die Existenz
der denkenden Substanz für absolut gewiss hält. Nach dieser Theorie ist die Seele
als das erkennende Bewusstsein der unmittelbare Gegenstand ihrer selbst und
bedarf zur Wahrnehmung äußerer Gegenstände die Vermittlung der Sinne. Diese
bilden dann die transzendentale Realität unverändert in Vorstellungen ab, sodass in
Hinblick auf die Wahrnehmungsinhalte von Projektionen der Wirklichkeit gesprochen
werden kann.
19
Weil Descartes mit dieser Auffassung aber einzig der Wahrnehmung
von Gedanken und Vorstellungen Unmittelbarkeit zuschreibt, bleibt die Existenz des
der inneren Wahrnehmung korrespondierenden äußeren Gegenstandes unsicher. In
der Konsequenz wirft der mittelbare Charakter äußerer Erfahrung die Frage nach
dem Wirklichkeitsgehalt des Erlebten auf, weil unklar bleibt, ob die Vorstellungen
lediglich Erzeugnisse der Einbildungskraft oder tatsächlich Abbilder der Realität sind.
Mit der Kritik am vierten Paralogismus widmet sich Kant der soeben beschriebenen
Problematik und versucht, ihr eine Lösung entgegenzuhalten. Dabei setzt er sich das
Ziel den skeptischen Idealismus Descartes zu widerlegen, wozu er auf Grundlage der
transzendentalen Ästhetik die Theorie des transzendentalen Idealisten und
empirischen Realisten entwickelt. Diese Theorie wird im weiteren Verlauf näher
erläutert, um dann schließlich zu sehen, inwieweit sie eine Antwort auf die
18
Heidemann, Dietmar Hermann: Kant und das Problem des metaphysischen Idealismus, S. 53.
19
Vgl. de Oliveira Farias, Vanderlei: Kants Realismus und der Außenweltskeptizismus, S. 86 f.
8
9
Problematik Descartes darstellt. Zur Klärung dieser Frage dient dabei eine
Gegenüberstellung beider Theorien, die durch ein ausführliches Kapitel zu Descartes
eingeleitet wird.
Zum Abschluss behandelt die vorliegende Arbeit dann die Auswirkungen der
kantischen Theorie auf den Wirklichkeitsgedanken. Dabei werden die Konsequenzen
untersucht, die sich durch die Annahme der empirischen Wirklichkeit für den
Menschen ergeben. Doch zuvor setzt sich das anstehende Kapitel mit der formalen
und inhaltlichen Struktur des vierten Paralogismus auseinander und gibt auf diese
Weise einen zusammenfassenden Einblick in die Thematik des besagten
Abschnittes.
1. 1 Aufbau und Inhalt des vierten Paralogismus
Aus der Einführung wurde bereits ersichtlich, dass Kant sich in diesem vierten
Abschnitt der Kritik an der rationalen Seelenmetaphysik mit den epistemologischen
Prinzipien Descartes auseinandersetzt, die nach kantischer Einschätzung zum
Außenweltskeptizismus führen. Seiner Ausführung zufolge beinhaltet die
idealistische Erkenntnistheorie Descartes einen Denkfehler, der es Kant erlaubt, die
Theorie in einem Paralogismus darzustellen. Dabei bildet der berühmte Grundsatz
der cartesischen Philosophie Cogito ergo sum die Grundlage des Fehlschlusses, in
dessen Konsequenz das Dasein aller Gegenstände äußerer Sinne angezweifelt wird.
Bevor dieser nun inhaltlich dargelegt und an Hand der kantischen Kritik näher
betrachtet wird, folgt eine formale Analyse dieses vierten Paralogismus, der die
Idealität des äußeren Verhältnisses zum Thema hat. Zum besseren Verständnis
dieser Betrachtung wird aber zunächst definiert, was genau unter einem
Paralogismus zu verstehen ist, um anschließend die ihn kennzeichnenden Kriterien
zu klären.
Ein Paralogismus liegt bei einem Verstoß gegen die Regeln des entsprechenden
Syllogismus vor und repräsentiert somit eine Fehler beinhaltende Schlussfolge.
Kants Ausführungen zufolge ist die Vernunft das Vermögen, Schlüsse zu ziehen,
indem sie eine Erkenntnis aus einem Prinzip ableitet.
20
Dieser Vorgang lässt sich
wie folgt zusammenfassen: Nachdem die Urteilskraft eine Erkenntnis unter die
Bedingung der im Obersatz gegebenen Regel des Verstandes subsumiert, ist es der
Vernunft möglich, den daraus resultierenden Untersatz durch das Prädikat der
allgemeinen Regel im Obersatz apriorisch zu bestimmen.
21
Folglich bilden der Ober-
und Untersatz die beiden Prämissen, aus denen die Vernunft die Konklusion folgert.
Der Vernunftschluss setzt sich also aus drei Urteilen zusammen, von denen das
dritte die Konklusion darstellt, die über ein Zwischenurteil aus dem Prinzip abgeleitet
wird. Liegt kein Fehler in der Schlussfolge vor, kann die aus dem Prinzip der
allgemeinen Regel abgeleitete Erkenntnis auch als die Konsequenz der
vorangegangenen Prämissen bezeichnet werden.
Da die Form des Vernunftschlusses stets von der Relationsart der ersten Prämisse
abhängt, handelt es sich in Bezug auf den hier erörterten vierten Abschnitt der
20
Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, B 357.
21
Vgl. ebd., A 304.
10
11
kritischen Auseinandersetzung mit der rationalen Seelenlehre auf Grund des
kategorischen Urteils, das den Obersatz beschreibt, um einen Syllogismus
kategorischer Art. Dieser unterliegt nun verschiedenen Regeln, von denen eine die
Qualität der Urteile betrifft und besagt, dass die Prämissen nicht beide verneinend
sein dürfen. Eine weitere Vorgabe betrifft die Quantität und untersagt die Aufstellung
von zwei besonderen Urteilen.
22
Diesen Vorgaben entsprechend besteht die erste
Prämisse des vierten Paralogismus aus einem allgemeinen und bejahenden Urteil
und wird von der ebenfalls allgemeinen und bejahenden zweiten Prämisse gefolgt.
23
Diesen Kriterien zufolge macht der vorliegende Schluss nun den Anschein, den
formalen Anforderungen des kategorischen Syllogismus zu entsprechen. Aber das
Bestehen einer weiteren Regel, der er nach kantischer Ausarbeitung nicht gerecht
wird, begründet schließlich, dass dieser ihn als Paralogismus bezeichnet. Nach
dieser Regel darf der Syllogismus kategorischer Art exakt drei Hauptbegriffe
umfassen. Diesbezüglich repräsentiert der Mittelbegriff das Subjekt dieses
vorangestellten Urteils und bildet gemeinsam mit dem Obergriff, der das Prädikat
repräsentiert, die erste Prämisse. Darauf folgt die zweite Prämisse, in welcher der
Unterbegriff das Subjekt dieses nachfolgenden Urteils darstellt, das von dem
Mittelbegriff, der jetzt in der Position des Prädikates ist, ergänzt wird. Über diese
vermittelnde Instanz gelingt es der Vernunft schließlich, das Subjekt des Untersatzes
mit dem Prädikat des Obersatzes logisch zu verknüpfen und auf diese Weise die
Konklusion zu erzeugen.
Im kategorischen Syllogismus müssen also genau drei verschiedene Begriffe jeweils
zweimal vorkommen, um entsprechend in Relation miteinander gesetzt zu werden.
24
Sobald diese Anzahl durch die Verwendung eines mehrdeutigen Begriffs
überschritten wird, liegt ein Verstoß gegen die Regel und damit ein Fehler in der
Schlussfolge vor. Dieser Fehler nennt sich Quaternio Terminorum, da der auf drei
Hauptbegriffe begrenzte Syllogismus durch die doppeldeutige Verwendung einer
dieser Begriffe sinngemäß um einen weiteren ergänzt wird. In der Konsequenz
dieses Vergehens erzeugt die Schlussfolge eine falsche Aussage und kann
entsprechend als Paralogismus bezeichnet werden.
25
22
http://www.schuledialektik.de/schluss.htm
23
Vgl. Kalter, Alfons: Kants vierter Paralogismus, S. 139.
24
van Orman Quine, Willard: Grundzüge der Logik, S. 109.
25
Vgl. Kalter, Alfons: Kants vierter Paralogismus, S. 140.
Eben diese Missachtung führt nach Kant zu dem vierten Paralogismus der rationalen
Seelenlehre, in dem die Verwendung eines äquivoken Begriffs Ursache für die
fehlerhafte Schlussfolge ist. Die Äquivokation lässt sich jedoch nur aus Sicht der
transzendentalen Logik nachvollziehen, sodass der Grund für die falsche Konklusion
ein transzendentaler ist. Demgemäß bezeichnet Kant den Fehlschluss als
transzendentalen Paralogismus und unterscheidet ihn vom Logischen.
26
Bevor der Fehler in der Schlussfolge nun an Hand der kantischen Kritik eingehend
untersucht wird, erfolgt erst einmal die inhaltliche Darlegung des transzendentalen
Paralogismus.
Zu Beginn stellt die erste Prämisse dieses letzten Paralogismus fest, dass es sich um
eine fragwürdige Existenz handelt, wenn auf das Dasein der Dinge nur geschlossen
werden kann, indem es als Ursache der gegebenen Vorstellungen angenommen
wird. Auf diese Voraussetzung sagt der Untersatz dann aus, dass es sich bezüglich
allen äußeren Erscheinungen auf die beschriebene Weise verhält, da ihr Dasein
ebenfalls nur über die wahrgenommene Wirkung der tatsächlichen Ursache
geschlossen wird. Schließlich wird aus diesen beiden Bedingungen in der
Schlussfolge abgeleitet, dass die Existenz aller Objekte äußerer Sinne zweifelhaft ist.
Mit der Annahme, dass das Äußere nicht in der Wahrnehmung gegeben, sondern nur
zu dieser hinzu gedacht werden kann, impliziert der vierte Paralogismus, dass nur
der Wahrnehmung innerer Prozesse Unmittelbarkeit zukommt und entspricht damit
der Erkenntnistheorie Descartes, der zufolge lediglich das denkende Selbst samt
seiner Vorstellungen der unmittelbare Gegenstand seiner eigenen Wahrnehmung ist.
Während Descartes sich nun der Außenwelt vergewissert, indem er den Schluss von
gegebenen Vorstellungen auf äußere Dinge durch den Beweis Gottes für zulässig
erklärt, spricht Kant einem solchen Schluss jegliche Sicherheit ab, weil er die
Möglichkeit einräumt, dass die Wirkung aus verschiedenen Ursachen entstanden
ist.
27
Seiner Ansicht nach führen die Voraussetzungen Descartes unweigerlich zum
Außenweltskeptizismus, sodass er dessen Theorie als Idealismus bezeichnet. Dieser
skeptische Idealist räumt die Existenz äußerer Erscheinungen zwar ein, verneint aber
die Möglichkeit, ihr Dasein durch unmittelbare Wahrnehmung erkennen zu können. In
26
Vgl. ebd., B 399
27
Vgl. ebd., A 368
12
13
der Konsequenz bleibt die Wirklichkeit der Objekte äußerer Sinne in der Theorie
Descartes ungewiss.
28
Weil nun die vorliegende Schlussfolge eben diesen skeptischen Idealismus
Descartes repräsentiert, muss Kant zur Widerlegung der Lehre belegen, dass es sich
dabei um einen Fehlschluss handelt. Gelingt es ihm schließlich den vermeintlichen
Syllogismus als Trugschluss zu entlarven, widerlegt er dadurch auch den
cartesischen Idealismus.
Nach Kant besteht der Fehler des Vernunftschlusses in der Annahme der zweiten
Prämisse, nach der die unmittelbare Wahrnehmung des Daseins äußerer
Erscheinungen ausgeschlossen ist. Grund für die falsche Aussage des Untersatzes
ist die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks außer uns, der sowohl transzendental als
auch empirisch verwendet werden kann.
29
Während der problematische Idealist die
Existenz der Erscheinungen auf Grund des transzendentalen Begriffsgebrauchs
außerhalb des Bewusstseins ansetzt, sodass nur über die Vermutung dieser
sinnunabhängigen Realität als Ursache der gegebenen Vorstellungen ihr Dasein
geschlossen werden kann, erklärt Kant mit Bezug auf die Ergebnisse seiner
transzendentalen Ästhetik, dass der Ausdruck in Verbindung mit den Erscheinungen
zwingend empirisch verstanden werden muss. In der Konsequenz der empirischen
Interpretation erweist sich der Untersatz als falsch und muss durch die Annahme der
unmittelbaren Existenzwahrnehmung äußerer Erscheinungen korrigiert werden.
Denn durch das empirische Begriffsverständnis wird das Dasein äußerer
Erscheinungen im Raum und damit im Bewusstsein angenommen. Grund dafür bildet
die Annahme, dass der Raum als Form des äußeren Sinns Bestandteil des Gemütes
ist, wodurch das in ihm Erscheinende ebenfalls nur als Vorstellung im Bewusstsein
existiert.
Erst die inhaltliche Korrektur der zweiten Prämisse erlaubt es Kant schließlich, die
Schlussfolge als Paralogismus zu bezeichnen, da die Berichtigung der Minor dazu
führt, dass in der Major die Kategorie der Modalität auf das transzendentale Subjekt
bezogen wird, während in der Minor von derselben Kategorie ein empirischer
Gebrauch gemacht wird.
30
Diese ungleiche Verwendung des Mittelbegriffs führt zu
dem erwähnten Fehler Quaternio Terminorum. Bezeichnet der Mittelbegriff im
28
Vgl. ebd., A 369
29
Vgl. de Oliveira Farias, Vanderlei: Kants Realismus und der Außenweltskeptizismus, S. 91.
30
Vgl. Klemme, Heiner F.: Kants Philosophie des Subjekts, S. 348.
Obersatz noch die transzendentalen Gegenstände und zweifelt ihre Existenz an,
benennt er im Untersatz nun die empirischen Gegenstände, deren Existenz
unmittelbar gegeben ist. Weil der Fehler des Paralogismus aber erst mit der
Berichtigung der Minor zum Erscheinen kommt, liegt das eigentliche Problem der
Schlussfolge eben in der Ungültigkeit dieser und nicht in der doppeldeutigen
Verwendung des Mittelbegriffs, womit der Grund für den falschen Schluss nicht
formaler, sondern materialer Art ist.
31
Somit handelt es sich streng genommen zwar
um eine fehlerhafte Schlussfolge aber nicht um einen Paralogismus.
Nachdem die Problematik der Schlussfolge nun zusammenfassend dargelegt wurde,
folgt die Betrachtung der argumentativen Vorgehensweise Kants. Da Kant es sich zur
Aufgabe macht, die Minor zu widerlegen, ist das Ziel seiner Kritik der Beweis der
unmittelbaren Wahrnehmbarkeit äußerer Erscheinungen. Dabei nutzt er die
Existenzgewissheit des eigenen Bewusstseins als den argumentativen
Ausgangspunkt, dem Descartes zustimmt. Geht Descartes also davon aus, dass das
Selbstbewusstsein Gegenstand unmittelbarer Wahrnehmung ist und somit in der
Existenz bewiesen, weist Kant nun nach, dass die äußeren Erscheinungen als
Vorstellungen ausgedehnter Wesen ebenfalls Bestandteil des Bewusstseins und
somit Gegenstand unmittelbarer Wahrnehmung sind. Der Unterschied beschränkt
sich lediglich darauf, dass die Vorstellung der eigenen Person auf den inneren Sinn
und die Vorstellungen körperlicher Objekte auf den äußeren Sinn bezogen werden.
32
Diese Erklärung Kants ist auf seine zuvor erzielten Ergebnisse der transzendentalen
Ästhetik zurückzuführen, nach denen Raum und Zeit keine für sich stehenden
Entitäten darstellen, sondern als Formen menschlicher Anschauung zu dessen
Beschaffenheit zählen. Demnach existiert ein äußerer Sinn mit der gleichen
Bestimmtheit, wie ein innerer Sinn besteht, nur dass der innere Sinn die
Anschauungsform der Zeit beschreibt, während der äußere Sinn der räumlichen
Anschauung dient. Bei beiden handelt es sich um reine Formen der Sinnlichkeit, die
a priori bereits im Gemüt vorzufinden sind und die Form der empirisch gegebenen
Anschauungen vorschreiben. Als die Werkzeuge sinnlicher Anschauung schreiben
sie zwar die Gestalt der Wahrnehmungsobjekte vor, haben aber keinerlei Einfluss auf
den Inhalt. Denn als passive Vermögen bringen sie das Wahrzunehmende nicht
31
Vgl. Kalter, Alfons: Kants vierter Paralogismus, S. 141.
32
Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, A 371.
14
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783956365263
- ISBN (Paperback)
- 9783956368707
- Dateigröße
- 923 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Bergische Universität Wuppertal – Philosophie
- Erscheinungsdatum
- 2015 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- Kant Descartes Transzendentalphilosophie Paralogismus Metaphysik Erkenntnis Realität Idealismus transzendentaler Idealismus empirisch Vernunft Wahrnehmung empirische Realität Ding an sich Raum und Zeit Außenweltskeptizismus
- Produktsicherheit
- Diplom.de