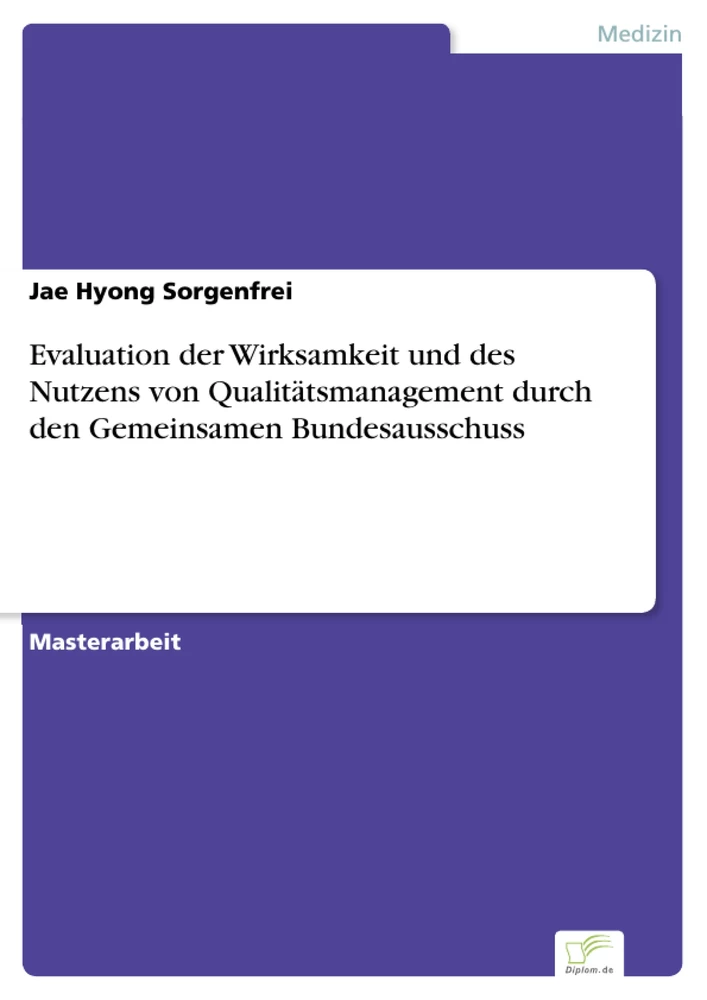Evaluation der Wirksamkeit und des Nutzens von Qualitätsmanagement durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
©2013
Masterarbeit
107 Seiten
Zusammenfassung
Qualitätsmanagement (QM) ist seit Inkrafttreten der Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung (ÄQM-Richtlinie) am 1. Januar 2006 verpflichtende Aufgabe aller an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Psychotherapeuten und medizinischen Versorgungszentren. Laut § 9 der Richtlinie überprüft der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten erstmalig die Wirksamkeit und den Nutzen des Qualitätsmanagements im Hinblick auf die Sicherung und Verbesserung der vertragsärztlichen Versorgung im Sinne der Richtlinie. Aus diesem Anlass hat der Unterausschuss Qualitätssicherung (UA QS) des G-BA im September 2011 die Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement (AG QM) mit dieser evaluativen Aufgabe beauftragt.
Die vorliegende Arbeit stellt die Herangehensweise, die angewandte Methodik und die Ergebnisse im Rahmen der Evaluation durch den G-BA dar. An dieser vom G-BA mit einer hohen Priorität versehenen Aufgabe wurde in den Gremien des G-BA noch im laufenden Jahr 2013 intensiv gearbeitet. Dieses Thema hat aus diesem Grunde einen starken Aktualitätsbezug und zudem eine hohe Relevanz, da sich der G-BA auch in Zukunft im Rahmen weiterer Evaluationen mit den Auswirkungen von QM in der vertragsärztlichen Versorgung auseinanderzusetzen hat.
Ein wesentlicher Fokus der vorliegenden Arbeit liegt zum einen auf der methodischen Vorgehensweise des G-BA und zum anderen auf den Ergebnissen der Evaluation und den daraus gewonnenen Erkenntnissen hinsichtlich der Wirksamkeit und Nutzen von QM. Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in der anschließenden Untersuchung von Gründen für die vom G-BA festgestellte - und dies sei schon an dieser Stelle vorausgeschickt - schwache Evidenz bezüglich der Wirksamkeit und Nutzen von QM in der vertragsärztlichen Versorgung. In einem abschließenden Schritt soll untersucht werden, ob es Lösungsansätze gibt, die gegebenenfalls zu einer Verbesserung der Abbildung der Wirksamkeit und Nutzen bei künftigen Evaluationen durch den G-BA beitragen können.
Die vorliegende Arbeit stellt die Herangehensweise, die angewandte Methodik und die Ergebnisse im Rahmen der Evaluation durch den G-BA dar. An dieser vom G-BA mit einer hohen Priorität versehenen Aufgabe wurde in den Gremien des G-BA noch im laufenden Jahr 2013 intensiv gearbeitet. Dieses Thema hat aus diesem Grunde einen starken Aktualitätsbezug und zudem eine hohe Relevanz, da sich der G-BA auch in Zukunft im Rahmen weiterer Evaluationen mit den Auswirkungen von QM in der vertragsärztlichen Versorgung auseinanderzusetzen hat.
Ein wesentlicher Fokus der vorliegenden Arbeit liegt zum einen auf der methodischen Vorgehensweise des G-BA und zum anderen auf den Ergebnissen der Evaluation und den daraus gewonnenen Erkenntnissen hinsichtlich der Wirksamkeit und Nutzen von QM. Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in der anschließenden Untersuchung von Gründen für die vom G-BA festgestellte - und dies sei schon an dieser Stelle vorausgeschickt - schwache Evidenz bezüglich der Wirksamkeit und Nutzen von QM in der vertragsärztlichen Versorgung. In einem abschließenden Schritt soll untersucht werden, ob es Lösungsansätze gibt, die gegebenenfalls zu einer Verbesserung der Abbildung der Wirksamkeit und Nutzen bei künftigen Evaluationen durch den G-BA beitragen können.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Sorgenfrei, Jae Hyong: Evaluation der Wirksamkeit und des Nutzens von
Qualitätsmanagement durch den Gemeinsamen Bundesausschuss, Hamburg,
Diplomica Verlag GmbH 2015
PDF-eBook-ISBN: 978-3-95636-518-8
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2015
Zugl. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Masterarbeit, 2013
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2015
Printed in Germany
3
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ... 6
Tabellenverzeichnis ... 8
Abbildungsverzeichnis ... 9
1
Einleitung ... 10
1.1
Hintergrund ... 10
1.2
Problemstellung ... 11
1.3
Zielsetzung, Fragestellung und Methodik ... 12
2
Rechtliche Rahmenbedingungen ... 14
2.1
Gesetzlicher Auftrag ... 14
2.2
Gemeinsamer Bundesausschuss und seine Trägerorganisationen ... 15
2.2.1
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) ... 15
2.2.2
Trägerorganisationen des G-BA ... 16
2.3
Patientenvertretung ... 17
2.4
QM-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung ... 17
2.4.1
Ziele von QM gemäß ÄQM-Richtlinie ... 18
2.4.2
Einführung und Weiterentwicklung von QM ... 19
2.4.3
Verpflichtung zur Evaluation von QM durch den G-BA ... 19
2.4.4
Grundelemente und Instrumente gemäß ÄQM-Richtlinie ... 20
3
Konzeptionelle Grundlagen zu QM im Gesundheitswesen ... 22
3.1
Definition von Qualität in der medizinischen Versorgung ... 22
3.2
Was ist QM in der medizinischen Versorgung ... 23
3.3
Ziele von QM im Gesundheitswesen ... 24
3.4
Messverfahren zu QM im Gesundheitswesen ... 24
3.5
PDCA-Zyklus nach Deming ... 26
3.6
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess ... 27
3.7
Qualitätsdimensionen ... 27
3.8
Total Quality Management ... 29
3.9
Ausgewählte QM-Systeme in der vertragsärztlichen Versorgung ... 30
3.9.1
Generische QM-Systeme ... 30
3.9.1.1
European Foundation for Quality Management (EFQM) ... 30
3.9.1.2
DIN EN ISO 9000 ff. ... 32
3.9.2
Medizinspezifische QM-Systeme ... 33
3.9.2.1
,,Qualität und Entwicklung in Praxen" (QEP) ... 34
3.9.2.2
,,Europäisches Praxisassessment" (EPA) ... 35
4
Methodik des G-BA zur Evaluation von QM ... 36
4
4.1
Auftrag des Unterausschusses Qualitätssicherung des G-BA ... 36
4.2
Zusammensetzung des zuständigen Gremiums ... 36
4.3
Methodik und Vorgehen des G-BA ... 37
4.3.1
Literaturrecherche ohne eigene Evaluation durch den G-BA ... 38
4.3.2
Auswertung ausgewählter QM-Systeme ... 39
4.3.2.1
Wirksamkeit und Nutzen von QEP ... 39
4.3.2.2
Wirksamkeit und Nutzen von EPA ... 40
5
Ergebnisse der Evaluation durch den G-BA ... 41
5.1
Ergebnisse aus der Literaturrecherche ... 41
5.2
Ergebnisse aus der QEP-Evaluation ... 42
5.3
Ergebnisse aus der EPA-Evaluation ... 43
6
Kritische Auseinandersetzung mit der G-BA-Evaluation ... 44
6.1
Notwendigkeit von Evaluationen ... 44
6.2
Wirksamkeit und Nutzen ... 45
6.2.1
Wirksamkeits- und Nutzenbegriff ... 45
6.2.2
Ist die Frage nach der Wirksamkeit und Nutzen von QM
gerechtfertigt? ... 46
6.2.3
Nutzen: Kostenaspekt und Effizienz ... 46
6.3
Richtlinienvorgabe des Handlungsspielraums des G-BA ... 47
6.4
Evaluationsansatz des G-BA ... 48
6.4.1
Keine eigene Evaluation durch den G-BA ... 48
6.4.2
Ergebnisindikatoren ... 50
6.4.3
Zusammenfassender Bericht der KVen und der KBV ... 51
6.4.4
Einführung von QM ohne umfassenden Evaluationsansatz ... 51
6.5
Soziale Kontextabhängigkeit und Reflexivität von QM ... 53
6.6
Komplexität und Heterogenität von QM und seinem Kontext ... 55
6.7
Quantitativer Studienansatz: Richtiger Ansatz? ... 59
6.8
Studienlage zu QM ... 63
6.8.1
Heterogenität der Studien ... 63
6.8.2
Geringe und unterschiedliche Studienqualität ... 65
6.8.3
Uneinheitlichkeit der Nomenklatur und Publikationsstandards ... 66
6.8.4
Publikations-Bias ... 68
6.9
Studie zu QEP ... 69
6.10
Studie zu EPA ... 69
7
Handlungsempfehlungen ... 70
5
7.1
Evaluation von kontextuellen Determinanten: Erfolgsfaktoren und
Barrieren ... 70
7.1.1
Kontextuelle Determinanten für erfolgreiches QM ... 72
7.1.2
Humanfaktor Führung und Organisationskultur ... 75
7.1.3
Ein mögliches Schema zur Messung der Determinanten ... 78
7.2
Prozessevaluation der Implementierung von QM ... 78
7.3
Evaluation als integraler Bestandteil von QM ... 80
7.4
Evaluation mit einem Mixed-Methods-Ansatz ... 82
7.5
Eigene Evaluation von QM durch den G-BA ... 86
7.6
Änderung der Evaluationsvorgaben der ÄQM-Richtlinie ... 87
7.7
Einheitliche Publikationsstandards ... 89
7.8
Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen ... 90
8
Fazit mit Beantwortung der Forschungsfragen ... 91
8.1
Fazit ... 91
8.2
Beantwortung der Forschungsfragen ... 92
Literaturverzeichnis ... 95
6
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung
Bedeutung
Abs. Absatz
AG Arbeitsgruppe
AOK Allgemeine
Ortskrankenkassen
AQUA
Institut für angewandte Qualitätsförderung und
ÄQM-Richtlinie Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung
BÄK Bundesärztekammer
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
BPtK Bundespsychotherapeutenkammer
BVDD
Berufsverband der Deutschen Dermatologen
BZÄK Bundeszahnärztekammer
BZgA
Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
CCT Kontrollierte
klinische
Studien
CIRS Critical
Incident Reporting-Systeme
CQI Continuous
Quality
Improvement
CONSORT Consolidated
Standards of Reporting Trials
DAG SHG
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen
DBR Deutscher
Behindertenrat
DDG
Deutsche Dermatologische Gesellschaft
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKG Deutsche
Krankenhausgesellschaft
DMP Disease
Management
Programm
DNVF Deutsche
Netzwerk
Versorgungsforschung
DPR Deutscher
Pflegerat
EbHC
Evidenzbasierte Health Care
EbM Evidenzbasierte
Medizin
EFQM
European Foundation for Quality Management
EN
Europäische Norm
EPA Europäisches
Praxisassessment
EPOC
Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Review Group
esQS externe
stationäre Qualitätssicherung
G-BA Gemeinsamer
Bundesausschuss
GFR
Gesundheitsforschungsrat des BMBF
GKV
Gesetzliche Krankenversicherung
GKV-SV Spitzenverband
der
Gesetzlichen
Krankenversicherung
GMG
Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung
GoR
Grade of Recommendation
GQMG
Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung
7
e.V.
IKK Innungskrankenkassen
IQWiG
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
IKT
Informations- und Kommunikationstechnologie
ISO
International Organization for Standardization
KBV Kassenärztliche
Bundesvereinigung
KVB
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
KVen Kassenärztliche
Vereinigungen
KVP
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
KZBV
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
KZVen Kassenzahnärztliche
Vereinigungen
LoE
Level of Evidence
MDS
Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der gesetzlichen
Krankenkassen
MeSH-Terms
Medical Subject Headings
MRC
British Medical Research Council
MUSIQ
The Model for Understanding Success in Quality
PatV
Patientenvertretung
PICO-Schema
Population, Intervention, Control und Outcome
PKV
Private Krankenversicherung
QEP
Qualität und Entwicklung in Praxen
QM Qualitätsmanagement
QMS
Quality Management System
RADAR
Results, Approach, Deployment, Assessment und Review
RCT Randomisierte
kontrollierte
Studien
SGB Sozialgesetzbuch
SIGN Scottish
Intercollegiate Guidelines Network
SQUIRE Standards
for
Quality
Improvement Reporting Excellence
STROBE Strengthening the Reporting of Observational Studies in
Epidemiology
TQM
Total Quality Management
TREND Transparent
Reporting
of Evaluations with Nonrandomized Designs
UA QS
Unterausschuss Qualitätssicherung des G-BA
Vdek
Verband der Ersatzkassen e. V.
8
Tabellenverzeichnis
Tab.-Nr. Bezeichnung
Seite
Tab. 1
Ziele des einrichtungsinternen QM gemäß ÄQM-Richtlinie
18
Tab. 2
Grundelemente gemäß ÄQM-Richtlinie
20
Tab. 3
Instrumente gemäß ÄQM-Richtlinie
21
Tab. 4
Dimensionen von Qualität in der Gesundheitsversorgung (Institute of
Medicine 2011)
22
Tab. 5
Handlungsfelder von Verfahren zur Messung der Qualität
25
Tab. 6
Merkmale der Struktur-, Prozess-und Ergebnisqualität
28
Tab. 7
QM-Normen der DIN EN ISO 9000er Reihe (9000 ff.)
32
Tab. 8
Heterogenität der vom G-BA recherchierten Studien zu QM
64
Tab. 9
Kontextuelle Erfolgsfaktoren bzw. Barrieren für ein erfolgreiches QM
72
Tab. 10
Erfolgsfaktoren bzw. Barrieren für QM durch die Führung
76
Tab. 11
Selbstevaluation
der
Aktivitäten und ihre subjektiv
wahrgenommenen Auswirkungen durch die Vertragsarztpraxis
82
Tab. 12
Mögliche quantitative und qualitative Forschungsansätze bei der
Evaluation von QM im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs
84
9
Abbildungsverzeichnis
Abb.-Nr. Bezeichnung
Seite
Abb. 1
PDCA-Zyklus
26
Abb. 2
EFQM-Excellence-Modell
31
Abb. 3
Prozentuale Nutzungsanteile der in deutschen Vertragsarztpraxen
verwendeten QM-Systeme
35
10
1 Einleitung
In diesem Kapitel wird der Hintergrund der Evaluation von Qualitätsmanagement
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss und die damit verbundene
Problematik dargestellt, um daraus die Zielsetzung und die zielführenden
Fragestellungen abzuleiten.
1.1 Hintergrund
Qualitätsmanagement (QM) ist seit Inkrafttreten der Qualitätsmanagement-
Richtlinie vertragsärztliche Versorgung (ÄQM-Richtlinie) am 1. Januar 2006
verpflichtende Aufgabe aller an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden
Ärzte, Psychotherapeuten und medizinischen Versorgungszentren
1
. Laut § 9 der
Richtlinie überprüft der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) fünf Jahre nach
ihrem Inkrafttreten erstmalig die Wirksamkeit und den Nutzen des
Qualitätsmanagements im Hinblick auf die Sicherung und Verbesserung der
vertragsärztlichen Versorgung im Sinne der Richtlinie. Aus diesem Anlass hat der
Unterausschuss Qualitätssicherung (UA QS) des G-BA im September 2011 die
Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement (AG QM) mit dieser evaluativen Aufgabe
beauftragt.
Die vorliegende Arbeit stellt die Herangehensweise, die angewandte Methodik
und die Ergebnisse im Rahmen der Evaluation durch den G-BA dar. An dieser
vom G-BA mit einer hohen Priorität versehenen Aufgabe wurde in den Gremien
des G-BA noch im laufenden Jahr 2013 intensiv gearbeitet. Dieses Thema hat
aus diesem Grunde einen starken Aktualitätsbezug und zudem eine hohe
Relevanz, da sich der G-BA auch in Zukunft im Rahmen weiterer Evaluationen
mit den Auswirkungen von QM in der vertragsärztlichen Versorgung
auseinanderzusetzen hat.
Ein wesentlicher Fokus der vorliegenden Arbeit liegt zum einen auf der
methodischen Vorgehensweise des G-BA und zum anderen auf den Ergebnissen
der Evaluation und den daraus gewonnenen Erkenntnissen hinsichtlich der
Wirksamkeit und Nutzen von QM. Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit
in der anschließenden Untersuchung von Gründen für die vom G-BA festgestellte
- und dies sei schon an dieser Stelle vorausgeschickt - schwache Evidenz
bezüglich der Wirksamkeit und Nutzen von QM in der vertragsärztlichen
1
Wenn in der vorliegenden Arbeit von ,,vertragsärztlicher Versorgung", ,,Vertragsärzten",
,,Vertragsarztpraxen" o. ä. gesprochen wird, sind damit jeweils auch Vertragspsychotherapeuten
und medizinische Versorgungszentren im Sinne der ÄQM-Richtlinie gemeint.
11
Versorgung. In einem abschließenden Schritt soll untersucht werden, ob es
Lösungsansätze gibt, die gegebenenfalls zu einer Verbesserung der Abbildung
der Wirksamkeit und Nutzen bei künftigen Evaluationen durch den G-BA
beitragen können.
1.2 Problemstellung
QM beinhaltet qualitätsverbessernde Maßnahmen und alle Anstrengungen, die
geeignet sind, die Strukturen, Prozesse und Ergebnisse der medizinischen
Versorgung durch organisationale und strukturelle Veränderungen zu verbessern
(Danz et al. 2012). Nach einer über ein Jahr dauernden Evaluationsphase
gelangte der G-BA in diesem Jahr (2013) zu der wichtigen Erkenntnis, dass die
wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit und Nutzen von QM im Hinblick auf
die versorgungsrelevanten patientenbezogenen Ergebnisse (Outcome) in der
vertragsärztlichen Versorgung gering ist. Diese Erkenntnis ist für den G-BA im
Hinblick auf seine ÄQM-Richtlinie bedeutsam und nicht unproblematisch, da
letztere die Einführung und Umsetzung von QM in vertragsärztlichen
Einrichtungen mit dem Ziel der Sicherung und Verbesserung der
vertragsärztlichen Versorgung verpflichtend vorschreibt.
Aus Sicht des G-BA ergibt sich daher die Frage nach den Gründen für die
geringe wissenschaftliche Evidenz vor dem Hintergrund, dass QM bei
vollständiger Implementierung und konsequenter Durchführung ein allgemein
anerkanntes und verbreitet angewandtes wertvolles Instrument zur Verbesserung
von Prozessen, Ergebnissen und Strukturen darstellt. Daraus resultiert die Frage
nach Lösungsmöglichkeiten, wie die Abbildung der Wirksamkeit und Nutzen von
QM bei der Evaluation verbessert werden kann.
Bevor Lösungsansätze gefunden werden können, sind die vielschichtigen
Probleme zu identifizieren, die dazu geführt haben, dass der G-BA nur eine
schwache Evidenzlage bezüglich der Wirksamkeit und Nutzen von QM
ausmachen konnte. Die Problemanalyse müsste sich auch mit den folgenden
grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen: Ist die Frage nach der Wirksamkeit
und Nutzen von QM überhaupt zielführend? Ist eine Evaluation der Wirksamkeit
und Nutzen von QM im Sinne des versorgungsrelevanten patientenbezogenen
Outcome überhaupt der richtige Ansatz? Wenn diese Fragen zu verneinen sind,
welche Fragestellungen sind für den G-BA zielführend im Hinblick auf die
künftige Wahl eines Evaluationsansatzes, um positive Wirkungen und Vorteile
von QM angemessen abzubilden? In diesem Zusammenhang könnten
12
Determinanten einer erfolgreichen Umsetzung von QM eine wichtige Rolle
spielen (siehe Abschnitt 7.1).
Vor dem Hintergrund der geringen Evidenz bezüglich Wirksamkeit- und Nutzen
von QM und der Regelungen des G-BA, dass
1. die ÄQM-Richtlinie des G-BA die Einführung und Weiterentwicklung eines
einrichtungsinternen QM zur Verpflichtung für jeden Vertragsarzt und
Vertragspsychotherapeuten erhebt,
2. das einrichtungsinterne QM unter anderem der kontinuierlichen Sicherung
und Verbesserung der Qualität der medizinischen und
psychotherapeutischen Versorgung dienen soll, und dass
3. der G-BA gemäß ÄQM-Richtlinie auf der Grundlage der Bewertung der
vorhandenen Wirksamkeits- und Nutzennachweise nach abgeschlossener
Evaluation über die Akkreditierung von Qualitätsmanagementsystemen
und über die Notwendigkeit von Sanktionen für Vertragsärzte,
Vertragspsychotherapeuten und medizinische Versorgungszentren
entscheiden soll, die das einrichtungsinterne QM nur unzureichend
einführen oder weiterentwickeln (Gemeinsamer Bundesausschuss 2005),
wäre es wünschenswert, dass künftige Evaluationen des G-BA in der Lage sind,
die allgemein akzeptierten positiven Wirkungen von QM auch abzubilden, um die
offensichtliche ,,Augenscheinvalidität" von QM (Meyer und Boukamp 2012) auch
mit entsprechenden Daten zu untermauern. Auf diese Weise könnte die
Handlungs- und Entscheidungsgrundlage bezüglich der normativen
Regelungskompetenz des G-BA hinsichtlich der Einführung und Umsetzung von
QM weiter gestärkt werden.
1.3 Zielsetzung, Fragestellung und Methodik
Der G-BA hat einen Evaluationsansatz gewählt, der ausschließlich auf die
Bewertung der versorgungsrelevanten Wirksamkeit und des Nutzens von QM
bezüglich der Verbesserung der medizinischen Versorgung abzielt, ohne
gleichzeitig auch andere relevante Faktoren im Zusammenhang mit QM wie z. B.
Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von QM zu adressieren. Das
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie,
angesichts der genannten geringen Evidenz bezüglich der Wirksamkeit und des
Nutzens von QM, der durch den G-BA angewandte methodische Ansatz
modifiziert werden könnte, um die positiven Effekte von QM im Kontext von
13
Qualitätsverbesserungen in der vertragsärztlichen Versorgung besser
abzubilden. Daraus sollen Handlungsempfehlungen für künftige Evaluationen
durch den G-BA abgeleitet werden, die der allgemein anerkannten und
unbestrittenen Bedeutung von QM als umfassendes Instrument zur
Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen auch besser gerecht werden
können. Dies könnte auch im Hinblick auf eine inhaltliche Fundierung und
Untermauerung der Aktivitäten des G-BA im Regelungsbereich von QM relevant
sein.
Aus der in Abschnitt 1.2 dargestellten Problemstellung sollen im Rahmen der
vorliegenden Arbeit die folgenden Forschungsfragen untersucht und beantwortet
werden:
1. Welche Wirksamkeit und Nutzen von QM wurde nachgewiesen?
2. Was sind die Gründe für die geringe wissenschaftliche Evidenz?
3. Wie kann die Abbildung der Wirksamkeit und Nutzen bei der Evaluation
verbessert werden?
Die vorliegende Arbeit untersucht in einem qualitativ empirischen Ansatz einer
deskriptiven Fallstudie (qualitative Beobachtungsstudie) die Methodik und die
praktische Herangehensweise durch den G-BA bei der Evaluation der
Wirksamkeit und des Nutzens von QM in der vertragsärztlichen Versorgung.
Dieses komplexe Anwendungsbeispiel einer Evaluation von QM, welches die
Summe von vielen Einzel-Interventionen zur Qualitätsverbesserung darstellt, soll
einschließlich der Ergebnisse literaturbasiert vor dem Hintergrund konzeptioneller
Grundlagen von QM bewertet werden. Auf dieser Basis beleuchtet die
vorliegende Arbeit insbesondere auch den vom G-BA ausschließlich fokussierten
Wirksamkeits- und Nutzenparameter als Zielvariable des einrichtungsinternen
QM auf ihre Geeignetheit zur Abbildung von Effekten von QM. Dabei ist zu
betonen, dass der G-BA unter anderem auch aus Kosten- und anderen
Ressourcengründen selbst weder eine eigene Evaluation in den
vertragsärztlichen Praxen durchgeführt hat, was durchaus naheliegend und
umsetzbar gewesen wäre, noch eine solche bei einer wissenschaftlichen
Institution wie IQWiG
2
oder AQUA-Institut
3
in Auftrag gegeben hat (siehe
Abschnitte 4.3.1 und 6.4.1). Die Evaluation durch den G-BA basiert auf einer
systematischen Literaturrecherche in internationalen Datenbanken und auf
2
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
3
Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen
14
ausgewählten Studien zu QM in der vertragsärztlichen Versorgung in
Deutschland (siehe Abschnitt 4.3).
2 Rechtliche
Rahmenbedingungen
Im vorigen Kapitel wurden der Hintergrund, die Methodik und die Zielsetzung der
vorliegenden Arbeit dargelegt. In diesem Kapitel sollen die rechtlichen
Grundlagen und die relevanten Institutionen und Akteure vorgestellt werden, die
im Hinblick auf gesetzliche Regelungen bezüglich des einrichtungsinternen QM
von Bedeutung sind.
2.1 Gesetzlicher
Auftrag
Am 1. Januar 2004 trat das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GMG 2004) in Kraft. Darin wurde der G-BA beauftragt, die
grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes QM für alle an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten zu
bestimmen. Dieser gesetzliche Auftrag leitet sich nach § 135a Abs. 1 SGB V aus
der Verpflichtung der Leistungserbringer zur Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen ab. Die Leistungen müssen
demnach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen
und in der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden.
Der G-BA beschließt nach § 92 Abs. 1 Satz 1 SGB V die zur Sicherung der
ärztlichen Versorgung erforderlichen Richtlinien, die eine ausreichende,
zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten gewährleisten.
Daraus folgend bestimmt der G-BA nach §137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V durch
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V die grundsätzlichen
Anforderungen an ein einrichtungsinternes QM für die vertragsärztliche
Versorgung. Aus diesem gesetzlichen Auftrag heraus verpflichtet der
Gesetzgeber alle Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeuten und medizinischen
Versorgungszentren nach Maßgabe des § 135a Abs. 2 Nr. 2 SGB V, ein
einrichtungsinternes QM einzuführen und weiterzuentwickeln. Der G-BA
beschloss auf dieser gesetzlichen Grundlage die ÄQM-Richtlinie, die am
1. Januar 2006 in Kraft trat (Gemeinsamer Bundesausschuss 2005).
15
2.2
Gemeinsamer Bundesausschuss und seine Träger-
organisationen
2.2.1 Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
Der G-BA ist das zentrale Entscheidungsgremium und Selbstverwaltungsorgan
im deutschen Gesundheitswesen. Er hat die Regelungskompetenz bei allen
wichtigen Fragen und Belangen des Gesundheitswesens. Dies betrifft unter
anderem Themen wie einrichtungsinternes QM, sektorenübergreifende
Qualitätssicherung, Ein- und Ausschluss von Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). Die Entscheidungs- und Konsensfindung geschieht
in einem korporativen Beratungs- und Verhandlungsprozess auf dem Wege
eines Interessenausgleichs von Interessenunterschieden zwischen den
stimmberechtigten Trägern des G-BA unter Einbeziehung der
Patientenvertretung.
Die Rechtsgrundlage des G-BA findet sich im § 91 SGB V
4
. Gemäß § 91 Abs. 1
Satz 1 SGB V wird der G-BA durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), die Deutsche
Krankenhausgesellschaft (DKG) und den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen (GKV-SV) als Trägerorganisationen gebildet. Die KBV, die
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die DKG repräsentieren
und vertreten die Leistungserbringer auf Bundesebene jeweils mit Stimmrecht
beim G-BA. Der GKV-SV ist die stimmberechtigte Spitzenorganisation aller
gesetzlichen Krankenkassen und vertritt somit die Kostenträger auf
Bundesebene beim G-BA. Die Patientenvertretung ist Mitglied beim G-BA mit
Antrags- und Mitberatungsrecht, jedoch ohne Stimmrecht.
Bei Abstimmungen haben gemäß § 91 Abs. 2 Satz 1 SGB V die DKG und die
KBV jeweils zwei Stimmen, die KZBV eine Stimme und der GKV-SV fünf
Stimmen, so dass sowohl Leistungserbringer als auch Kostenträger jeweils fünf
Stimmen auf sich vereinigen. Ein unparteiischer Vorsitzender und zwei weitere
unparteiische Mitglieder des G-BA haben jeweils eine Stimme und runden das
Bild ab, so dass bei insgesamt 13 Stimmen am Ende immer eine Entscheidung
mit einfacher Mehrheit möglich ist.
Die inhaltliche Arbeit zu den jeweiligen Beratungsthemen wird wie auch der
Auftrag zur Evaluation von QM in den zahlreichen Arbeitsgruppen geleistet, die
jeweils themenbezogenen Unterausschüssen zugeordnet und berichtspflichtig
4
SGB V: Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
16
sind. Sowohl die im deutschen Gesundheitswesen normgebenden Richtlinien als
auch nicht normgebende Arbeitsergebnisse wie z. B. Beauftragungen von
wissenschaftlichen Institutionen im Rahmen der sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung werden nach inhaltlicher Erarbeitung in den Arbeitsgruppen
den jeweiligen Unterausschüssen zur Beratung und Konsentierung vorgelegt, die
weiter in den Plenumssitzungen des G-BA beschlossen werden. Die
Richtlinienbeschlüsse des G-BA haben den Charakter untergesetzlicher Normen
und sind bindend für alle Akteure im Gesundheitswesen.
Je nach Beratungsthema werden nach Maßgabe des § 137 Abs. 1 Satz 3 SGB V
und der Geschäfts- und Verfahrensordnung des G-BA zudem Organisationen
beteiligt, deren Belange durch das jeweilige Thema berührt sind. Die für die
Durchführung der Evaluation der Wirksamkeit und Nutzen von QM zuständige
AG setzt sich daher aus den genannten Trägern (KBV, DKG, KZBV und GKV-
SV) und aus fünf beteiligten Organisationen zusammen, deren aller Belange
durch das Thema QM tangiert sind.
2.2.2 Trägerorganisationen des G-BA
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts und die Dachorganisation der 17 Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) in Deutschland. Die KVen haben den gesetzlichen Auftrag
zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Patientenversorgung
(Sicherstellungsauftrag). Mitglieder der KVen sind vertragsärztlich tätige
niedergelassene Ärzte und Vertragspsychotherapeuten, deren Interessen die
KBV auf Bundesebene qua Mitwirkung beim G-BA vertritt. Die KBV, die von der
ÄQM-Richtlinie ausschließlich betroffen ist, war bei der aktuellen Evaluation einer
der maßgeblichen Akteure in der AG QM, da die Evaluation ausschließlich die
durch die KBV repräsentierten Leistungserbringer betrifft.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist der Dachverband der Spitzen-
und Landesverbände der Krankenhausträger einschließlich kirchlicher und
privater Träger und vertritt die Interessen und Belange von Krankenhäusern auf
Bundesebene durch ihre Mitwirkung beim G-BA. In Verhandlungen mit den
Spitzenverbänden der GKV und Privaten Krankenversicherung (PKV) trifft die
DKG Grundsatzentscheidungen, die per Gesetz für alle Krankenhäuser und
Krankenkassen verbindlich werden. In ihrer Gesellschaftsform ist die DKG
privatrechtlich verfasst und ist ein eingetragener Verein (e. V.). Die DKG wirkte in
17
der AG QM als einer der Träger des G-BA mit, auch wenn die stationäre
Versorgung von der aktuellen Evaluation nicht betroffen ist.
Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV) ist die
Interessenvertretung aller gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in
Deutschland und ist einer der stimmberechtigten Träger beim G-BA, der bei der
aktuellen Evaluation von QM ebenfalls eine tragende Rolle spielte. In den
Gremien des G-BA tritt er in der Regel mit einer einheitlichen Stimme auf, auch
wenn Vertreter von Spitzenverbänden unterschiedlicher Kassenarten (AOK
5
,
IKK
6
, Vdek
7
etc.) entsandt werden. Dies kann unter Umständen, abhängig von
der jeweiligen Situation, mit einer relativ starken Position der Kostenträgerseite
verbunden sein, da die Leistungserbringerseite nicht selten bis zu drei
verschiedene Positionen (KBV, DKG und KZBV) zu einem bestimmten
Beratungsthema einnimmt, was die Verhandlungsmacht unter Umständen
schwächen kann.
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) ist die Dachorganisation der
17 Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) in Deutschland und vertritt die
Interessen der Vertragszahnärzte auf Bundesebene. Die KZBV hat einen
Sicherstellungsauftrag der vertragszahnärztlichen Versorgung in Deutschland.
Als eine der Trägerorganisationen des G-BA war sie in der AG QM vertreten,
auch wenn die vertragszahnärztliche Versorgung wie der stationäre Sektor von
der aktuellen Evaluation nicht tangiert ist.
2.3 Patientenvertretung
Die Patientenvertretung (PatV) beim G-BA setzt sich aus Mitgliedern
verschiedener Patienten- und Selbsthilfeorganisationen wie Deutscher
Behindertenrat (DBR), Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG
SHG) etc. zusammen und vertritt die Interessen der Patienten auf Bundesebene.
Die PatV ist Mitglied in der AG QM und war ebenfalls eine mitberatende
Organisation bei der aktuellen Evaluation. Die PatV ist kein Träger des G-BA.
2.4 QM-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung
Die QM-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung (ÄQM-Richtlinie) regelt die
grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes QM der an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Psychotherapeuten und
5
Allgemeine Ortskrankenkassen
6
Innungskrankenkassen
7
Verband der Ersatzkassen e. V.
18
medizinischen Versorgungszentren und wurde am 18. Oktober 2005 vom G-BA
beschlossen. Sie trat am 1. Januar 2006 in Kraft.
Derzeit gibt es weitere Regelwerke des G-BA zum einrichtungsinternen QM, die
zum einen den zahnärztlichen und zum anderen den stationären Sektor
betreffen. Sie werden der Vollständigkeit halber an dieser Stelle erwähnt, aber
nicht weiter ausgeführt, da beide Sektoren von der Evaluation durch den G-BA
nicht betroffen sind:
· QM-Richtlinie vertragszahnärztliche Versorgung zur Regelung der
grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes QM in
vertragszahnärztlichen Einrichtungen und die
· QM-Vereinbarung zur Regelung der grundsätzlichen Anforderungen an
ein einrichtungsinternes QM der nach § 108 SGB V zugelassenen
Krankenhäuser.
2.4.1 Ziele von QM gemäß ÄQM-Richtlinie
Die ÄQM-Richtlinie des G-BA bestimmt die grundsätzlichen Anforderungen an
ein
einrichtungsinternes QM in der vertragsärztlichen Versorgung. Dabei soll
gemäß § 2 ÄQM-Richtlinie die Einführung und Weiterentwicklung eines
einrichtungsinternen QM der kontinuierlichen Sicherung und Verbesserung der
Qualität der medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung dienen.
Dieses vorrangige Ziel soll durch die in Tab. 1 zusammengefassten
Qualitätsverbesserungen erreicht werden, die ihrerseits über eine erfolgreiche
Umsetzung von QM ermöglicht werden sollen.
Vorrangiges Ziel des einrichtungsinternen QM:
Kontinuierliche Sicherung und Verbesserung der Qualität der medizinischen und
psychotherapeutischen Versorgung
Zielerreichung durch Qualitätsverbesserungen bezüglich der folgenden Bereiche:
· Systematische
Patientenorientierung bei allen Aktivitäten
· Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Ärzte und Mitarbeiter
· Integration des Qualitätsmanagements als Aufgabe aller Praxismitarbeiter
· Einbettung des Qualitätsmanagements in eine an konkreten Zielen ausgerichtete
Praxispolitik und Praxiskultur durch die Praxisleitung
· Risikoerkennung und Problemvermeidung durch die Identifikation relevanter Abläufe, deren
systematische Darlegung und dadurch hergestellte Transparenz
· Objektivierung und Messung von Ergebnissen der medizinischen und
psychotherapeutischen Versorgung
· Angemessene Einbeziehung aller an der Versorgung Beteiligter
· Strukturierte Kooperation an den Nahtstellen der Versorgung
Tab. 1: Ziele des einrichtungsinternen QM gemäß ÄQM-Richtlinie
19
2.4.2 Einführung und Weiterentwicklung von QM
Laut § 6 der ÄQM-Richtlinie gliedert sich die Einführung des einrichtungsinternen
QM in die Phasen ,,Planung", ,,Umsetzung" und ,,Überprüfung" sowie in die Phase
,,fortlaufende Weiterentwicklung" von QM. Die Planungsphase soll längstens zwei
Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie (am 1. Januar 2006) oder bei späterer
Niederlassung nach Aufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit dauern
(Gemeinsamer Bundesausschuss 2005). Die anschließende Umsetzung von QM
ist in längstens zwei weiteren Jahren nach der Planungsphase abzuschließen. In
einer längstens ein weiteres Jahr dauernden Überprüfungsphase ist eine
Selbstbewertung der Praxis hinsichtlich der Einführung der Grundelemente und
Instrumente vorzunehmen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2005). Stimmen die
einzelnen Phasen, in denen sich die Praxen tatsächlich befinden, mit den
vorgegebenen Zeiträumen überein, sind sie phasenkonform (Diel 2012). Nach
der Überprüfungsphase ist das einrichtungsinterne QM anhand jährlich
durchzuführender Selbstbewertungen der Praxis hinsichtlich der ergriffenen
Maßnahmen zu den Grundelementen und Instrumenten fortlaufend
weiterzuentwickeln (Gemeinsamer Bundesausschuss 2005).
2.4.3 Verpflichtung zur Evaluation von QM durch den G-BA
Die Wirksamkeit und Nutzen des einrichtungsinternen QM ist gemäß § 9 der
ÄQM-Richtlinie nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
im Hinblick auf die Sicherung und Verbesserung der vertragsärztlichen
Versorgung auf der Grundlage von publizierten Studien zu überprüfen, die
versorgungsrelevante Ergebnisse der Einführung von QM-Systemen und
Verfahren insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland untersuchen.
Besonderer Stellenwert kommt gemäß § 9 und Anlage 1 der ÄQM-Richtlinie
vergleichenden praxisübergreifenden Studien und Forschungsprogrammen zu,
die anhand von Zusammenstellungen von möglichst evidenzbasierten
Ergebnisindikatoren ausgewogen und differenziert verschiedene Bereiche der
Versorgungsqualität bezüglich Praxisorganisation, Prävention, Diagnostik und
Therapie häufiger Erkrankungen sowie Patientenorientierung und einzelner
Fachgebiete abbilden (erfassen) und so Aussagen zur Wirksamkeit von QM-
Systemen zulassen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2005).
Die ÄQM-Richtlinie regelt weiter, dass der G-BA aufgrund der Bewertung der im
Rahmen der Evaluation gefundenen Wirksamkeits- und Nutzennachweise im
Hinblick auf die Sicherung und Verbesserung der vertragsärztlichen Versorgung
20
über die Akkreditierung von QM-Systemen und über die Notwendigkeit von
Sanktionen für Vertragsärzte entscheidet, die das einrichtungsinterne QM
unzureichend einführen oder weiterentwickeln (Gemeinsamer Bundesausschuss
2005).
2.4.4 Grundelemente und Instrumente gemäß ÄQM-Richtlinie
Die ÄQM-Richtlinie macht keine normativen Vorgaben bezüglich der Priorisierung
bestimmter QM-Modelle oder Systeme, sondern gibt ganz allgemein die
Anwendung von Grundelementen und Instrumenten als wesentliche Inhalte des
einrichtungsinternen QM vor. Sie benennt die von Vertragsärzten bei ihrer
Leistungserbringung obligatorisch zu integrierenden Grundelemente eines
einrichtungsinternen QM, die zum einen den Bereich ,,Patientenversorgung" (z. B.
mit dem Grundelement zur Ausrichtung der Versorgung am aktuellen Stand der
Medizin, siehe auch Abschnitt 3.1) und zum anderen den Bereich
,,Praxisführung/Mitarbeiter/Organisation" (z. B. mit dem Grundelement zur
,,Regelung von Verantwortlichkeiten") adressieren (siehe Tab. 2). Diese Bereiche
sollen letztlich den Nutzen für den Patienten fördern und den Einsatz von
Ressourcen optimieren. Im Folgenden sind zusammenfassend alle
Grundelemente gemäß § 3 ÄQM-Richtlinie in Tab. 2 aufgeführt:
Grundelemente
Bereich ,,Patientenversorgung"
Bereich
,,Praxisführung/Mitarbeiter/Organisation"
Ausrichtung der Versorgung an fachlichen
Standards und Leitlinien entsprechend dem
jeweiligen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse
Regelung von Verantwortlichkeiten
Patientensicherheit Mitarbeiterorientierung (z. B. Arbeitsschutz, Fort-
und Weiterbildung)
Patientenorientierung
Praxismanagement (z. B. Terminplanung,
Datenschutz, Hygiene, Fluchtplan)
Patientenmitwirkung
Gestaltung von Kommunikationsprozessen
(intern/extern) und Informationsmanagement
Patienteninformation und beratung
Kooperation und Management der Nahtstellen der
Versorgung
Strukturierung von Behandlungsabläufen Integration
bestehender
Qualitätssicherungsmaßnahmen in das interne
QM
Tab. 2: Grundelemente gemäß ÄQM-Richtlinie
21
Die Grundelemente setzen an den im Alltag der Routineversorgung empirisch
erkannten Mängeln an, wobei bezüglich ihres tatsächlichen Potentials zu
Qualitätsverbesserungen belastbare Daten fehlen (Meyer und Boukamp 2012).
Die Instrumente eines einrichtungsinternen QM gemäß ÄQM-Richtlinie, die von
Vertragsärzten ebenfalls verpflichtend umzusetzen sind, thematisieren
Handlungsbereiche, die im Praxisalltag in unterschiedlichem Maße
Verbesserungsbedarf haben. So wird der Bereich Notfallmanagement in der
Regel einen größeren Optimierungsbedarf haben als Teambesprechung oder
Dokumentation. Im Folgenden sind die Instrumente gemäß § 4 ÄQM-Richtlinie in
Tab. 3 aufgelistet:
Instrumente
Festlegung von konkreten Qualitätszielen für die einzelne Praxis, Ergreifen von
Umsetzungsmaßnahmen, systematische Überprüfung der Zielerreichung und erforderlichenfalls
Anpassung der Maßnahmen
Regelmäßige, strukturierte Teambesprechungen
Prozess- und Ablaufbeschreibungen, Durchführungsanleitungen
Patientenbefragungen, nach Möglichkeit mit validierten Instrumenten
Beschwerdemanagement
Organigramm, Checklisten
Erkennen und Nutzen von Fehlern und Beinahe-Fehlern zur Einleitung von
Verbesserungsprozessen
Notfallmanagement
Dokumentation der Behandlungsverläufe und der Beratung
Qualitätsbezogene Dokumentation, insbesondere
· Dokumentation der Qualitätsziele und der ergriffenen Umsetzungsmaßnahmen
· Dokumentation der systematischen Überprüfung der Zielerreichung (z. B. anhand von
Indikatoren) und der erforderlichen Anpassung der Maßnahmen
Tab. 3: Instrumente gemäß ÄQM-Richtlinie
Das Instrument ,,Festlegung von konkreten Qualitätszielen..." beschreibt die
Anwendung der Schritte des PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) als
wesentliches Grundprinzip von QM (siehe Abschnitt 3.5). Das Instrument
,,Erkennen und Nutzen von Fehlern..." stellt dem Nutzer frei, welches konkrete
Verfahren er zum Risiko- und Fehlermanagement anwendet (beispielsweise
CIRS
8
).
8
CIRS = Critical Incident Reporting-Systeme
22
3 Konzeptionelle Grundlagen zu QM im Gesundheitswesen
Im vorigen Kapitel wurden die rechtlichen und die regulatorisch-strukturellen
Seiten beleuchtet, die hinsichtlich des einrichtungsinternen QM bedeutsam sind.
In diesem Kapitel sollen konzeptionelle Grundlagen zu QM sowie wichtige QM-
Ansätze vorgestellt werden.
3.1 Definition von Qualität in der medizinischen Versorgung
Das Interesse an Qualität hat in der Gesundheitsversorgung in den letzten
Jahren kontinuierlich zugenommen (Batalden und Stolz 1993, Teasdale 2008).
Dies führt zu der Frage, wie Qualität im Gesundheitswesen definiert ist, und wie
sie als integraler Bestandteil in Organisationen der Gesundheitsversorgung
eingebettet werden kann. DIN EN ISO 9000:2005 (siehe Abschnitt 3.9.1.2)
definiert Qualität als den Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale
Anforderungen erfüllt. Ähnlich definiert Crosby (1979) Qualität als Grad der
Übereinstimmung mit vorher formulierten Anforderungen (Crosby 1979). Die
Qualität kennzeichnet demnach, zu welchem Ausmaß Leistungen den gesetzten
und erwarteten Anforderungen entsprechen.
Trotz eines allgemeinen Konsenses bezüglich der genannten Definitionen von
Qualität, ist der Begriff der Qualität in der Gesundheitsversorgung nicht statisch,
sondern unter anderem abhängig von der Perspektive der jeweiligen Akteure,
deren Interessen und Wertvorstellungen (Sutherland und Dawson 1998, Currie et
al. 2005). Somit ist Qualität ein dehnbarer Begriff, der sich auf äußerst vielfältige
Aspekte beziehen kann (Siess 2002), so dass Qualität in der
Gesundheitsversorgung ein komplexer und vielschichtiger Begriff ist. Dies kommt
in der Definition des Institute of Medicine zum Ausdruck, die sechs verschiedene
Dimensionen von Qualität in der Gesundheitsversorgung unterscheidet (siehe
Tab. 4):
Qualitätsdefinition des Institute of Medicine
1. Patientensicherheit (Safety)
2. Behandlungseffektivität (Effectiveness)
3. Patienten-Zentriertheit (Patient-Centredness)
4. Versorgung auf dem aktuellen Stand der Medizin (Timeliness)
5. Effizienz (Efficiency)
6. gerechter Zugang zur Gesundheitsversorgung (Equity)
Tab. 4: Dimensionen von Qualität in der Gesundheitsversorgung (Institute of Medicine
2011)
23
Die ersten vier Dimensionen Patientensicherheit, Behandlungseffektivität,
Patienten-Zentriertheit und Versorgung auf dem aktuellen Stand der Medizin
werden durch die Grundelemente und Instrumente der ÄQM-Richtlinie des G-BA
adressiert (siehe Abschnitt 2.4.4) und sind bei der Umsetzung von QM in der
vertragsärztlichen Versorgung vorgeschrieben (Gemeinsamer Bundesausschuss
2005). Der gesundheitsökonomische Aspekt der Effizienz wird durch die ÄQM-
Richtlinie nicht explizit thematisiert (siehe auch Abschnitt 6.2.3), aber implizit
angesprochen, wenn in den Grundelementen z. B. von ,,Strukturierung von
Behandlungsabläufen" bzw. in den Instrumenten z. B. von ,,Prozess- und
Ablaufbeschreibungen" oder ,,Checklisten" die Rede ist (siehe Abschnitt 2.4.4).
Die Zugangsgerechtigkeit als sechste Dimension von Qualität in der
Gesundheitsversorgung (siehe Tab. 4) ist als Public Health Thema nicht
Gegenstand der ÄQM-Richtlinie.
3.2 Was ist QM in der medizinischen Versorgung
QM ist die Summe aller Maßnahmen in einer medizinischen Einrichtungen, die
gesteuert und durchgeführt werden, um eine effiziente Qualitätsverbesserung der
Patientenversorgung herbeizuführen (Toepler 2004) und ein dauerhafter Prozess
zur kontinuierlichen Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation, der den
sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen ist (Nüllen und Noppeney
2006). QM wird nach DIN EN ISO 9000:2000 wie folgt definiert (siehe auch
Abschnitt 3.9.1.2): ,,Unter Qualitätsmanagement versteht man aufeinander
abgestimmte Tätigkeiten zum Lenken und Leiten einer Organisation bezüglich
Qualität. Leiten und Lenken bezüglich Qualität umfassen üblicherweise das
Festlegen der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele, die Qualitätsplanung, die
Qualitätslenkung, die Qualitätssicherung und die Qualitätsverbesserung." QM ist
somit eine Managementmethode zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung auf
der Struktur-, Prozess- und Ergebnisebene auf der Grundlage des PDCA
9
-Zyklus
(siehe Abschnitt 3.5) und des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (siehe
Abschnitt 3.6).
QM hat in den letzten Jahren im Gesundheitswesen zunehmend breite
Zustimmung erfahren und ist ein Teil der Unternehmensstrategie (Eberlein-
Gonska 2011). Es stellt auf der Grundlage der Mitwirkung aller Mitarbeiter die
Qualität in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen und hat zum Ziel, die Bedürfnisse
und Ansprüche von Patienten, Mitarbeitern und Ärzten, aber auch weiterer
9
PDCA: Plan, Do, Check, Act
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (PDF)
- 9783956365188
- ISBN (Paperback)
- 9783956368622
- Dateigröße
- 739 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Institute of Management Berlin, Berlin School of Economics and Law
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Qualitätsmanagement Wirksamkeit und Nutzen Evaluation vertragsärztliche Versorgung
- Produktsicherheit
- Diplom.de