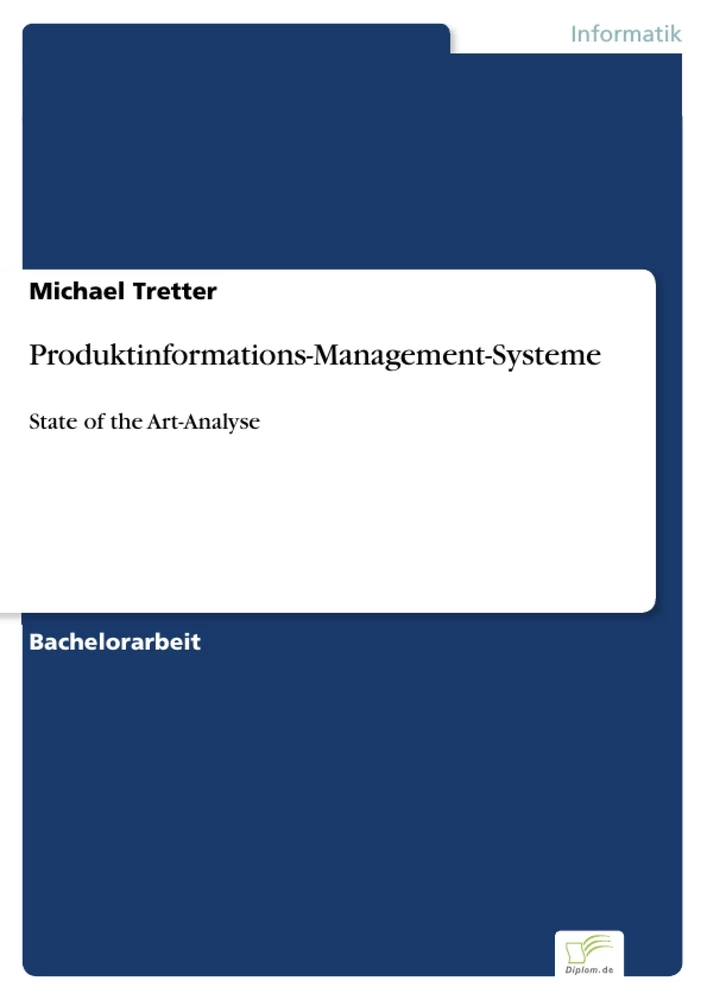Produktinformations-Management-Systeme
State of the Art-Analyse
©2013
Bachelorarbeit
77 Seiten
Zusammenfassung
Diese Bachelorarbeit hat das Ziel, eine State of the Art-Analyse von Produktinformations-Systemen zu erstellen. Es wird definiert, worum es sich bei einem PIM-System handelt und welche Vorteile es einem Unternehmen ermöglichen kann. Durch eine eigens erstellte Online-Befragung wird das Eintreten dieser Vorteile in der Praxis überprüft.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tretter, Michael: Produktinformations-Management-Systeme: State of the Art-Analyse,
Hamburg, Diplomica Verlag GmbH 2015
PDF-eBook-ISBN: 978-3-95636-481-5
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2015
Zugl. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Bachelorarbeit, 2013
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2015
Printed in Germany
Kurzzusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
Kurzzusammenfassung ... IV
Abbildungsverzeichnis ... V
Tabellenverzeichnis ... VI
Abkürzungsverzeichnis ... VII
1
Motivation ... 1
2
Fragestellung ... 5
3
Vorgehensweise... 6
4
Hintergrund ... 9
4.1
Produktinformationen ... 9
4.2
Produktinformations-Management-Systeme ... 11
4.2.1
Definition ... 11
4.2.2
Abgrenzung zu weiteren Informations-Systemen ... 14
4.3
Wirtschaftliche Vorteile eines PIMS ... 18
4.3.1
Vorteile laut Anbieter ... 18
4.3.2
Vorteile laut Fachliteratur und Experten ... 20
5
Konstruktion und Durchführung der Online-Befragung ... 25
5.1
Clusteranalyse der Vorteile ... 26
5.2
Vollständiger Umfragebogen... 28
5.3
Vorgehensweise und Durchführung ... 28
6
Auswertung der Online-Befragung ... 29
6.1
Stichprobe ... 29
6.2
Ergebnisverteilung ... 33
6.2.1
Befragung zu den wirtschaftlichen Vorteilen ... 35
6.2.2
Kennzahlen oder Einschätzungen als Basis ... 41
6.2.3
Zufriedenheit mit PIMS ... 42
6.2.4
Kreuzanalyse ... 43
6.3
Gesamtinterpretation ... 45
6.3.1
Zusammenfassung der Interpretationen ... 45
6.3.2
Probleme mit PIMS ... 46
6.3.3
Eigene Interpretation ... 47
Kurzzusammenfassung
III
7
Ausblick und Implikationen ... 49
Literaturverzeichnis ... VII
Anhangsverzeichnis ... VII
Anhang A ... VIII
Anhang B ... IX
Anhang C ... XII
Anhang D ... XXI
Anhang E ... XXIV
Kurzzusammenfassung
IV
Kurzzusammenfassung
Diese Bachelorarbeit hat das Ziel, eine State of the Art-Analyse von Produktinformations-
Systemen zu erstellen. Es wird definiert, worum es sich bei einem PIM-System handelt
und welche Vorteile es einem Unternehmen ermöglichen kann. Durch eine eigens erstell-
te Online-Befragung wird das Eintreten dieser Vorteile in der Praxis überprüft.
Abbildungsverzeichnis
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Forschungsbild dieser Bachelorarbeit ... 6
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines PIMS ... 11
Abbildung 3: Wirkungsnetzwerk der Nutzenpotenziale des PIM ... 24
Abbildung 4: Branchenzugehörigkeit ... 29
Abbildung 5: Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen ... 30
Abbildung 6: Aktivitäten auf internationalen Märkten ... 31
Abbildung 7: Aktivitäten auf internationalen Märkten ... 31
Abbildung 8: PIMS Anbieter - Anteil ... 32
Abbildung 9: Anzahl der verwalteten Produkte ... 32
Abbildung 10: PIMS Motivation ... 33
Abbildung 11: Probleme mit PIMS ... 34
Abbildung 12: Einschätzung der Kostenvorteile ... 36
Abbildung 13: Einschätzung der Qualitätsvorteile ... 38
Abbildung 14: Einschätzung der Umsatzvorteile ... 40
Abbildung 15: Einschätzung der Zufriedenheit ... 42
Abbildung 16: Verschiedene Quellen von Produktinformationen ... VIII
Abbildung 17: Framework für die Nutzenargumentation des PIM ... XI
Abbildung 18: Umfragebogen Seite 1 ... XII
Abbildung 19: Umfragebogen Seite 2 ... XIII
Abbildung 20: Umfragebogen Seite 3 ... XIV
Abbildung 21: Umfragebogen Seite 4 ... XV
Abbildung 22: Umfragebogen Seite 5 ... XVI
Abbildung 23: Umfragebogen Seite 6 ... XVII
Abbildung 24: Umfragebogen Seite 7 ... XVIII
Abbildung 25: Umfragebogen Seite 8 ... XIX
Abbildung 26: Umfragebogen Seite 9 ... XX
Abbildung 27: Screenshot von ,,digitale ,,Wochenend" Wandzeitung" ... XXI
Abbildung 28: Screenshot von ,,Publishing Events" ... XXII
Abbildung 29: Screenshot von ,,Publishing Market Overview Master Data" ... XXIII
Abbildung 30: Kreuztabelle: Handel mit Mehrfachnutzung der Daten ... XXIV
Abbildung 31: Kreuztabelle: Handel mit Standardisierte Kommunikation in der SC .. XXIV
Abbildung 32: Kreuztabelle: Handel mit Überwiegend subjektive Einschätzung ... XXIV
Abbildung 33: Kreuztabelle: Produktion mit Überwiegend subjektive Einschätzung .. XXV
Abbildung 34: Kreuztabelle: Handel mit Eine schnellere Time-To-Market ... XXV
Abbildung 35: Kreuztabelle: Handel mit Eine Reduzierung von Übersetzungskosten . XXV
Tabellenverzeichnis
VI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Verschiedene Arten von Produktinformationen in der Literatur ... 9
Tabelle 2: Beispiele für Publikationskanäle ... 14
Tabelle 3: Synonym verwendete Begriffe ... 15
Tabelle 4: Begriffe im engen Kontext zu PIMS ... 16
Tabelle 5: Abgrenzung des PIMS zu ähnlichen IT-Bereichen ... 17
Tabelle 6: Zusammenfassung der versprochenen Vorteile von PIM-Systemen ... 27
Tabelle 7: Antworten zu den Kostenvorteilen ... 36
Tabelle 8: Antworten zu den Qualitätsvorteilen ... 39
Tabelle 9: Antworten zu den Umsatzvorteilen ... 40
Tabelle 10: Problemstellungen in den Firmen ... 46
Abkürzungsverzeichnis
VII
Abkürzungsverzeichnis
BVH
Bundesverband für den Versandhandel
CMP Cross-Media-Publishing
CMS Content-Management-System
CRM Customer-Relationship-Management
DMS Document-Management-System
ECM Enterprise-Content-Management
EDM Engineering-Data-Management
ERP Enterprise-Resource-Planning
IT
Informations-Technologie
MAM Media-Asset-Management
MDM Master-Data-Management
PCM Product-Content-Management
PDM Product-Data-Management
PIM Produktinformations-Management
PIMS Produktinformations-Management-System
PLM Product-Lifecycle-Management
PRM Partner-Relationship-Management
PRM Product-Resource-Management
ROI
Return on Investment
SAP
System-Analyse und Programmentwicklung (Softwarekonzern)
WCMS Web-Content-Management-System
WWS Warenwirtschaftssystem
Motivation
1
1
Motivation
Um die Motivation dieser Arbeit adäquat und verständlich darlegen zu können, bedarf es
einer kleinen Einführung über Produktinformations-Management-Systeme (PIMS). In Ka-
pitel 4 wird noch detaillierter erläutert werden, was ein PIMS ist. Diese kleine Einführung
soll es allerdings erleichtern, die Fragestellungen der Bachelorarbeit (siehe Kapitel 2) bes-
ser nachvollziehen zu können.
,,Ein Unternehmen mit 14 Marken und 800.000 Produkten verfügte im Jahr 2011
über rund 2,5 Millionen Medienobjekte." Dieses Zitat von Kräftner, CEO und Gründer der
celum GmbH
1
, verdeutlicht die Größe der Datenmenge an Produktinformationen, die Un-
ternehmen in der heutigen Zeit zu verarbeiten haben (Wollner 2012, S. 60).
Nicht allein die größer werdende Datenmenge stellt eine Aufgabe für die Unternehmen
dar, sondern auch die immer kürzer werdenden Zeitabstände zum Verarbeiten dieser
Daten. Einkauf, Vertrieb und Marketing liefern laufend neue Produktinformationen so
dass die Datenflut stetig steigt. Zudem sind diese Produktinformationen häufig nicht ein-
heitlich. Im Gegenteil, durch die Globalisierung müssen auch noch mehrere Sprachvarian-
ten aufbereitet werden. Hinzu kommen in der Regel CRM- und Warenwirtschaftssysteme,
welche weitere kunden- und produktbezogene Daten zur Verfügung stellen, die ebenfalls
in die Kommunikationsprozesse eingebunden werden müssen (Joachim 2012, S.80).
Dabei ist nicht in erster Linie die Datenflut an sich das Problem, sondern die damit ver-
bundene organisatorische Komplexität. Kürzere Produktlebenszyklen und starker Wett-
bewerbsdruck erfordern in der heutigen Wirtschaft eine kürzere ,,Time-to-Market" um
möglichst wenig gebundenes Kapital im Umlauf zu haben. Dies erfordert ein flexibles Re-
agieren (Joachim 2012, S. 80).
Nach Kräftner muss die Time-to-Market ,,so kurz wie möglich bleiben". Es gilt ,,die Menge
der Inhalte unter Kontrolle zu bringen", ein ,,bloßes Ordnen und Verwalten alleine ist je-
doch nur ein erster Schritt". Die Integration von PIMS ist u.a. ,,notwendig um spürbare
Effekte zu erzielen" (Wollner 2012, S. 61).
1
Die celum GmbH wird vom prokom report (4. Quartal 2012) als führender, unabhängiger Hersteller von
Digital Asset Management Software bezeichnet.
Motivation
2
Moderne Geschäftsmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass die Leistungserstellung im
Netzwerk erfolgt, dass der Anteil des Servicegeschäfts im Vergleich zu physischen Produk-
ten steigt und dass globale Märkte bedient werden (Kagermann und Österle 2006).
Für den Erfolg dieses Geschäftsmodells müssen nach Osl und Otto (2007, S. 35) sämtliche
Informationen ,,schnell verfügbar, vollständig, konsistent und fehlerfrei" sein, dies gilt
insbesondere für Produktinformationen.
Die Implementierung eines Produktinformations-Management-Systems wäre laut M.
Kräftner also eine Möglichkeit um die vielen genannten Herausforderungen erfolgreich
bewältigen zu können.
Erschiene einem angestellten Managers ein PIMS generell als geeignetes Instrument zur
Verwaltung seiner Produktinformationen, würde er die Recherche über Produktinforma-
tions-Management-Systeme beginnen. Zunächst würde er vermutlich nach wissenschaft-
lichen und neutralen Studien zu diesem Thema suchen, welche PIMS genauer analysiert
haben. So könnte es beispielsweise sein, dass die seitens der Anbieter versprochenen
wirtschaftlichen Vorteile durch Studien bereits bestätigt wurden.
Eine Internetrecherche am 23.01.2013 mit Google Scholar
2
ergab jedoch zum Thema
,,Product Information Management" gerade einmal 1.490 Treffer. Wird die Suche durch
jeweiliges Hinzufügen von Stichwörtern wie ,,Vorteile" (34 Treffer), ,,wirtschaftlich" (31
Treffer) oder ,,ROI" (112 Treffer) verfeinert, erhält man nur noch sehr wenige Treffer.
Nach Sichtung der Trefferergebnisse beschäftigt sich jedoch keine der betrachteten wis-
senschaftlichen Studien mit den wirtschaftlichen Vorteilen eines PIMS.
Um aufzuzeigen, dass dies nicht der Normalität in der IT Branche entspricht, war es in
diesem Fall ratsam, diese Recherche erneut durchzuführen. Diesmal wurde bei Google
Scholars nach den Stichwörtern ,,Enterprise Resource Planning" gesucht, wofür es 72.400
Treffer gab. Auch hier wurden zur Komplettierung des Vergleichs dieselben Stichworte
herangezogen. Aus dem Hinzufügen der Stichwörter ,,Vorteil" (2.640 Treffer), ,,wirtschaft-
lich" (2.850 Treffer) und ,,ROI" (14.200 Treffer) resultierte eine deutlich höhere Treffer-
quote.
2
Definition Google Scholar: ,,Google Scholar ist eine Suchmaschine des Unternehmens Google Inc. und
dient der allgemeinen Literaturrecherche wissenschaftlicher Dokumente. Dazu zählen sowohl kostenlo-
se Dokumente aus dem freien Internet als auch kostenpflichtige Angebote." (Quelle: Wikipedia 2013b)
Motivation
3
Das Ergebnis dieser Recherche wird durch Osl und Otto (2007, S. 36) untermauert: ,,Viele
Unternehmen stehen weiterhin vor dem Problem, dass der betriebswirtschaftliche Nut-
zen von PIM nicht transparent ist". Dies ist insbesondere dann verwunderlich, wenn PIMS
von solch wirtschaftlicher Bedeutung für ein Unternehmen sein sollte.
Es existieren zwar erste Ansätze zur Bewertung der wesentlichen Vorteile (Lucas-Nülle
2005), diese sind allerdings häufig ,,nicht auf die spezifische Situation des einzelnen Un-
ternehmens übertragbar und umfassen andererseits lediglich einzelne Ausschnitte der
gesamten Managementaufgabe des PIM."
Andere Quellen bieten ,,lediglich qualitative Aussagen" zum ROI einer PIM-Einführung
(Thomson 2006) oder sind ,,infolge mangelnder Transparenz über die Entstehung der
quantitativen Angaben nicht auf das eigene Unternehmen übertragbar" (Osl und Otto
2007, S.36).
Die Globalisierung der Wirtschaft sowie moderner Kommunikationstechnologien wie das
Internet, stellen für Unternehmen zusätzliche Herausforderungen dar. Es sollte theore-
tisch nur von Vorteil sein, neue Medienkanäle wie auch neue Märkte in fremden Ländern
zu bedienen, um das wirtschaftliche Wachstum des Unternehmens zu stabilisieren.
Die folgenden Punkte verdeutlichen die aktuelle Situation der E-Commerce Branche:
· ,,Der deutsche Versandhandel durchbrach 2010 erstmalig die 30-Milliarden-Euro-
Grenze. Der Bundesverband Versandhandel (BVH) errechnet für die Branche einen
Gesamtumsatz von 30,3 Mrd. EUR. Das Internet beflügelt das Wachstum in alle
Richtungen. Katalogversender verkaufen zusätzlich online, Internethändler eröff-
nen Geschäfte in Einkaufsstraßen und bisher rein stationäre Händler schaffen ihre
eigenen Shops im Netz." (Axel Springer Media Impact 2011, S. 2)
· Der Anteil des E-Commerce liegt laut Zahlen des BVH (Hütel 2012, S. 3) mit 18,3
Milliarden Euro bei 60% des Gesamtumsatzes und ist damit ein sehr wichtiger Um-
satzfaktor für die Unternehmen.
· Der Kunde ist nach Hütel (2012) ein sog. Channel-Hopper, das heißt dieser möchte
jederzeit die Möglichkeit haben, auf allen möglichen Vertriebskanälen einzukau-
fen.
Aktuelle Zahlen des EHI Retail Institute verdeutlichen die Situation rund um die neu ent-
stehenden Medienkanäle und zeigen Social Media als feste Größe im E-Commerce: ,,78
Motivation
4
Prozent der Online-Shops in Deutschland verfügten 2011 über eine Facebook-Seite."
(Kahyaoglu und Lucas-Nülle 2012, S. 14)
Nun stellt sich die Frage, wie man E-Commerce effektiv betreiben und gleichzeitig neue
Umsatzkanäle erarbeiten kann. Betrachtet man den Axel Springer Media Impact (2011, S.
4), so werden die ,,Multi-Channel-Versender dominieren". Multi-Channel-Vertrieb bedeu-
tet, dass Unternehmen ihre Produkte oder Dienstleistungen über verschiedene Vertriebs-
und Medienkanäle anbieten, wie über Internet, Kataloge und Ladengeschäfte.
Unternehmen könnten also durch neue Vertriebswege neue Wachstumsmöglichkeiten
erschließen. Gleichzeitig bleibt jedoch die Frage offen, wie diese strategische Option und
Neuausrichtung der Vertriebswege wirtschaftlich umsetzbar ist, wenn laut Schlotböller,
Konjunkturexperte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Unter-
nehmen permanent mit Kostendruck zu kämpfen haben. (ConMoto Consulting Group
2013).
Die PIM Industrie verspricht hierfür eine Lösung parat zu haben: ,,PIM ermöglicht es, alle
Datenquellen, die Produktinformationen enthalten, in einer zentralen Datenbank zusam-
menzuführen, sie dort zentral zu pflegen, zu verwalten und für crossmediale
3
Aktivitäten
zu nutzen." (Joachim 2012, S. 80)
Nach Aussagen verschiedener Anbieter von Produktinformations-Management-Systemen
(siehe Punkt 4.1), lässt sich damit schon heute der Workflow effektiver, effizienter und
flexibler gestalten. Zudem gebe es Möglichkeiten zur Kosteneinsparung und weitere wirt-
schaftliche Vorteile, versprechen die Anbieter von Produktinformations-Management-
Systemen (Siehe Kapitel 4). Werden diese Vorteile aber tatsächlich erreicht?
Die Motivation dieser Arbeit liegt somit in der Schließung dieses Forschungsdesiderates.
Methodisch wird dieses Ziel darin, die Wissenslücke mit einer wissenschaftlichen Arbeit
zu füllen. Mit Hilfe einer State of the Art-Analyse soll der PIMS-Markt erforscht und für
mehr Transparenz gesorgt werden. Hierzu gehören eine Online-Befragung sowie Exper-
teninterviews.
3
Definition crossmedial: ,,Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verknüpf-
te Kanäle." (Quelle:Dudenverlag 2013)
Fragestellung
5
2
Fragestellung
In dieser Bachelorarbeit geht es um die folgenden drei Fragestellungen:
A) Die erste Fragestellung beschäftigt sich mit dem Thema PIMS im Allgemeinen.
Es gilt zu klären, was unter dem Begriff Produktinformationen und Produktinfor-
mations-Management-System zu verstehen ist.
Zudem beschäftigt sie sich mit den wirtschaftlichen Vorteilen eines PIMS. Hier ist
es das Ziel, herauszufinden was betriebswirtschaftliche Vorteile eines PIMS sind,
wer diese verspricht und welche Auswirkungen diese haben sollen.
B) Die zweite Fragestellung beschäftigt sich mit der Wahrnehmung der Unternehmen
in Bezug auf die durch PIMS generierten wirtschaftlichen Vorteile. . Hierbei wird
betrachtet, wie Unternehmen diese Vorteile einschätzen.
Einzelne Fragen zu diesem Themengebiet lauten u.a.:
Können die Unternehmen, welche ein PIMS einsetzen, wirtschaftliche Vor-
teile wahrnehmen?
Sind die Unternehmen mit ihrem PIMS zufrieden?
C) Die dritte Fragestellung sucht nach einer Antwort auf die Frage, ob die verspro-
chenen wirtschaftlichen Vorteile eintreten und ob diese belegbar sind.
Diese Fragestellung splittet sich wiederum in folgende einzelne Fragen auf:
Können die Unternehmen, welche ein PIMS einsetzen, wirtschaftliche Vor-
teile nur subjektiv wahrnehmen oder durch Kennzahlen belegen?
Wie ist die Zufriedenheit mit PIMS?
Wo gibt es Probleme mit PIMS?
Vorgehensweise
6
3
Vorgehensweise
Abbildung 1 zeigt die Vorgehensweise zur Beantwortung der Fragestellungen aus Kapitel
2. Die einzelnen Fragestellungen (A, B und C) wurden hierbei in die Grafik implementiert,
zusätzlich wurde ein Bezug zur Gliederung hergestellt.
Abbildung 1: Forschungsbild dieser Bachelorarbeit
[Quelle: eigene Darstellung]
A) Anfangs wird definiert, was unter dem Begriff Produktinformationen zu verstehen ist.
Anschließend erfolgt eine Erläuterung eines Produktinformations-Management-Systems
und wie dieses charakterisiert wird. Die Definition ist nötig, da sich die PIMS-Lösungen der
Unternehmen sehr häufig unterscheiden. Zusätzlich erfolgt eine Abgrenzung zu ähnlichen
Software-Systemen.
Als nächstes folgt eine Recherche zum Thema ,,betriebswirtschaftliche Vorteile eines
PIMS". An dieser Stelle muss unterschieden werden zwischen wirtschaftlichen Vorteilen,
die durch eine Einführung eines PIMS im Unternehmen resultieren sollen (z.B. Kostenein-
Vorgehensweise
7
sparung durch Ressourceneinsparungen) und den funktionellen Features welches ein
PIMS laut den Systemanbietern zu bieten hat (z.B. die zentrale Datenspeicherung). Diese
Definitionen sind für das weitere Vorgehen und das Verständnis zum Thema Produktin-
formations-Management-Systeme essentiell.
Anschließend kommt es zum eigentlichen ersten Schritt der Vorgehensweise für Punkt A.
Unter dem Überbegriff Datengrundlage werden die wirtschaftlichen Vorteile und Ver-
sprechen der Systemanbieter zusammengetragen. Als Quellen dienen hierfür die Anbieter
von PIM-Systemen, Interviews mit Experten sowie Fachliteratur zum Thema Produktin-
formations-Management. Dieser Schritt bildet die Grundlage zur Beantwortung der bei-
den weiteren Fragestellungen aus Kapitel 2.
Für dieses Vorgehen werden allerdings bestimmte Kriterien festgelegt. So muss ein Exper-
te beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Jahren an Berufserfahrung auf diesem Ge-
biet mit sich bringen. Die festgelegten Kriterien werden im jeweiligen Kapitel erläutert.
Sind diese erfüllt, werden die Vorteile festgehalten und anschließend mit den Vorteilen
der anderen Quellen zusammengetragen.
B) Beim Übergang von Phase A zur Phase B erfolgt ein Zwischenschritt. Es wird eine Clus-
teranalyse der Vorteile durchgeführt. Dies stellt sich so dar, dass alle potentiellen wirt-
schaftlichen Vorteile, die ein hohes Maß an Ähnlichkeit aufweisen, zusammengefasst
werden. Die sukzessiven Schritte hierfür lauten Sammeln, Analysieren und Codieren. Was
unter einer Clusterbildung zu verstehen ist, wird in Kapitel 5 genauer erläutert.
Nachdem die Clusteranalyse eine fundierte Liste von 23 Vorteilen hervorgebracht hat,
kommt es zum nächsten Teilschritt der Phase B der Vorgehensweise. Diese Phase dient
vor allem der Beantwortung der zweiten Fragestellung B aus Kapitel 2, welche sich mit
der Befragung der Unternehmen bezüglich des Eintretens der Vorteile befasst.
Hierfür wird ein Fragebogen für die Online-Befragung konstruiert, welcher im nächsten
Teilschritt lanciert und durch dritte Personen kontrolliert und geprüft wird. Die fertige
Online-Befragung wird mit der Plattform Unipark von der Firma Questback aufgesetzt und
durchgeführt.
Anschließend wird eine Liste mit den Referenzkunden der Anbieter erstellt, welche kon-
taktiert und zur Teilnahme an der Befragung eingeladen werden. Das genauere Vorgehen
zu diesem Teilschritt wird in Kapitel 5 tiefgehender erläutert.
Vorgehensweise
8
C) Die dritte Phase der Vorgehensweise beschäftigt sich mit der Auswertung der generier-
ten Antworten. Diese Phase wird Aufschluss darüber geben ob sich Unternehmen über
ihre Vorteile bewusst sind oder ob es sogar Versprechungen seitens der PIMS-Anbieter
gegeben hat, welche evtl. nicht eintreffen könnten.
Die Auswertung der Befragung erfolgt in Kapitel 6. Hier werden die Ergebnisse der Befra-
gung durch eine statistische Häufigkeitsverteilung dargelegt. Zusätzlich werden Kreuzana-
lysen der Antworten mit Hilfe eines statistischen Programms durchgeführt um mögliche
Zusammenhänge aufzuzeigen.
Hintergrund
9
4
Hintergrund
4.1 Produktinformationen
Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich diese Bachelorarbeit dem Thema Produktinforma-
tions-Management-Systeme. Doch was sind Produktinformationen überhaupt? Wo ent-
stehen diese Daten und warum sind sie für unternehmensinterne und -externe Arbeits-
prozesse entscheidend?
Der Begriff Produktinformationen bezeichnet alle Informationen, die bei den einzelnen
Arbeitsschritten mit einem Produkt oder einer Dienstleistung in einem Unternehmen an-
fallen. Produktinformationen sind die ,,Basis des unternehmerischen Erfolges und liegen
in einem Unternehmen häufig nicht zentral gebündelt vor" (Lucas-Nülle 2005, S.9).
Tabelle 1: Verschiedene Arten von Produktinformationen in der Literatur
Quelle
Verschiedene Arten von Produktinformationen
Wackernagel
(2012)
Texte
Preise
Bilder
Produktmerkmale
Zusatzinformationen wie Handbücher und Montageanleitungen
Lucas-Nülle
(2005)
Produktbeschreibungen in unterschiedlichen Sprachen
Preise
Rabatte
technische Attribute
Produktbeziehungen zu anderen Produkten, Zubehör, Ersatzteilen
und Media Assets (Bilder, Dokumente)
[Quelle: eigene Darstellung]
Nach Dr. Noack (Noack 2006, S. 3) sind sie [die Produktinformationen] eine Notwendig-
keit, denn sie sind ,,sowohl für den Wertschöpfungsprozess selbst als auch für die erfolg-
reiche Vermarktung der Produkte unverzichtbar".
Ein Problem bezüglich dieser Informationen und den dazugehörigen wichtigen Daten wie
z.B. Produkteigenschaften und Übersetzungen in verschiedene Sprachen ist oft, dass die-
se mehrfach und in unterschiedlichen Versionen vorhanden sind (Wackernagel 2012, S.
4).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (PDF)
- 9783956364815
- ISBN (Paperback)
- 9783956368257
- Dateigröße
- 7.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – WI2
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Mai)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- PIM-System State of the Art-Analyse Produktinformations-System Online-Befragung
- Produktsicherheit
- Diplom.de