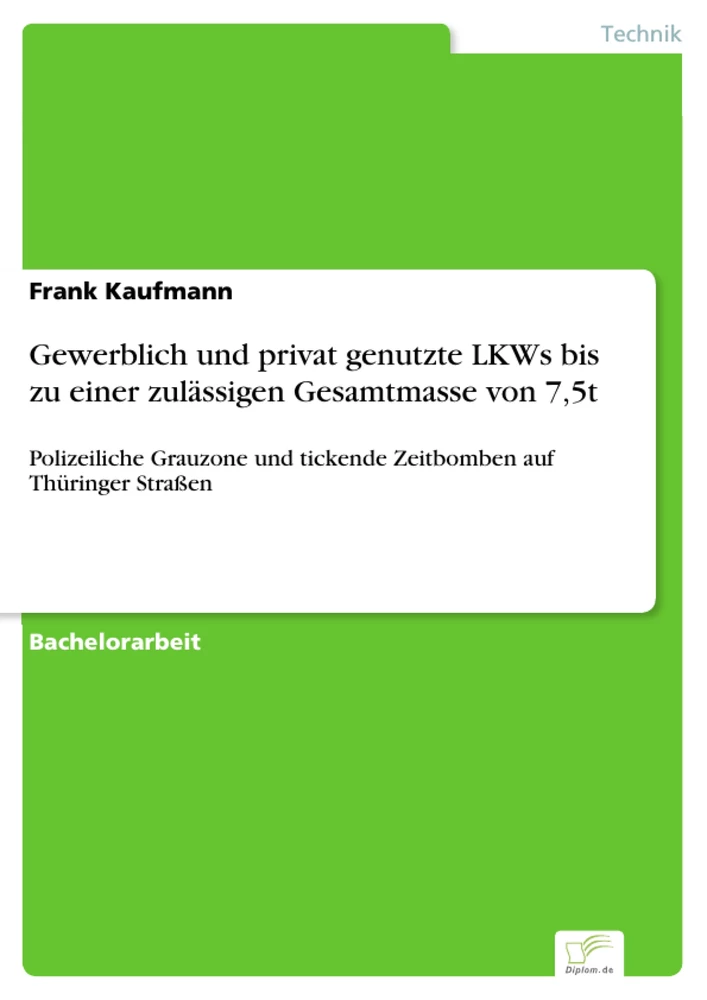Gewerblich und privat genutzte LKWs bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5t
Polizeiliche Grauzone und tickende Zeitbomben auf Thüringer Straßen
©2014
Bachelorarbeit
117 Seiten
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, dass die Polizeivollzugsbeamten des Freistaates Thüringen über die aktuell geltenden und zutreffenden Gesetze und Verordnungen im Bereich der zGM zwischen 2,8 t – 7, 5 t informiert werden und eine strukturierte Handlungsanweisung geschaffen wird, an die sich kontrollierende Beamte halten können. Generell wurden die Kapitel systematisch gegliedert, um für den Leser einen Stringenz einzuhalten und evtl. Fehlinterpretationen auszuschließen.
Zunächst wurde ein Überblick über die Kontrollorgane und die Aktualität der Thematik gegeben. Danach wurden die gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Zulassung von Personen erarbeitet. Es wurde aber auch über eine der neusten technischen Entwicklungen auf dem Lkw-Markt, dem Fleetboard, berichtet. Durch diese detaillierte Ausarbeitung soll dem Leser gezeigt werden, dass auch die Technologie stetigen Neuerungen und Wandlungen unterworfen ist. Im Folgenden wurde versucht einen Überblick über optisch erkennbare Mängel bezüglich der Reifen und der Bremsanlage an einem Kraftfahrzeug zu geben.
Durch die Arbeit wurden relevante Gesetze und Verordnungen ausführlich erklärt und der Leser über die aktuelle rechtliche Lage informiert. Allerdings wurde auch hier deutlich, dass das Thema Lkw-Kontrollen zwischen 2,8 t und 7,5 t zGM ein sehr komplexes Themengebiet ist, welches durch zahlreiche Verordnungen und Gesetze bestimmt wird. Im Ergebnis zeigte sich, dass dieser Bereich keine polizeiliche Grauzone darstellt, da es jedem Polizeibeamten möglich ist, sich über dieses Thema zu informieren. Jedoch bedarf dieser Themenkomplex einen großen Lernaufwand, um sich ein fundiertes Grundwissen anzueignen. Durch die jährlichen gesetzlichen Änderungen auf nationaler und internationaler Ebene und den technischen Neuentwicklungen muss der Polizeibeamte regelmäßig geschult und weitergebildet werden.
Nun wurde erstmals eine kompakte und aktuelle Quelle geschaffen, die den interessierten Beamten in Thüringen und anderen Bundesländern Informationen und eine Handlungsanweisung in die Hand gibt.
Zunächst wurde ein Überblick über die Kontrollorgane und die Aktualität der Thematik gegeben. Danach wurden die gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Zulassung von Personen erarbeitet. Es wurde aber auch über eine der neusten technischen Entwicklungen auf dem Lkw-Markt, dem Fleetboard, berichtet. Durch diese detaillierte Ausarbeitung soll dem Leser gezeigt werden, dass auch die Technologie stetigen Neuerungen und Wandlungen unterworfen ist. Im Folgenden wurde versucht einen Überblick über optisch erkennbare Mängel bezüglich der Reifen und der Bremsanlage an einem Kraftfahrzeug zu geben.
Durch die Arbeit wurden relevante Gesetze und Verordnungen ausführlich erklärt und der Leser über die aktuelle rechtliche Lage informiert. Allerdings wurde auch hier deutlich, dass das Thema Lkw-Kontrollen zwischen 2,8 t und 7,5 t zGM ein sehr komplexes Themengebiet ist, welches durch zahlreiche Verordnungen und Gesetze bestimmt wird. Im Ergebnis zeigte sich, dass dieser Bereich keine polizeiliche Grauzone darstellt, da es jedem Polizeibeamten möglich ist, sich über dieses Thema zu informieren. Jedoch bedarf dieser Themenkomplex einen großen Lernaufwand, um sich ein fundiertes Grundwissen anzueignen. Durch die jährlichen gesetzlichen Änderungen auf nationaler und internationaler Ebene und den technischen Neuentwicklungen muss der Polizeibeamte regelmäßig geschult und weitergebildet werden.
Nun wurde erstmals eine kompakte und aktuelle Quelle geschaffen, die den interessierten Beamten in Thüringen und anderen Bundesländern Informationen und eine Handlungsanweisung in die Hand gibt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
2
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
5
Abbildungsverzeichnis
8
Tabellenverzeichnis
9
1.
Einleitung
10
2. Aktualität des Themas ,,Lkw-Kontrollen"
12
3.
Zulassung
von
Personen
15
3.1
Fahrerlaubnisrechtliche
Bestimmungen
15
3.1.1 Führerscheinerfordernis und Erteilungsverfahren
15
3.1.2 Änderungen durch die 3. EU-Führerscheinrichtlinie 16
3.1.3 Relevante Fahrerlaubnisklassen und ihre
Besonderheiten 20
3.2 Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
23
3.2.1 Die 3. EU-Führerscheinrichtlinie,
die Führerscheinklasse C/CE und das BKrFQG
23
3.2.2 Entstehung, Ziele und grundsätzliche Überlegung
des
BKrFQG
24
3.2.3 Unterschied Weiterbildung/ Qualifikationspflicht-
Sonderfall
Besitzständler
28
3.2.3.1 Möglichkeiten und Ablauf der
Grundqualifikation
32
3.2.3.2 Die Weiterbildung von Berufs-
kraftfahrern
34
3.2.3.3 Dokumentationsmöglichkeiten der
Grundqualifikation und Weiterbildung
35
4.
Sozialvorschriften
im
Straßenverkehr
36
4.1
Historischer
Rückblick
36
4.2 Geltungs- und Anwendungsbereich
38
4.2.1 Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006
38
4.2.2 Das Fahrpersonalgesetz und die Fahrpersonal-
verordnung in Abgrenzung zum Arbeitszeitgesetz
39
4.2.3 Geltungsbereich der Sozialvorschriften
39
3
4.2.4 Begrifflichkeiten der Sozialvorschriften
40
4.2.5 Ausnahmen von den Sozialvorschriften
44
4.3.
Das
digitale
Kontrollgerät 45
4.3.1 Einbaupflicht und allgemeine Fakten
45
4.3.2 Erläuterung der Kartenarten
49
4.3.3 Besonderheiten im Umgang mit den Karten
54
4.3.4 Das ,,Fleetboard" als Optimierungssystem
56
4.3.5 Eichpflicht des EG-Kontrollgerätes
59
5. Ausrüstungs- und Beschaffenheitsmerkmale
61
5.1
Reifen
61
5.1.1 Allgemeine Fakten/ Erläuterung des Radialreifen
61
5.1.2 polizeipraktisches Wissen über verbaute Rad-/
Reifenkombinationen und die Ahndung von Verstößen
62
5.2
Bremsanlagen
65
5.2.1 Information zu den relevanten Bremssystemen
65
5.2.2 Zulässige und unzulässige
Mängel
an
Bremsscheiben
66
6.
Straßenverkehrsrechtliche
Bestimmungen
68
6.1
Ladungssicherung
68
6.1.1 Historische Entwicklung der
Thematik
Ladungssicherung
68
6.1.2 Allgemeine Fakten zu Ladungssicherung
68
6.1.3 Ladungssicherung als Bestandteil unterschiedlicher
Rechtsgebiete
70
6.1.4 Möglichkeit der Ladungssicherung und die
polizeiliche Ahndung von Verstößen
71
6.2
Lkw-Fahrverbote
73
7.
Güterkraftverkehrsgesetz
76
7.1.Unterscheidung Güterkraftverkehr /Werkverkehr
76
7.2 Innerdeutscher/ Nationaler Güterkraftverkehr
77
7.3 Güterkraftverkehr innerhalb der EU/EWR
78
7.4 Güterkraftverkehr mit Staaten außerhalb der EU/ EWR
80
8. Checkliste für die polizeiliche Praxis
82
4
8.1
Grundsätzliche
Überlegungen
82
8.2 Erarbeitung/ Anwendung der Checkliste
82
9.
Zusammenfassung 86
10.
Literaturverzeichnis
88
10.1
Literatur
88
10.2
Internet
89
11.
Anhang
97
Anlage A: Ausnahmen nach Artikel 3 der VO (EG) Nr. 561/2006
(Kfz
über
3.500
kg
zGM)
97
Anlage B: Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht gem. § 1 FPersV
im Bereich von 2,8 t 7,5 t zGM
99
Anlage C: Fahrzeuge die gem. § 18 FPersV von den
Sozialvorschriften
ausgenommen
sind
101
Anlage D: Muster einer Bescheinigung über berücksichtigungsfreie Tage 104
Anlage E: Muster eines Fahrtenbuches
105
Anlage F: Muster eines Vordrucks von Tageskontrollblättern
106
Anlage G: Foto eines Tiertransporters
107
Anlage H: Foto eines Gefahrguttransporters
107
Anlage I: Foto von ,,Big Bags"
108
Anlage J: Muster eines Antrages für eine Dauerausnahmegenehmigung 109
Anlage K: Tage in der BRD an denen Lkw-Fahrverbot besteht
111
Anlage L: Ausnahmen nach § 2 GüKG
112
Anlage M: Muster einer Anmeldung von Werkverkehr
114
Anlage N: Erlaubnisurkunde für den gewerblichen Güterverkehr
115
Anlage O: Muster einer Gemeinschaftslizenz
116
Anlage P: Muster einer CEMT-Genehmigung
117
5
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Abl.
Amtsblatt
ADR
Europäisches Übereinkommen über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
AETR
Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Personals
Alt.
Alternative
Anm.
Anmerkung
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
Art.
Artikel
BAG
Bundesamt
für
Güterverkehr
BKrFQG Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
BKrFQV
Verordnung zur Durchführung des Berufskraftfahrer-
Qualifikations-Gesetz
CEMT
französisch: Conférence Européenne des Ministres des
Transports
CoC
Certification
of
Conformity
DIN
Deutsche
Industrie
Norm
Ebd.
Ebenda
EG
Europäische
Gemeinschaft
entspr.
entsprechende
EU
Europäische
Union
EWG
Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft
EWR
Europäische
Wirtschaftsraum
f.
folgende
FE
Fahrerlaubnis
FeV
Fahrerlaubnisverordnung
FerReiseV
Ferienreiseverordnung
ff.
fortfolgende
FPersV Fahrpersonalverordnung
gem.
gemäß
6
ggf.
gegebenenfalls
GGVSEB
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt
GüKG
Güterkraftverkehrsgesetz
GüKGrKabotageV
Verordnung über den grenzüberschreitenden
Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr
h
Stunde/n
HU
Hauptuntersuchung
IHK
Industrie-
und
Handelskammer
i.O.
in
Ordnung
i.S.d.
im
Sinne
des/der
Kap.
Kapitel
KBA
Kraftfahrtbundesamt
KFZ
Kraftfahrzeug
KGPuG
Kontrollgruppe für gewerblichen Personen- und
Güterverkehr
Lkw
Lastkraftwagen
n.i.O.
nicht
in
Ordnung
NVA
Nationale
Volksarmee
o.g.
oben
genannte/n
o.O.
ohne
Erscheinungsort
OWi
Ordnungswidrigkeit
PBefG
Personenbeförderungsgesetz
PKW
Personenkraftwagen
pol.
polizeilich
Rn.
Randnummer
sog.
sogenannte/n
StGB
Strafgesetzbuch
StVG
Straßenverkehrsgesetz
StVO
Straßenverkehrsordnung
StVZO
Straßenverkehrszulassungsordnung
SZ
Schlüsselzahl
Tab.
Tabelle
7
u./o.
und/oder
UTC
Coordinated Universal Time
VDI
Verein
Deutscher
Ingenieure
Vgl.
Vergleiche
VO
Verordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
zGM
zulässige
Gesamtmasse
8
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Muster eines Kartenführerscheines
ab
19.01.2013
(Vorderseite)
17
Abbildung 2: Muster eines Kartenführerscheines
ab
19.01.2013
(Rückseite)
18
Abbildung 3: Zulassungsbescheinigung Teil 1
23
Abbildung 4: Rückseite Führerschein mit Eintragung SZ 95
31
Abbildung 5: Modell eines Fahrerqualifikationsnachweises
36
Abbildung 6: Digitaler Tachograf SE5000 Exakt der Firma Stoneridge
48
Abbildung 7: Muster einer Fahrerkarte (Vorderseite)
49
Abbildung 8: Muster einer Fahrerkarte (Rückseite)
50
Abbildung 9: Muster einer Unternehmenskarte (Vorderseite)
51
Abbildung 10: Muster einer Werkstattkarte (Vorderseite)
52
Abbildung 11: Muster einer Kontrollkarte (Vorderseite)
53
Abbildung 12: Abbildung der Funktionsweise ,,Fleetboard"
57
Abbildung 13: Darstellung der Anwendung des Fleetboardsystems
58
Abbildung 14: Einbauschild des EG-Kontrollgerätes
an
der
B-Säule
eines
KFZ
60
Abbildung 15: Bauprinzip eines Radialreifens
61
Abbildung 16: Musterkennzeichnung eines Reifens
63
Abbildung 17: Riefenbildung auf einer Scheibenbremse
66
Abbildung 18: Bremsscheibe mit ausgeprägten, aber zulässigen
Hitzehaarrissen
66
Abbildung 19: gerissene Bremsscheibe (unzulässig)
67
Abbildung 20: Fleckenbildung auf der Bremsscheibe
67
Abbildung 21: Zulässige Korrosion auf einer Bremsscheibe
68
Abbildung 22: Unzulässige Korrosion auf einer Bremsscheibe
68
9
Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: Fahrerlaubnisklassen, das dafür benötigte Mindestalter
und
ihre
Besonderheiten
20
Tabelle 2: Qualifikation von Fahrern durch Aus- und Weiterbildung
29
Tabelle 3: Wie erlangen Kraftfahrer ihre Qualifikation?
33
Tabelle 4: Rechtsfolgen mangelhafter Ladungssicherung
70
Tabelle 5: Kabotageland und die dafür zuständige BAG-Außenstelle
80
10
1.Einleitung
,,Kleintransporter verliert Rad samt Bremsscheibe auf der A 38
13.05.2013 - 14:08 Uhr Breitenworbis (Eichsfeld). Der 33-jährige Fahrer
eines slowakischen Kleintransporters musste Montag gegen 1 Uhr sein
Fahrzeug Mitten im Höllbergtunnel bei Breitenworbis auf der A 38 in
Richtung Göttingen abstellen. Es ging weder vor noch zurück, heißt es im
Bericht der Autobahnpolizei Thüringen.
Zuvor hatte der Kleintransporter das hintere linke Rad samt Bremsscheibe
verloren. Glücklicherweise wurde hierbei kein anderer Verkehrsteilnehmer
gefährdet, da die Autobahn zu dieser Zeit wenig befahren war. Aufgrund des
Pannenfahrzeuges musste ein Fahrstreifen im Tunnel gesperrt werden."
1
Laut dem Statistischen Bundesamt lag die Beförderungsmenge von Gütern im
Jahr 2012 bei rund. 4 Milliarden Tonnen im gewerblichen Güterverkehr. Davon
wurden ca. 70 % durch Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr transportiert. Im
Bereich des Transportvolumens durch KFZ im Straßenverkehr gab es im
Vergleich zum Jahr 2002 eine Steigerung von ca. 6,2 %.
2
Schlussfolgernd daraus wird das Gütertransportaufkommen und die
Gütertransportleistung sukzessive steigen und es werden zukünftig noch mehr
Güter auf den Straßen der BRD befördert. Auch in Thüringen, welches im
,,Herzen" der BRD liegt werden tagtäglich zehntausende Tonnen Güter durch
Kraftfahrzeuge befördert. Thüringen besitzt ein ca. 530 km großes Autobahnnetz,
welches die optimale Anbindung an die benachbarten Bundesländer garantiert.
Weiterhin sind Städte wie z.B. Jena und Erfurt große Produktionsstandorte für
weltweit agierende Wirtschaftsunternehmen wie Siemens und Jenoptik.
Bei der Güterbeförderung auf Straßen werden vor allem Kraftfahrzeuge mit einer
zGM > 7, 5 t benutzt. Jedoch zeigt sich in der Entwicklung der Neuzulassungs-
und Bestandszahlen des KBA eine anhaltende Steigerung der Kraftfahrzeuge,
welche in dem Bereich der zGM zwischen 2,8 t und 7,5 t liegen. Unternehmen
erkennen hierbei die ökonomischen und logistischen Vorteile der Benutzung von
Kleintransportern und kleineren Lkws beim Transport von Gütern. Im
1
Zentralredaktion Thüringer Allgemeine
2013
2
Vgl.
Statistisches Bundesamt 2014
11
Umkehrschluss zeigen vor allem TÜV-Mängelberichte und Nachrichten in was
für einem desolaten Zustand sich diese Kraftfahrzeuge oftmals befinden.
Problematisch weiterhin, dass in der Thüringer Polizei nur wenige Beamte mit der
Thematik ,, LKW-Kontrollen" handlungssicher vertraut sind.
Alle Polizeibeamten haben gem. § 36 V S. 1 StVO die Möglichkeit
Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten und zu
kontrollieren. Die polizeiliche Praxis in Thüringen zeigt jedoch, dass von diesem
Recht, Kraftfahrzeuge im Bereich der zGM von 2,8 t 7,5 t zu kontrollieren nur
selten gebrauch gemacht wird. Auf Nachfrage bei mehreren Polizeibeamten der
Landespolizeiinspektionen und Einsatzhundertschaften gaben diese an nur
Kraftfahrzeuge mit einer zGM < 2,8 t bzw. 3,5 t zu kontrollieren. Ein Grund dafür
kann vor allem die unübersichtliche und intransparente Darstellung der zahl- und
umfangreichen Gesetze und Verordnungen auf nationaler und europäischer Ebene
sein. Somit könnte sich hier eine polizeiliche Grauzone der Fahrzeugkontrolle im
Bereich der zGM von 2,8 t - 7,5 t erschließen. Ziel der Arbeit ist es, die
Polizeivollzugsbeamten des Freistaates Thüringen, aber auch anderer
Bundesländer mit der o.g. Thematik vertraut zu machen und zu sensibilisieren,
um bei Kontrollen handlungsfähig und sicher zu werden. Weiterhin soll eine
Checkliste erarbeitet werden, welche als praktische Handlungsanleitung bei einer
Fahrzeugkontrolle dient.
Die Kapitel dieser Arbeit werden in einzelne Segmente aufgeteilt. Anfangs wird
im Kapitel 2 auf die Kontrollorgane und statistische Erhebungen eingegangen. Im
Kapitel 3 werden die zutreffenden zulassungsrechtlichen Bestimmungen für
Personen näher erläutert. Es folgt im Kapitel 4 eine ausführliche Betrachtung der
Thematik Sozialvorschriften im Straßenverkehr und dem EG-Kontrollgerät. Im
Kapitel 5 wird auf zwei Besonderheiten der Beschaffenheitsmerkmale eines
Kraftfahrzeuges eingegangen, welche durch den Polizeibeamten optisch zu
kontrollieren sind. Kapitel 6 befasst sich mit der Problematik der
straßenverkehrsrechtlichen Betrachtung eines Kraftfahrzeuges und im Kapitel 7
werden die Bestimmungen des Güterkraftfahrverkehrsgesetzes erklärt.
Desweiteren wird im Kapitel 8 eine Checkliste erarbeitet, welche den Beamten als
12
Hilfsmittel dienen soll, um eine polizeitaktische und methodisch einwandfreie
Verkehrskontrolle in dem Bereich der o.g. zGM zu ermöglichen.
2. Aktualität des Themas ,,Lkw-Kontrollen"
In den Mitgliedsstaaten der EU/EG werden Kraftfahrzeuge auf zwei Wegen
bezüglich ihrer Verkehrssicherheit überprüft.
Gem. der dafür geltenden Richtlinien 2009/40/EG und 2010/48/EU sind die in
einem Staat der EU zugelassenen Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und
Sattelanhänger einer regelmäßigen technischen Überwachung zu unterziehen.
Dabei können die Mitgliedstaaten die Termine und Abstände für die technischen
Untersuchungen sowie die zu untersuchenden Punkte eigenständig festlegen. Hier
ist zu beachten, dass diese einzelstaatlichen Regelungen sowohl für inländische
wie auch für aus dem Ausland kommende Fahrzeuge gleichermaßen gelten.
3
In Deutschland wurden diese Richtlinie in nationales Recht durch § 29 StVZO
umgesetzt. Jeder Fahrzeughalter ist dazu verpflichtet in regelmäßigen Abständen
die Verkehrssicherheit seines in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeug oder
Anhängers von einem technischen Überwacher wie z.B. der DEKRA oder dem
TÜV überprüfen zu lassen.
Weiterhin wird die technische Sicherheit durch Unterwegskontrollen gem. der
Richtlinien 2000/30/EG und 2010/47/EU überwacht. Gem. § 3 I der Richtlinie
2010/47/EU führen diese Kontrollen die dafür zuständigen Behörden durch. In
Deutschland werden Kraftfahrzeuge durch die Polizei und das BAG gem. der
Richtlinie 2010/47/EU auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. Auch in
Thüringen wird dies durch die Landespolizei realisiert.
3
Vgl. WFEB e.V.
13
Die Thüringer Polizei besteht derzeit aus ca. 5300 Beamten, welche sich auf eine
Landespolizeidirektion, sieben Landespolizeiinspektionen und den nach
geordneten Stationen und anderen Behörden wie z.B. der Thüringer
Bereitschaftspolizei aufteilen. Grundsätzlich werden von diesen Beamten vor
allem Fahrzeugkontrollen in einem Bereich der zGM < 3,5 t durchgeführt. Einzig
und allein die Autobahnpolizeiinspektion und die drei nachgeordneten Stationen
führen Kontrollen bei Kraftfahrzeugen mit einer höheren zGM durch. Hierzu sind
speziell geschulte und ausgerüstete Kontrollgruppen geschaffen wurden.
Allerdings werden durch diese Beamten vorzugsweise Lkw mit einer zGM > 7,5
t einer Verkehrskontrolle unterzogen.
Was die polizeiliche Praxis oftmals an Mängeln feststellt, wird auch in den
jährlichen TÜV-Berichten bestätigt. Grundsätzlich ist das Sicherheitsniveau von
Nutzfahrzeugen in Deutschland sehr hoch. Dafür sorgt das System der
Kontrollinstitutionen wie oben beschrieben. Jedoch wurden durch die Experten
der Überwachungsorganisationen große Unterschiede bei der Mängelhäufigkeit
zwischen den einzelnen Gewichtsklassen festgestellt. Besonders mängelanfällig
sind demnach leichte Nutzfahrzeuge und Transporter bis 7,5 Tonnen. So stellen
die TÜV-Experten an 10,8 Prozent aller Kleintransporter bis zu 3,5 Tonnen nach
zwei Jahren erhebliche Mängel fest. Nach fünf Jahren müssen bereits 20,7 Prozent
dieser Minivans zuerst in die Werkstatt, bevor sie die HU-Plakette erhalten. In der
Klasse der Transporter bis 7,5 Tonnen fallen nach zwei Jahren 14,2 Prozent der
Fahrzeuge durch, nach fünf Jahren sind es 24,6 Prozent.
4
Eine Ursache der hohen Mängelquoten bei leichteren Nutzfahrzeugen ist die
mangelnde Wartung, wenn man bedenkt, dass sich Transporter und Kleinlkws
oftmals im Dauereinsatz befinden. Erkennt man nun vor allem die hohen
Geschwindigkeiten, die ein Transporter erreichen kann, sind besonders die hohen
Mängelquoten an Beleuchtung und Bremsen ein Sicherheitsrisiko für den
Straßenverkehr.
4
Vgl. TÜV Rheinland 2013
14
Weiterhin wird bei Kontrollen durch die Polizei festgestellt, dass sich vor allem
ausländische Fahrzeuge in einem schlechten Wartungszustand befinden, was
regelmäßig auch in den veröffentlichten Polizeiberichten zu lesen ist. Da es aber
keine genauen Statistiken über Mängel an ausländischen Fahrzeugen gibt, können
hierzu lediglich Mutmaßungen angestellt werden. Weiterhin wird es notwendig
sein, eine Betrachtung auf die relevanten Daten der gesamten BRD vorzunehmen,
da die o.g. Kraftfahrzeuggruppe bei ihren Fahrten mehrere Bundesländer
durchfährt. Außerdem muss der Zulassungsort des Kraftfahrzeuges nicht der
Einsatzort sein.
Aus den Bestandszahlen und den Neuzulassungen von den einzelnen
Fahrzeugmodellen lässt sich ableiten, dass vor allem die o.g. Fahrzeuggruppe
immer präsenter auf deutschen Straßen wird. So wird durch das KBA berichtet,
dass sich die Zahl der Neuzulassungen von LKW im Bereich bis 3,5 t zGM um 19
% vom Jahr 2010 zum Jahr 2011 steigerte. Zwischen 3,5 t und 7,5 t zGM lag die
Steigerung bei 11,7 %. Nach Angaben des KBA waren im Jahr 2012 1430744
Kraftfahrzeuge der o.g. Gruppe in Deutschland als PKW zugelassen. Im Jahr
2013 waren es schon 1475148 Fahrzeuge und somit kam es zu einer Veränderung
von + 3,1 % in diesem Gewichtssegment.
5
Generell zeigt sich, dass die Frequentierung auf deutschen und auch Thüringer
Straßen durch Kraftfahrzeuge stetig steigt. Jedoch bestehen Probleme bei der
Betrachtung der Gruppe von Fahrzeugen bezüglich der Neuzulassung. Die o.g.
Kraftfahrzeuggruppe wird durch das KBA nicht als eigenständige Gruppe erfasst,
sondern setzt sich aus 2 Gruppen zusammen. Einerseits Fahrzeuge bis 3,5 t zGM
und andererseits Kraftfahrzeugen zwischen 3,5 t und 7,5 t zGM. Weiterhin ist es
entscheidend, ob ein Fahrzeug als Pkw oder Lkw zugelassen wurde und somit in
eine andere Gruppe eingeordnet wird.
5
Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt
1
15
3. Zulassung von Personen
3.1. Fahrerlaubnisrechtliche Bestimmungen
3.1.1 Fahrerlaubniserfordernis und Erteilungsverfahren
Wer im öffentlichen Verkehrsraum, unbeachtet davon ob es sich um den
tatsächlich oder rechtlich öffentlichen Verkehrsraum handelt, ein Kraftfahrzeug
führt, bedarf gem. § 2 I StVG einer Erlaubnis. Diese Maßgabe wird im § 4 I FeV
konkretisiert. Ausnahmen hierzu werden im § 6 StVG genannt und im § 4 I Nr.
1-3 FeV abschließend aufgeführt. Um in den Besitz einer Erlaubnis zum Führen
eines Kraftfahrzeuges zu kommen, müssen gewisse Anforderungen erfüllt
werden, welche im § 2 II StVG definiert sind. Konkretisierungen dazu finden sich
unter der Thematik ,,Vorraussetzungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis" in
den §§ 7- 20 der FeV. Diese Vorraussetzungen reichen von einem ordentlichen
Wohnsitz in Deutschland, einem Mindestalter bis hin zu einer von einem Arzt
attestierten geistigen- und körperlichen Tauglichkeit des Bewerbers. Nach
Ablegen und Bestehen einer schriftlichen und praktischen Prüfung wird dem
Fahrschüler eine Fahrerlaubnis gem. § 4 II S. 1 FeV erteilt. Durch eine amtliche
Bescheinigung, dem sogenannten Führerschein, wird diese Erlaubnis in
schriftlicher Form nachgewiesen. Die Erlaubnis muss gem. §4 II S.2 FeV beim
Führen eines KFZ mitgeführt werden und bei Verlangen zur Prüfung den
zuständigen Personen ausgehändigt werden.
Mitzuführen ist dabei das Originaldokument, Kopien oder beglaubigte
Ablichtungen genügen dabei nicht.
6
Zuständige Personen sind dabei vor allem Polizeivollzugsbeamte der Länder und
des Bundes. Aushändigen heißt, dass das Dokument händisch dem
kontrollierenden Beamten übergeben wird, sodass dieser es überprüfen kann.
7
6
Vgl. Huppertz 2013, S. 87
7
OLG Saarbrücken, VRS 47, 474 (=StVE §4 StVZO- alt, Abs. 2); Jagow, § 4 FeV, RN 6c
16
Es genügt nicht, den Führerschein zur Einsichtnahme vorzuzeigen.
8
Die Bundesrepublik Deutschland führte entsprechend der Zweiten EG-
Führerscheinrichtlinie den Scheckkartenführerschein gem. Muster 1 der Anlage 8
zu §§ 25 I, 26 I, 48 III FeV als einzig zulässiges Dokument ein.
9
Alte Führerscheine behalten bis zu ihrem Umtausch jedoch ihre Gültigkeit. Diese
Regelung betrifft sowohl den ,,grauen Lappen", aber auch den rosafarbenen
Führerschein, welcher der 1. EG-Führerscheinrichtlinie entspricht. Eingeschlossen
sind dabei auch die DDR-Führerscheine und die von der NVA
10
ausgegeben
Dokumente.
11
3.1.2 Änderungen durch die 3. EU-Führerscheinrichtlinie
Im Dezember 2006 wurde die 3. EU-Führerscheinrichtlinie veröffentlicht und ist
gem. der deutschen Regelung ab dem 19.01.2013 in Deutschland umzusetzen.
Grundsätzliche Überlegung für ein neues Führerscheindokument bestand darin,
dass zwischenzeitlich in den Mitgliedsstaaten diverse neue
Führerscheindokumente als gültig anzuerkennen sind. Außerdem traten weitere
Staaten der Europäischen Union bei und somit entstand Handlungsbedarf seitens
der EU ein neues, einheitliches Führerscheindokument einzuführen. Unter
anderem wurde seitens ausländischer Kontrollorgane immer wieder bemängelt,
dass die Lichtbilder, welche von dem Führerscheininhaber auf dem Führerschein
aufgeklebt sind, des Öfteren nicht mehr zu erkennen sind. Dies stellt durchaus
einen begründeten Mangel dar, wenn man sich überlegt, dass die Bilder 13 Jahre
(rosa Dokument) bzw. über 25 Jahre alt sein können. In etlichen EU-Staaten
werden aufgrund dieses Mangels Bußgelder verhängt. Weiterhin war allgemein
bekannt, dass der bis dahin gültige Kartenführerschein der 2. EU-
8
Vgl. Hentschel, §4 FeV, RN 11; Bouska/Laeverenz, §4 FeV, RN 8
9
Vgl. Rebler/ Huppertz 2007, S. 422.
10
NVA= Nationale Volksarmee
11
Rili 80/1263/EWG des Rates vom 04.12.1980
17
Führerscheinrichtlinie nur bei Verlust erneuert werden musste. Jedoch bestand
keine Notwendigkeit der regelmäßigen Erneuerung bei den nicht befristeten
Fahrerlaubnisklassen (PKW und Motorradklassen). Im Rahmen der 3. EU-
Führerscheinrichtlinie wird hierfür eine Frist von 15 Jahren gesetzt. Führerscheine
mit befristeten Klassen gelten allgemein für 5 Jahre, was der Befristung der
Klasse entspricht. Seitens der EU wurde die Vorgabe gegeben, dass alle bis dahin
gültigen nationalen Führerscheine, einbezogen der bis zum 18.01.2013
ausgestellten Kartenführerscheine, bis zum 19.01.2033 umgetauscht werden sein
müssen.
12
Abb. 1: Muster eines Kartenführerscheines ab 19.01.2013 (Vorderseite)
13
12
Vgl. Kreis Unna 2012, S. 1 ff.
13
Ebd.
18
Abb. 2: Muster eines Kartenführerscheines ab 19.01.2013 (Rückseite)
14
Von praktischer Relevanz bei der Kontrolle der Fahrerlaubnis sind hierbei die
Eintragungen des Gültigkeitsdatums des Führerscheins unter Nummer 4b (Abb.
1). Weiterhin wird die Spalte 11 von großer Wichtigkeit sein (Abb.2), da hier das
Datum des Ablaufs der jeweiligen Klasse vermerkt ist. Fahrzeuge dieser Klasse(n)
dürfen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geführt werden. Der Führerschein ist zu
erneuern, da das Dokument ebenfalls ungültig geworden ist.
Die Erteilung eines Führerschein stellt einen Verwaltungsakt i.S.d. § 35 VwVfG
dar. Aufgeführte Auflagen und Beschränkungen sind Nebenbestimmungen dieses
Verwaltungsaktes gem. § 36 VwVfG.
15
Diese werden im Scheckkartenführerschein in codierter Form, den
Schlüsselzahlen, nach näherer Maßgabe der Anlage 9 FeV eingetragen.
16
Auflagen sind dabei grundsätzlich als eigenständige Verwaltungsakte anzusehen,
daraus resultiert, dass bei einem Zuwiderhandeln gegen die Auflage der ,,Rest-
Verwaltungsakt" nicht berührt wird. Es wurde durch die Nicht-Beachtung der
Auflage eine Ordnungswidrigkeit begangen. Die Beschränkung hingegen ist ein
immanenter Bestandteil des Grundverwaltungsaktes, sprich dem Führerschein.
14
Ebd.
15
Vgl. Huppertz 2008, S.1
16
Vgl. iportale GmbH, S. 1 ff.
19
Daher verliert der Betroffene bei Zuwiderhandeln gegen eine
fahrerlaubnisrechtliche Beschränkung seine Fahrerlaubnis. Es wurde ein Fahren
ohne Fahrerlaubnis i.S.d. § 21 StVG begangen. Bei den o.g. Beschränkungen
handelt es sich um Verpflichtungen gegenüber dem Kraftfahrzeugführer, nur
bestimmte KFZ oder nur ein solches KFZ zu führen, welches mit bestimmten,
näher beschriebenen Einrichtungen ausgerüstet ist. Diese sollen die Bedienung
des KFZ ermöglichen oder erleichtern, um damit das KFZ sicher Fortbewegen zu
können.
17
Beschränkungen, Auflagen und Zusatzangaben, die für alle erteilten
Fahrerlaubnisklassen gelten, sind in der letzten Zeile des Feldes 12 unter den
Spalten 9 bis 12 zu vermerken (Abb. 2). Die Schlüsselzahlen der Europäischen
Union bestehen aus zwei Ziffern, den so genannten Hauptschlüsselzahlen.
Unterschlüsselungen bestehen aus einer Hauptschlüsselzahl (erster Teil) und zwei
Ziffern u./o. Buchstaben (zweiter Teil). Beide Teile sind durch einen Punkt
getrennt. Nationale Schlüsselungen bestehen aus drei Ziffern und gelten nur im
Inland. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jeder Inhaber eines
Führerscheins über die Bedeutung der Schlüsselzahlen bei der Ausstellung des
Dokuments hinreichend informiert wurde.
18
Weiterhin sollten innerhalb der Polizeikontrolle folgende Punkte überprüft
werden:
1. Herstellungsdatum der Karte (Abb. 1, Nr. 4a, Vorderseite)
2. Erteilungsdatum der Fahrerlaubnis (Abb. 2, Spalte 10, Rückseite)
3. Ausstellungsdatum bzw. Aushändigungsdatum des Führerscheins (Abb.
2, Nr. 14, Rückseite)
19
17
Vgl. Huppertz 2008, S.1
18
Vgl. TÜV Nord 2013, S. 1
19
Vgl. Rebler/ Huppertz 2007, S. 422 ff.
20
3.1.3 Relevante Fahrerlaubnisklassen und ihre Besonderheiten
Durch die 2. EG-Führerscheinrichtlinie wurde eine tiefgreifende
Umstrukturierung der Hauptklassen im Vergleich zum ,,alten Führerschein"
vorgenommen und die Klassen A, B/BE, C/CE, D/DE und die fakultativen
Unterklassen A1, B1, C1/C1E und D1/D1E einheitlich in allen EU-/EG-
Mitgliedsstaaten eingeführt.
20
Im Rahmen der 3. EU-Führerscheinrichtlinie wurden weitere Veränderungen der
Klassen vorgenommen, z.B. die Klassen M, S wurden durch die Klasse AM
ersetzt.
Für den Bereich von 2,8 t - 7,5t zGM gab es keine Klassenänderungen.
Die Erteilung der Fahrerlaubnisklassen wird entweder befristet oder unbefristet
durchgeführt. Die Geltungsdauer der Klassen AM, A1, A2, A, B, BE, L und T ist
an keine Frist gebunden. Alle nicht aufgeführten Klassen, ausgeschlossen C1 und
C1E, unterliegen einer Frist von 5 Jahren. Die Klassen C1, C1E werden bis zum
vollendeten 50. Lebensjahres erteilt. Werden die Klassen erst nach der
Vollendung des 45. Lebensjahres erteilt, gilt eine Befristung auf 5 Jahre.
21
In dem o.g. Massebereich werden folgende Fahrerlaubnisklassen von Relevanz
sein.
Tabelle 1: Fahrerlaubnisklassen, das dafür benötigte Mindestalter und ihre
Besonderheiten
22
Klasse
(eingeschlossene
Klassen)
weitere Bedingungen
Mindestalter
(gesetzliche
Ausnahmeregel-
ungen)
B
(AM, L)
Kraftfahrzeuge (ausgenommen Klassen
AM, A1, A2 und A) mit einer
zulässigen Gesamtmasse von nicht
mehr als 3.500 kg, die zur Beförderung
18 Jahre
(17 Jahre
begleitetes
Fahren, § 48a
20
Vgl. Ebd.
21
Vgl. Kreis Unna 2012, S. 1 ff.
22
Vgl. Hochsauerlandkreis
21
von nicht mehr als acht Personen außer
dem Fahrzeugführer ausgelegt und
gebaut sind
-Anhänger bis 750 kg zulässig
-Anhänger über 750 kg zulässig, wenn
die Gesamtmasse (Anhänger und
Zugfahrzeug) 3500 kg nicht übersteigt
Klasse B mit Schlüsselzahl 96
Zugfahrzeug der Klasse B in
Kombination mit einem Anhänger mit
einer zulässiger Gesamtmasse des
Anhängers von mehr als 750 kg und
zulässigen Gesamtmasse der
Fahrzeugkombination von mehr als
3500 kg und nicht mehr als 4250 kg
FeV)
BE
Kombination: Zugfahrzeug Klasse B
und Anhänger oder Sattelanhänger,
wenn die zulässige Gesamtmasse des
Anhängers oder Sattelanhängers 3.500
kg nicht überschreitet
- Kombination bis 7.000 kg möglich
18 Jahre
(17 begleitetes
Fahren, § 48a
FeV)
C1
Kraftfahrzeuge (ausgenommen Klassen
AM, A1, A2 und A) mit einer
zulässigen Gesamtmasse von mehr als
3.500 kg, aber nicht mehr als 7.500 kg,
die zur Beförderung von nicht mehr als
acht Personen außer dem
Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut
sind
Anhänger bis 750 kg zulässig
18 Jahre
(gewerbliche
Nutzung als BKF
erst ab 21 Jahre)
C1E
Kombination aus einem Zugfahrzeug
der Klasse C1 und einem Anhänger
oder Sattelanhänger von mehr als 750
kg, sofern die zulässige Gesamtmasse
der Fahrzeugkombination 12.000 kg
nicht übersteigt.
B und einem Anhänger oder
Sattelanhänger mit einer zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg,
sofern die Gesamtmasse der
Kombination 12.000 kg nicht
übersteigt
Mindestalter:
18 Jahre
(gewerbliche
Nutzung als BKF
erst ab 21 Jahre)
C
(C 1)
Kraftfahrzeuge (ausgenommen Klassen
AM, A1, A2 und A) mit einer
zulässigen Gesamtmasse von mehr als
21 Jahre
(18 Jahre bei
gewerblicher
22
3.500 kg, die zur Beförderung von
nicht mehr als acht Personen außer
dem Fahrzeugführer ausgelegt und
gebaut sind
Anhänger bis 750 kg zulässig
Nutzung als
BKF)
CE
Kombination: Zugfahrzeug der Klasse
C und Anhänger oder Sattelanhänger
über 750 kg
21 Jahre
(18 Jahre bei
gewerblicher
Nutzung als
BKF)
Weiterhin ergibt sich durch die europäische Neuregelung im Bereich der
Führerscheinklasse B und C1E eine Besonderheit. Nach Maßgabe der 2. EU-
Führerscheinrichtlinie musste der Fahrer immer noch die Fahrzeugpapiere zu Rate
ziehen, um feststellen zu können, ob er die Kombination fahren darf. Hier bestand
bis zum 18.01.2013 noch die Einschränkung, dass die zGM des Anhängers nicht
die Leermasse des Zugfahrzeuges überschreiten darf. Weiterhin darf die
Gesamtmasse der Kombination die 3,5 t bzw. bei C1E die 12 t-Grenze nicht
überschreiten. Wer die Fahrerlaubnisklasse ab dem 19.01.2013 erworben hat,
muss nun lediglich prüfen, ob die Gesamtmasse der Kombination 3,5 t bzw. 12 t
nicht überschreitet, natürlich nur unter Berücksichtigung dessen, dass das
Zugfahrzeug keiner höhere zGM als 3,5 t bzw. 7,5 t hat.
23
Für die polizeiliche Praxis werden in der Regel alle notwendigen Informationen
zu Massen (Feld 2. Abb. 3) und Maßen aus der Zulassungsbescheinigung Teil 1
abzulesen sein.
23
Vgl. Kreis Unna 2012, S. 1 ff.
23
Abb. 3: Zulassungsbescheinigung Teil 1
24
Die häufig benannte zulässige Gesamtmasse wird dabei aus der Summe des
Leergewichtes und der möglichen Nutzlast eines Fahrzeuges definiert. Somit lässt
sich für den handelnden Polizeibeamten ohne größere Schwierigkeiten die
benötigte Führerscheinklasse festlegen.
25
3.2 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
3.2.1 Die 3. EU-Führerscheinrichtlinie, die Führerscheinklasse C/CE und das
BKrFQG
Durch die Einführung der 3. EU-Führerscheinrichtlinie sind zusätzliche
Besonderheiten eingetreten, z.B. wird das Mindestalter für den Erwerb der
Fahrerlaubnis C/CE von vorher 18 Jahren auf 21 Jahre angehoben. Nur wer
vorher volljährig wurde und den Führerscheinantrag bei der zuständigen Behörde
gestellt hat, konnte bereits mit 18 Jahren die Fahrerlaubnis der Klasse C/CE
erwerben. Wurde nur die Klasse C vor dem Stichtag beantragt, die Klasse CE erst
später, gilt für die Klasse CE das Mindestalter von 21 Jahren. Nach wie vor gelten
24
Rode/Römer
25
Hentschel/König/Dauer, Rn. 5 zu §34 StVZO
24
bei der gewerblichen Güterbeförderung die Vorgaben des BKrFQG. Das heißt,
dass man zusätzlich zur Fahrerlaubnis der Klasse C, CE oder C1E die
Grundqualifikation im Sinne des BKrFQG nachweisen muss, die Besonderheiten
dieses Gesetzes werden anschließend in dieser Arbeit abgearbeitet. Die
Altersgrenze von 18 Jahren bleibt künftig bestehen, wenn
der
Fahrschüler die Grundqualifikationsprüfung nach § 4 Absatz 1 Nr. 1 BKrFQG
ablegt hat, also eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer, zur Fachkraft im
Fahrbetrieb oder in einem vergleichbaren Beruf absolviert oder die große Prüfung
bei der IHK bestanden hat. Mit der beschleunigten Grundqualifikation dürfen
Personen zwischen 18 und 21 Jahren nur Kraftfahrzeuge und Kombinationen der
Klassen C1 und C1E fahren.
26
3.2.2 Entstehung, Ziele und grundsätzliche Überlegung des BKrFQG
Schon vor der Überlegung einer solchen Vorschrift gab es Regelungen auf
europäischer Ebene, welche aber kaum dazu beitrugen die europäischen
Zielvorgaben bzgl. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kraftfahrer zu
erreichen. Der europäische Rat sah somit akuten Handlungsbedarf und führte im
Jahr 2003 die Richtlinie 2003/59/EG ein. Die schon bestehende Verordnungen
(EWG) Nr. 3820/85 und die Richtlinie 91/439/EWG des Rates wurden verändert
und die Richtlinie 76/914/EWG wurde aufgehoben. Die Gründe für die
Einführung einer solchen Vorschrift auf europäischer Ebene waren sehr vielfältig.
Zum einen sollte Art. 5 I, II, IV der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 (4)
Rechnung getragen werden. Darin ist vorgesehen, dass bestimmte im
Güterverkehr eingesetzte Fahrer in Abhängigkeit von ihrem Alter, der benutzten
Fahrzeugklasse oder von der Länge der Fahrstrecke Inhaber eines besonderen
Befähigungsnachweises sein müssen. Das dabei angestrebte Mindestniveau des
Fahrers sollte im Mindestmaß Richtlinie 76/914/EWG (5) entsprechen. Weiterhin
galt die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 nur für sehr wenige Fahrzeugführer.
Eine obligatorische Berufsausbildung von Berufskraftfahrern bestand nur in
26
Vgl. Verkehrsrundschau 2012
25
wenigen Mitgliedsstaaten und somit übte die Mehrheit der tätigen
Berufskraftfahrer ihren Beruf auf Grundlage ihres Führerscheins aus. Weiterhin
bestand der Bedarf, den Berufskraftfahrern die Möglichkeit zu geben, sich auf die
wachsenden Anforderungen in Bezug auf den Kraftverkehrsmarkt einzustellen,
unbeachtet davon, ob sie ihren Beruf als Selbstständige oder als Arbeitnehmer im
gewerblichen Güter oder Werkverkehr ausüben. Die neue Vorschrift sollte die
Qualität des Berufes ,,Kraftfahrer" in Form einer Qualifikation, sowohl für die
Aufnahme als auch die Ausübung sichern. Des Weiteren sollten die wesentlichen
Kenntnisse im Zusammenhang mit dem ausgeübten Beruf in regelmäßigen
Intervallen aufgefrischt werden. Eine weitere Überlegung war, dass ungleiche
Wettbewerbsbedingungen vermieden werden sollten. Die eingeführte Richtlinie
gilt deshalb sowohl für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, als auch für
Staatsangehörige eines Drittlandes, welche von einem im Mitgliedsstaat
niedergelassenen Unternehmen beschäftigt bzw. eingesetzt werden.
27
Der Gesetzgeber erhoffte sich durch diese verpflichtende Qualifizierung die
Ausbildung eines defensiven Fahrstils mit niedrigerem Kraftstoffverbrauch,
daraus resultierend die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr und einen
gemeinsamen Bildungs- und Ausbildungsstand innerhalb der EU. Die Umsetzung
der Überlegungen, mit den genannten Zielen erfolgte in Deutschland durch die
Einführung des Gesetzes ,,Gesetz über die Grundqualifikation und Weiterbildung
der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder Personenverkehr"
am 14.08.2006. Das Gesetzt trat am 01.10.2006 in Kraft. Ergänzende
Bestimmungen finden sich dabei in der BKrFQV, welche ebenfalls am
01.10.2006 in Kraft trat. Weiterhin ergeben sich Zuständigkeitsverordnungen der
Länder. In den Bundesländern wird darin die Zuständigkeit der unteren
Verkehrsbehörden (Stadt- und Landkreise) für:
1. die Erteilung der Bescheinigung über den Erwerb der Grundqualifikation
oder die Weiterbildung
27
Vgl. Abl. Nr. L226 v. 10/09/2003 S. 0004-0017
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (PDF)
- 9783956364396
- ISBN (Paperback)
- 9783956367830
- Dateigröße
- 6.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Meiningen
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 12,4 Punkte
- Schlagworte
- Gesetz Verordnung LKW Thüringen Fleetboard LKW-Krontrolle
- Produktsicherheit
- Diplom.de