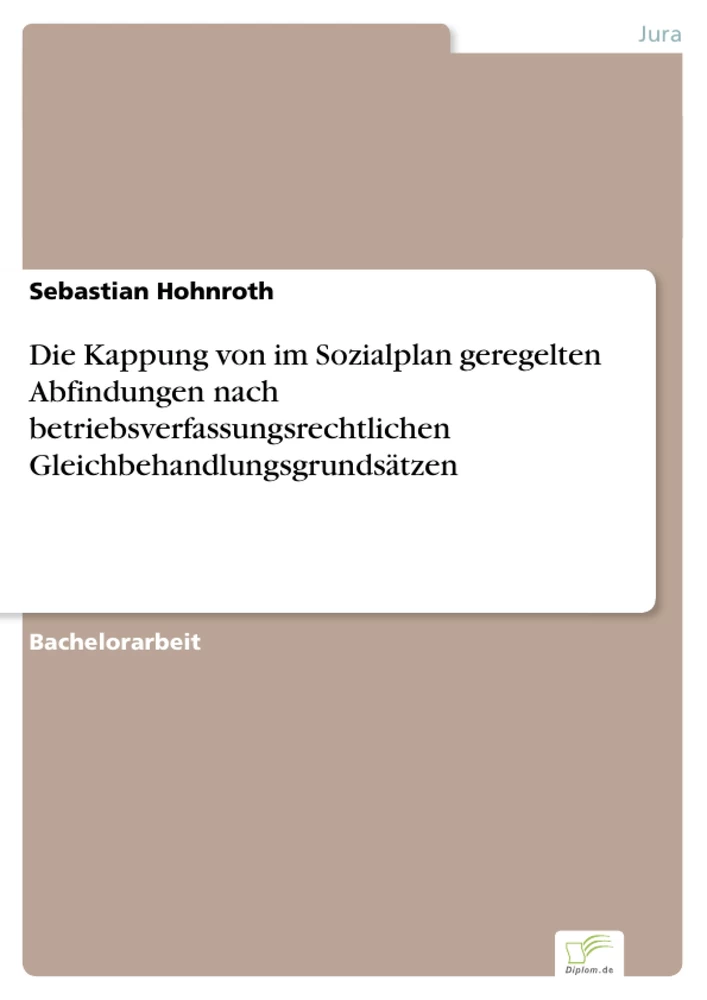Die Kappung von im Sozialplan geregelten Abfindungen nach betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsätzen
©2015
Bachelorarbeit
65 Seiten
Zusammenfassung
Der Unternehmer und seine Beschäftigten verfolgen in der Regel konträre Ziele. Auf der einen Seite stellt sich der Unternehmer mit seinen Produkten oder Dienstleistungen den Herausforderungen des Marktes mit meist vorrangigen monetären Zielen wie der Gewinnmaximierung. Der Arbeitnehmer hingegen ist primär an der Sicherstellung seiner Erwerbstätigkeit durch dauerhafte Beschäftigung im Unternehmen interessiert.
Dennoch gibt es mannigfaltige auf das Unternehmen einwirkende Schwierigkeiten, welche die unternehmerische Tätigkeit nachhaltig beeinflussen können. Sie beruhen oftmals auf der Tatsache, dass die bei Unternehmensgründung geplante, möglichst erfolgreiche Zielsetzung nicht (mehr) mit der tatsächlichen Unternehmensentwicklung korreliert. Dies kann schlimmstenfalls zu einer Insolvenz des Unternehmens führen.
Die Konsequenzen können sowohl für den Unternehmer als auch für seine Beschäftig-ten folgenschwer sein. So führt z.B. die Beendigung des Betriebes häufig dazu, dass alle Arbeitnehmer entlassen werden. Diese sogenannte Betriebsänderung unterliegt un-ter bestimmten Voraussetzungen dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Er hat mit dem Unternehmer über einen Sozialplan zu verhandeln mit dem Zweck, die wirtschaftlichen Nachteile für den Arbeitnehmer auszugleichen oder zumindest abzumildern.
Diese Sozialplanvereinbarungen unterliegen zudem den gesetzlichen Vorgaben nach § 75 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), welche den Betriebsparteien vorschreibt, eine Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer auszuschließen. Gleichzeitig sind Diskriminie-rungen der Arbeitnehmer nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu unterlassen. Dennoch eröffnen gesetzliche Regelungen den Betriebsparteien Mittel und Wege, um Vereinbarungen im Sozialplan treffen zu können, bei denen bestimmte Arbeitnehmergruppen eine Kürzung oder sogar den gänzlichen Ausschluss von Sozial-planansprüchen erfahren.
Ziel dieser Bachelor-Thesis ist es, die am häufigsten vorkommenden Kappungsmög-lichkeiten aufzuzeigen und diese anhand der gesetzlichen Ungleichbehandlungsverbote zu bewerten.
Dennoch gibt es mannigfaltige auf das Unternehmen einwirkende Schwierigkeiten, welche die unternehmerische Tätigkeit nachhaltig beeinflussen können. Sie beruhen oftmals auf der Tatsache, dass die bei Unternehmensgründung geplante, möglichst erfolgreiche Zielsetzung nicht (mehr) mit der tatsächlichen Unternehmensentwicklung korreliert. Dies kann schlimmstenfalls zu einer Insolvenz des Unternehmens führen.
Die Konsequenzen können sowohl für den Unternehmer als auch für seine Beschäftig-ten folgenschwer sein. So führt z.B. die Beendigung des Betriebes häufig dazu, dass alle Arbeitnehmer entlassen werden. Diese sogenannte Betriebsänderung unterliegt un-ter bestimmten Voraussetzungen dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Er hat mit dem Unternehmer über einen Sozialplan zu verhandeln mit dem Zweck, die wirtschaftlichen Nachteile für den Arbeitnehmer auszugleichen oder zumindest abzumildern.
Diese Sozialplanvereinbarungen unterliegen zudem den gesetzlichen Vorgaben nach § 75 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), welche den Betriebsparteien vorschreibt, eine Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer auszuschließen. Gleichzeitig sind Diskriminie-rungen der Arbeitnehmer nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu unterlassen. Dennoch eröffnen gesetzliche Regelungen den Betriebsparteien Mittel und Wege, um Vereinbarungen im Sozialplan treffen zu können, bei denen bestimmte Arbeitnehmergruppen eine Kürzung oder sogar den gänzlichen Ausschluss von Sozial-planansprüchen erfahren.
Ziel dieser Bachelor-Thesis ist es, die am häufigsten vorkommenden Kappungsmög-lichkeiten aufzuzeigen und diese anhand der gesetzlichen Ungleichbehandlungsverbote zu bewerten.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Hohnroth, Sebastian: Die Kappung von im Sozialplan geregelten Abfindungen nach
betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsätzen, Hamburg, Diplomica
Verlag GmbH 2015
PDF-eBook-ISBN: 978-3-95636-434-1
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2015
Zugl. FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH,
Bachelorarbeit, 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2015
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis II
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... II
Literaturverzeichnis... IV
Abkürzungsverzeichnis ... VII
1
Einleitung ... 1
2
Der Sozialplan ... 2
2.1
Gesetzliche Grundlagen des Sozialplans ... 2
2.1.1
Die Betriebsverfassung ... 2
2.1.2
Gleichbehandlungsgrundsätze ... 4
2.1.2.1
Verfassungsrechtliche Gleichbehandlung ... 4
2.1.2.2
Arbeitsrechtliche Gleichbehandlung... 5
2.1.2.3
Allgemeine Gleichbehandlung ... 6
2.1.2.4
Betriebsverfassungsrechtliche Gleichbehandlung ... 7
2.2
Formale und betriebliche Grundlagen des Sozialplans ... 9
2.2.1
Die Betriebsvereinbarung... 9
2.2.2
Die Betriebsänderung ... 12
2.2.3
Der Interessenausgleich ... 14
2.2.4
Nachteilsausgleich ... 16
2.3
Der Inhalt des Sozialplans ... 17
2.3.1
Der Sozialplanumfang ... 17
2.3.2
Regelungsinhalte und erfasster Personenkreis ... 17
2.4
Spezielle Sozialpläne ... 18
2.4.1
Der Sozialplan in der Insolvenz ... 18
2.4.2
Der Transfersozialplan ... 19
2.4.3
Der Tarifsozialplan... 21
3
Die Kappung von Sozialplanansprüchen ... 22
3.1
Benachteiligung rentennaher Jahrgänge ... 23
3.1.1
Problemstellung ... 23
3.1.2
Untersuchung der Problemstellung ... 23
3.1.2.1
Differierende Sichtweisen auf den Abfindungscharakter ... 23
3.1.2.2
Berechnungsmodelle zur Sozialplanabfindung ... 25
3.1.2.3
Berechnungsbeispiel zur Abfindungshöhe ... 26
3.1.2.4
Europarechtskonformität des § 10 S. 3 Nr. 6 AGG ... 28
3.1.3
Ergebnis und kritische Würdigung ... 30
III
3.2
Ungleichbehandlung aufgrund von Alter und Betriebszugehörigkeit ... 32
3.2.1
Problemstellung ... 32
3.2.2
Untersuchung der Problemstellung ... 32
3.2.2.1
Die Berücksichtigung von Lebensalter und Betriebszugehörigkeit .. 32
3.2.2.2
Leseart von Lebensalter und/oder Betriebszugehörigkeit ... 34
3.2.2.3
Altersgruppenbildung ... 35
3.2.2.4
Höchstbetragsklauseln (Kappungsgrenzen) ... 37
3.2.3
Ergebnis und kritische Würdigung ... 38
3.3
Ungleichbehandlung aufgrund einer Schwerbehinderung ... 40
3.3.1
Problemstellung ... 40
3.3.2
Untersuchung der Problemstellung ... 40
3.3.2.1
Gleichbehandlungsgrundsätze und Kündigungsschutz ... 40
3.3.2.2
Rentennahe Abfindungsunterschiede im Sozialplan ... 41
3.3.2.3
Urteil des EuGH zur Diskriminierung Schwerbehinderter ... 42
3.3.2.4
Ergebnis und kritische Würdigung ... 44
3.4
Ungleichbehandlung aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses ... 46
3.4.1
Problemstellung ... 46
3.4.2
Untersuchung der Problemstellung ... 47
3.4.3
Sozialplanansprüche von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern ... 47
3.4.4
Sozialplanansprüche von befristet beschäftigten Arbeitnehmern ... 48
3.4.5
Sozialplanansprüche bei Eigenkündigung/Aufhebungsvertrag ... 49
3.4.5.1
Stichtagsregelungen ... 49
3.4.5.2
Turboprämien ... 50
3.4.6
Ausschlussgründe für Abfindungen bei Arbeitsvermittlung... 51
3.4.7
Ergebnis und kritische Würdigung ... 52
4
Schlussbetrachtung ... 55
Literaturverzeichnis IV
Literaturverzeichnis
Bachner, Michael/Köstler, Roland/Matthießen, Volker/Trittin, Wolfgang, Arbeitsrecht
bei Unternehmensumwandlung und Betriebsübergang, 4. Aufl., Baden-Baden 2012 (zi-
tiert: Bearbeiter, in: Bachner/Köstler/Matthießen et al.).
Bezani, Wolfgang, Arbeitsrecht Sozialplangestaltung. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Personalwirtschaft Sonderausgabe Arbeitsrecht (2011), 30-33.
Däubler, Wolfgang, Das Arbeitsrecht 1. Die gemeinsame Wahrung von Interessen im
Betrieb. Leitfaden für Arbeitnehmer, 16. Aufl., Hamburg 2006.
Däubler, Wolfgang, Arbeitsrecht. Ratgeber für Beruf, Praxis und Studium, 10. Aufl.,
Frankfurt am Main 2014.
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, hrsg. v. Dieterich, Thomas, Hanau, Peter,
Schaub, Günter, Bd. 51, 14. Aufl., München 2014 (zitiert: Bearbeiter, in: ErfK-ArbR).
Fachanwaltskommentar Arbeitsrecht, hrsg. v. Dornbusch, Gregor/Fischermeier,
Ernst/Löwisch, Manfred,4. Aufl., Köln 2011 (zitiert: Bearbeiter, in: Fachanwaltskom-
mentar-ArbR).
Fitting, Handkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung, bearb. v.
Engels, Gerd/Linsenmaier, Wolfgang/Schmidt, Ingrid u.a., 25 Aufl., München 2010
(zitiert: Fitting, HaKomm-BetrVG).
Fuhlrott, Michael, Das Zustimmungserteilungsverfahren zur Kündigung Schwerbehin-
derter, ArbRAktuell (2011), 317-321.
Göritz, Berthold/Hase, Detlef/Rupp, Rudi, Handbuch Interessenausgleich und Sozial-
plan. Handlungsmöglichkeiten bei Umstrukturierungen, 6. Aufl., Frankfurt am Main
2012.
Hamacher, Anno/Ulrich, Christoph, Die Kündigung von Arbeitsverhältnissen nach In-
krafttreten und Änderung des AGG, NZA (2007), 657-663.
Handkommentar zum Arbeitsrecht. Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen Be-
zügen, hrsg. v. Däubler, Wolfgang/Hjort, Jens Peter/Schubert, Michael u.a., 3. Aufl.,
Baden-Baden 2013 (zitiert: Bearbeiter, in: HaKomm-ArbR).
Handkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, hrsg. v. Düwel, Franz Josef, 3. Aufl.,
Baden-Baden 2010 (zitiert: Bearbeiter, in: HaKomm-BetrVG).
Hunold, Wolf, Sozialplanrechtsprechung des BAG, AuA 2 (2010), 106-109.
Hümmerichs/Lücke, Oliver/Mauer, Reinhold (Hrsg.), Arbeitsrecht. Vertragsgestaltung
Prozessführung Personalarbeit Betriebsvereinbarungen, 7. Aufl., Baden-Baden 2011
(zitiert: Bearbeiter, in: Hümmerichs/Lücke/Mauer).
Junker, Abboi, Grundkurs Arbeitsrecht, 13. Aufl., München 2014.
Literaturverzeichnis V
Kesten, Ralf/Lühn, Michael/Schmidt, Steffen, Controlling-Instrumente zur Steuerung
von Vertriebsgesellschaften im Konzern, CM 3 (2013), 63-72 (1. Teil), CM 4 (2013),
43-49 (2. Teil).
Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung, hrsg. v. Richadi, Rein-
hard, 14. Aufl., München 2014 (zitiert: Bearbeiter, in: Richardi, Komm-BetrVG).
Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung und EBR-Gesetz, hrsg. v.
Wedde, Peter, 14. Aufl., Frankfurt am Main 2014 (zitiert: Bearbeiter, in:
Wedde, Komm-BetrVG).
Krieger, Arnold, Rente statt Abfindung. Zulässigkeit des Ausschlusses älterer Arbeit-
nehmer von Sozialplanleistungen, NZA (2008), 1153-1157.
Kunisch, Peter, Personalreduzierung. Aufhebungsvertrag Kündigung Sozialplan,
Bd. 197 Schriftenreihe Recht der Wirtschaft, 5. Aufl., Stuttgart; München, Hannover,
Berlin, Weimar, Dresden 2012.
Lingemann, Stefan/Beck, Charlotte, Auswahlrichtlinie, Namensliste, Altersgruppenbil-
dung und Altersdiskriminierung, NZA (2009), 577-581.
Löwisch, Manfred/Caspers, Georg/Klumpp, Steffen, Arbeitsrecht. Ein Studienbuch,
9. Aufl., München 2012 (zitiert: Bearbeiter, in: Löwisch/Caspers/Klumpp).
Löwisch, Manfred, Kollektivverträge und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, DB
(2006), 1729-1732.
Oelkers, Felix, Altersdiskriminierung bei Sozialplänen. Viel Lärm um nichts, NJW
(2008), 614-617.
Pawlak, Klaus/Ruge, Jan, Betriebsverfassungsrecht, Bd. 44 Arbeitsrecht in der
betrieblichen Praxis, 2. Aufl., Berlin 2014.
Richter, Claudia, Benachteiligung wegen des Alters im Erwerbsleben. Eine Analyse der
gesetzlichen Regelungen unter besonderer Berücksichtigung des AGG und des
KSchG und ihre Handhabung in der betrieblichen Praxis, 1. Aufl., Bonn 2011.
Röller, Jürgen/Küttner, Wolfdieter, (Hrsg.), Personalbuch 2012. Arbeitsrecht, Lohn-
steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, 19. Aufl., München 2012 (zitiert: Bearbeiter, in:
Röller/Küttner).
Schade, Friedrich, Arbeitsrecht. Grundlagen des Individualarbeitsrechts, des kol-
lektiven Arbeitsrechts sowie der Arbeitsgerichtsbarkeit, 1. Aufl., Stuttgart 2010.
Schaub, Günter/Koch, Ulrich/Link, Rüdiger/Treber, Jürgen/Vogelsang, Hinrich, Ar-
beitsrechts-Handbuch. Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis,
15. Aufl., München 2013 (zitiert: Bearbeiter, in: Schaub/Koch/Linck et al.).
Schaub, Günter/Schindele, Friedrich, Kurzarbeit, Massenentlassung, Sozialplan,
3. Aufl., München 2011.
Literaturverzeichnis VI
Sowka, Jans-Harald/Schiefer, Bernd (Hrsg.), Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis.
Ein Handbuch für Führungskräfte, 11. Aufl., Düsseldorf 2010 (zitiert: Bearbeiter, in:
Sowka/ Schiefer).
Temming, Felipe, Für einen Paradigmenwechsel in der Sozialplanrechtsprechung. Kon-
sequenzen des Verbots der Altersdiskriminierung, RdA (2008), 205-222.
Wank, Rolf, Aktuelle Probleme des Arbeitskampfrechts Unterstützungsstreik, Streik um
Tarifsozialplan, Schadensersatz und einstweilige Verfügung, RdA (2009), 1-13.
Weller, Bernd, Punkteschema bei der Sozialauswahl, AuA (2013), 264-267.
Wendeling-Schröder, Ulrike, Aktuelle KSchG, BetrVG und AGG unvereinbare Ge-
rechtigkeitskonzepte bei betriebsbedingten Kündigungen?, NZA (2010), 14-20.
Wendeling-Schröder, Ulrike, Grund und Grenzen gemeinschaftsrechtlicher Diskriminie-
rungsverbote im Zivil- und Arbeitsrecht, NZA (2004), 1320-1323.
Willemsen, Heinz Josef, Sinn und Grenzen des gesetzlichen Sozialplans. Zugleich Be-
sprechung des EuGH-Urteils v. 6. 12. 2012 Rs. C-152/11 (Odar), RdA (2013), 166-
176.
Willemsen, Heinz Josef/Schweibert, Ulrike, Schutz der Beschäftigten im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzt, NJW (2006), 2583-2592.
Wollenschläger, Michael/Krogull, Jutta/Löcher, Jens, Arbeitsrecht, 3. Aufl., Köln 2010.
Zange, Julia, Diskriminierung bei Berechnung einer Sozialplanabfindung. Nicht wegen
des Alters, wohl aber wegen Schwerbehinderung, NZA (2013), 601-605.
Abkürzungsverzeichnis VII
Abkürzungsverzeichnis
Abs. Absatz
AGG Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz
Alt. Alternative
AP Arbeitsrechtliche
Praxis
ArbG Arbeitsgericht
ArbR Arbeitsrecht
ArbRAktuell Arbeitsrecht
Aktuell
Art. Artikel
AuA Arbeit
und
Arbeitsrecht
Aufl. Auflage
BAG Bundesarbeitsgericht
BB Betriebs-Berater
BeckRS Beck-Rechtsprechung
beE
betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit
BEEG Bundeselterngeld-
und
Elternzeitgesetz
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BQG
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft
bzw. beziehungsweise
CM Controller
Magazin
DB Der
Betrieb
ErfK Erfurter
Kommentar
et al.
et alii
EU Europäische
Union
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
f. folgende
ff. fortfolgende
gem. gemäß
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
HaKomm-BetrVG
Handkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz
Hrsg. Herausgeber
HS Halbsatz
Abkürzungsverzeichnis VIII
i.d.R.
in der Regel
i.H.v.
in Höhe von
i.S.d.
im Sinne des
i.V.m. in
Verbindung
mit
inkl. inklusive
InsO Insolvenzordnung
Komm Kommentar
Komm-BetrVG Kommentar
zum
Betriebsverfassungsgesetz
KSchG Kündigungsschutzgesetz
LAG Landesarbeitsgericht
MDR
Monatsschrift für Deutsches Recht
mind. mindestens
Mio. Millionen
NJOZ
Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZA-RR NZA-Rechtsprechungs-Report
Arbeitsrecht
o. g.
oben genannt
OHG Offene
Handelsgesellschaft
RdA
Recht der Arbeit
Rn. Randnummer,
Randnummern
S. Seite,
Satz
SGB Sozialgesetzbuch
st. Rspr
Ständige Rechtsprechung
TVG Tarifvertragsgesetz
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
u.a.
unter anderem, und andere
Urt. Urteil
v.
vom, von, vor
vgl. vergleiche
z.B. zum
Beispiel
1. Einleitung
1
1
Einleitung
Der Unternehmer und seine Beschäftigten verfolgen in der Regel konträre Ziele. Auf
der einen Seite stellt sich der Unternehmer mit seinen Produkten oder Dienstleistungen
den Herausforderungen des Marktes mit meist vorrangigen monetären Zielen wie der
Gewinnmaximierung. Der Arbeitnehmer hingegen ist primär an der Sicherstellung sei-
ner Erwerbstätigkeit durch dauerhafte Beschäftigung im Unternehmen interessiert.
Dennoch gibt es mannigfaltige auf das Unternehmen einwirkende Schwierigkeiten, wel-
che die unternehmerische Tätigkeit nachhaltig beeinflussen können. Sie beruhen oftmals
auf der Tatsache, dass die bei Unternehmensgründung geplante, möglichst erfolgreiche
Zielsetzung nicht (mehr) mit der tatsächlichen Unternehmensentwicklung korreliert.
Dies kann schlimmstenfalls zu einer Insolvenz des Unternehmens führen.
Die Konsequenzen können sowohl für den Unternehmer als auch für seine Beschäftig-
ten folgenschwer sein. So führt z.B. die Beendigung des Betriebes häufig dazu, dass alle
Arbeitnehmer entlassen werden. Diese sogenannte Betriebsänderung unterliegt unter
bestimmten Voraussetzungen dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Er hat mit
dem Unternehmer über einen Sozialplan zu verhandeln mit dem Zweck, die wirtschaft-
lichen Nachteile für den Arbeitnehmer auszugleichen oder zumindest abzumildern.
Diese Sozialplanvereinbarungen unterliegen zudem den gesetzlichen Vorgaben nach
§ 75 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), welche den Betriebsparteien vorschreibt, eine
Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer auszuschließen. Gleichzeitig sind Diskriminie-
rungen der Arbeitnehmer nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu
unterlassen. Dennoch eröffnen gesetzliche Regelungen den Betriebsparteien Mittel und
Wege, um Vereinbarungen im Sozialplan treffen zu können, bei denen bestimmte Ar-
beitnehmergruppen eine Kürzung oder sogar den gänzlichen Ausschluss von Sozial-
planansprüchen erfahren.
Ziel dieser Bachelor-Thesis ist es, die am häufigsten vorkommenden Kappungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen und diese anhand der gesetzlichen Ungleichbehandlungsverbote
zu bewerten.
2. Der Sozialplan
2
2
Der Sozialplan
2.1
Gesetzliche Grundlagen des Sozialplans
2.1.1
Die Betriebsverfassung
Die Betriebsverfassung regelt die grundlegende Ordnung der betrieblichen Zusammen-
arbeit. Gesetzliche Grundlage der Betriebsverfassung ist in Deutschland das Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG). Räumlicher Geltungsbereich ist nach ständiger Rechtspre-
chung des BAG der Betrieb
1
als organisatorische Einheit, innerhalb dessen der Arbeit-
geber allein oder mit den von ihm beschäftigten Arbeitnehmern bestimmte arbeitstech-
nische Zwecke fortgesetzt verfolgt
2
. Abgrenzend zum Betriebsbegriff ist das Unterneh-
men die Organisations- und Wirtschaftseinheit, die durch eine natürliche oder juristi-
sche Person geführt wird und stets eine bestimmte unternehmerische Zielsetzung wie
z.B. die Gewinnerzielung verfolgt
3
.
Das individuelle Arbeitsrecht wird durch das BetrVG um die kollektive Komponente
erweitert
4
. Die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, welche dem persönlichen Gel-
tungsbereich des BetrVG zuzuordnen sind, handeln durch verschiedene gewählte Orga-
ne
5
. Als vorrangiges Organ ist hier der Betriebsrat zu nennen, welcher die Arbeitnehmer
während seiner Amtszeit repräsentiert.
Drei stilprägende Merkmale kennzeichnen das Betriebsverfassungsrecht
6
:
1. die duale, kollektive Interessenvertretung im Betrieb
2. das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit
3. das Vorhandensein echter, erzwingbarer Mitbestimmungsrechte
1
Caspers, in: Löwisch/Caspers/Klumpp, ArbR., 9. Aufl. (2012), § 26, Rn. 1167.
2
BAG, Urt. v. 14.05.1997 7 ABR 26/96, DB 1997, 2083.
3
Wollenschläger/Krogull/Löcher, ArbR., 3. Aufl. (2010), Rn. 69.
4
Thau, in: Sowka/ Schiefer, Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angele-
genheiten, 11. Aufl. (2010), Rn. 1430.
5
Wollenschläger/Krogull/Löcher, ArbR., 3. Aufl. (2010), Rn. 704 ff.
6
Junker, Grundkurs ArbR., 13. Aufl. (2014), Rn. 642 ff.
2. Der Sozialplan
3
Die Betriebsverfassung behandelt die solidarische Wahrnehmung der Interessenvertre-
tung ähnlich wie im Tarifvertragsrecht. Sie erfolgt für die Mitarbeiter zweigleisig, ei-
nerseits durch den Betriebsrat, andererseits durch die zuständigen Gewerkschaften.
§ 2 Abs. 1 BetrVG verpflichtet Arbeitgeber und Betriebsrat zu vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit
7
. Dies beinhaltet für den Betriebsrat auch die Verbindlichkeit, betriebli-
che Belange zu wahren und gerade in strittigen Fragen Kompromissbereitschaft sowie
ernsthaften Einigungswillen zu zeigen
8
.
Als letztes stilprägendes Mittel sind erzwingbare sowie durchsetzbare
9
Mitwirkungs-
und Mitbestimmungsrechte für den Betriebsrat anzusehen. Diese Beteiligungsrechte
werden nachfolgend hierarchisch dargestellt, wobei man zwischen Mitwirkungsrechten,
Zustimmungsverweigerungsrechten sowie echten Mitbestimmungsrechten unterschei-
det
10
:
1. Unterrichtung gem. § 92 Abs. 1 BetrVG als niedrigste Stufe des Mitwirkungs-
rechts, z.B. indem der Arbeitgeber den Betriebsrat über die Personalplanung
11
unterrichten muss
2. Anhörung als Mitwirkungsrecht gem. § 80 Abs. 1 BetrVG z.B. durch Anhörung
des Betriebsrats bei Kündigungen gem. § 102 Abs. 1 BetrVG
3. Beratung als Mitwirkungsrecht gem. § 74 Abs. 1 BetrVG, z.B. in Fällen der Be-
triebsänderung gem. § 111 S. 1 BetrVG
12
4. Widerspruchsrecht als Mitwirkungsrecht gem. § 98 Abs. 2 BetrVG, z.B. durch
Widerspruch gegen eine ordentliche Kündigung
13
gem. § 102 Abs. 3 BetrVG
5. Zustimmungsverweigerungsrecht (Vetorecht) als abgeschwächtes Mitbestim-
mungsrecht gem. § 99 Abs. 2 BetrVG, z.B. durch Verweigerung der Zustim-
mung zu einer geplanten Versetzung
14
eines Arbeitnehmer
7
Vgl. im einzelnen Fitting, HaKomm BetrVG, 25. Aufl., (2010), § 2 Rn. 16 ff.
8
Fitting, HaKomm BetrVG, 25. Aufl. (2010), § 74, Rn. 4 ff.
9
Junker, Grundkurs ArbR., 13. Aufl. (2014), Rn. 646.
10
Wollenschläger/Krogull/Löcher, ArbR., 3. Aufl. (2010), Rn. 789 ff.
11
Caspers, in: Löwisch/Caspers/Klumpp, ArbR., 9. Aufl. (2012), § 26, Rn. 1417.
12
Pawlak/Ruge, Betriebsverfassungsrecht, Bd. 44, 2. Aufl. (2014), Rn. 318.
13
Schiefer, in: Sowka/ Schiefer, Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats in wirtschaftlichen
Angelegenheiten, 11. Aufl. (2010), Rn. 1195 ff.
2. Der Sozialplan
4
6. Mitbestimmungsrecht gem. § 87 Abs. 1 BetrVG als höchste Stufe der Beteili-
gung z.B. durch die Mitbestimmungspflicht beim Abschluss eines Sozialplans
gem. § 112 Abs. 4 BetrVG als spezielle Form der Betriebsvereinbarung. Beim
Mitbestimmungsrecht kann der Arbeitgeber regelmäßig nicht ohne Zustimmung
des Betriebsrats entscheiden
15
2.1.2
Gleichbehandlungsgrundsätze
In der Bundesrepublik Deutschland gehört der Grundsatz der Gleichbehandlung von
Arbeitnehmern zu den grundlegenden Prinzipien des Arbeitsrechts
16
. Das deutsche
Rechtssystem kennt verschiedene Gleichbehandlungsgrundsätze, die von arbeitsrechtli-
cher Relevanz sind und die miteinander in Beziehung stehen. Als solche sind zu nen-
nen:
Die verfassungsrechtliche Gleichbehandlung nach dem Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland (vgl. Art. 3 Abs. 1 GG), der durch die deutsche Rechtsprechung
17
ge-
schaffene arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz sowie die Normen des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
Speziell für den Sozialplan ist der betriebsverfassungsrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz von immenser Bedeutung
18
. Wenn die Kappung von Sozialplanansprüchen
untersucht werden soll, müssen immer auch Berührungspunkte mit diesem Gleichbe-
handlungsgrundsatz geprüft werden
19
.
2.1.2.1 Verfassungsrechtliche Gleichbehandlung
Der Rechtssatz des Art. 3 Abs. 1 GG besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich
sind. Damit wird ein fundamentaler Grundsatz deutscher Rechtsordnung statuiert. Diese
Norm nimmt auch im Arbeitsleben eine wichtige Funktion ein, da aus diesem sog.
Gleichheitssatz ein Willkürverbot abgeleitet wird: Arbeitnehmer dürfen nicht ohne
14
Däubler, ArbR. Ratgeber für Beruf, Praxis und Studium, 10. Aufl. (2014), Rn. 332 ff.
15
Junker, Grundkurs ArbR., 13. Aufl. (2014), Rn. 702.
16
ErfK/Preis, 13. Aufl. (2013), § 611 BGB, Rn. 572.
17
St. Rspr. des BAG, vgl. etwa BAG, Urt. v. 23.08.1988, 1 AZR 284/87, NZA 1989, 28.
18
Richardi, in: Richardi, Komm-BetrVG, 14. Aufl. (2014), § 75, Rn. 1.
19
Vgl. dazu beispielhaft BAG, Urt. v. 26.03.2013, 1 AZR 693/11, BeckRS 2013, 71106 [11]; BAG, Urt. v.
23.03.2010, 1 AZR 832/08, NZA 2010, 774; BAG, Urt. v. 26.05.2009, 1 AZR 198/08, NZA 2009, 849
(851); LAG Düsseldorf, Urt. v. 02.07.2014, 4 Sa 321/14, NZA-RR 2014, 587 (589).
2. Der Sozialplan
5
einen sachlichen Grund ungleich behandelt werden
20
. Eine solche Willkür läge vor,
wenn z.B. der Arbeitgeber einzelne Arbeitnehmer bei einer Entgelterhöhung, die dem
Zweck des Kaufkraftausgleichs dienen soll, ausschlösse
21
. Konkretisiert wird der
Gleichheitssatz zudem in den Differenzierungsverboten des Art. 3 Abs. 2 GG, der an
dieser Stelle die Gleichberechtigung von Mann und Frau fordert. Fortgeführt wird dies
im Art. 3 Abs. 3 GG, der eine Benachteiligung aufgrund von Merkmalen wie Ge-
schlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben und Religions-
zugehörigkeit sowie politischer Anschauungen verbietet. Auch darf niemand wegen
einer Behinderung benachteiligt werden. Diese Diskriminierungsverbote werden einer-
seits durch § 75 Abs. 1 BetrVG, andererseits durch die Vorschriften des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) umgesetzt
22
.
2.1.2.2 Arbeitsrechtliche Gleichbehandlung
Der durch die Rechtsprechung
23
entwickelte arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-
satz besagt, dass einzelne Arbeitnehmer nicht ohne sachlichen Grund von Leistungen
auszuschließen sind, die der Arbeitgeber einer Gruppe von Arbeitnehmern generell ge-
währt, ohne dass er hierzu verpflichtet ist. Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz soll den
betrieblichen Frieden herbeiführen und erhalten. Sowohl Streitigkeiten zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmern als auch zwischen den Arbeitnehmern untereinander sol-
len vermieden werden
24
. Der Grundsatz, alle Arbeitnehmer in einem Betrieb gleich zu
behandeln, ist sowohl gewohnheitsmäßig anerkannt als auch hinlänglich im Arbeits-
recht manifestiert
25
. Dennoch ist in diesem Kontext der Grundsatz der Privatautonomie
zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit eine individuelle Be-
vorzugung einzelner Arbeitnehmer z.B. in der Höhe des Arbeitsentgelts und der Gratifi-
kation als zulässig erachtet, da der Grundsatz der Vertragsfreiheit dem Grundsatz der
20
Löwisch, in: Löwisch/Caspers/Klumpp, ArbR., 9. Aufl. (2012), § 4, Rn. 133.
21
Vgl. BAG, Urt. v. 11.09.1985, 7 AZR 371/83, NZA 1987, 156 (157).
22
Löwisch, in: Löwisch/Caspers/Klumpp, ArbR., 9. Aufl. (2012), § 4, Rn. 135.
23
St. Rspr. des BAG, vgl. etwa BAG, Urt. v. 23.08.1988, 1 AZR 284/87, NZA 1989, 28.
24
Junker, Grundkurs ArbR., 13. Aufl. (2014), Rn. 58.
25
ErfK/Preis, 13. Aufl. (2013), § 611 BGB, Rn. 574.
2. Der Sozialplan
6
Gleichbehandlung vorgeht. Nicht erlaubt ist allerdings ein Verstoß gegen kollektiv-
rechtliche Vereinbarungen, wie sie z.B. im Sozialplan geschlossen werden
26
.
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz stellt inhaltlich eine Ausprägung der
Benachteiligungsverbote des Art. 3 Abs. 2 und 3 GG dar, wobei deutlich mehr Augen-
merk auf das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG gelegt wird. Insofern geht der arbeits-
rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz weiter als das Grundgesetz, indem er nicht zur
Nichtigkeit der Vertragsgestaltung führt, sondern dem gleichheitswidrig übergangenen
Arbeitnehmer als Rechtsfolge des Verstoßes einen Leistungsanspruch einräumt
27
. Ver-
letzt der Arbeitgeber jedoch durch eine einseitige Maßnahme wie z.B. Kündigung den
Gleichbehandlungsgrundsatz, ist diese Maßnahme unwirksam
28
.
2.1.2.3 Allgemeine Gleichbehandlung
Der Gesetzgeber will mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht bestimmte
Personengruppen schützen, sondern Benachteiligung wegen bestimmter, enumerativ
aufgeführter Merkmale verhindern oder beseitigen
29
. Niemand darf wegen der Rasse
oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität (vgl. § 1 AGG) diskriminiert wer-
den. Das AGG spezifiziert den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
dahingehend, dass aufgrund der dort genannten Merkmale nur ganz ausnahmsweise
differenziert werden darf
30
.
Die arbeitsrechtlich relevanten Teile des AGG sind im Abschnitt 2 enthalten. Dreh- und
Angelpunkt des Beschäftigungsschutzes ist § 7 AGG. Er enthält sowohl ein ausdrückli-
ches Benachteiligungsverbot der Beschäftigen als auch die Unwirksamkeit von indivi-
dual- und tarifrechtlichen Vereinbarungen, sofern sie gegen dieses Prinzip verstoßen
31
.
26
Schade, ArbR., 1. Aufl. (2010), Rn. 222.
27
Löwisch, in: Löwisch/Caspers/Klumpp, ArbR., 9. Aufl. (2012), § 4, Rn. 144.
28
Beckschulze, in: Sowka/ Schiefer, Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats in wirtschaftlichen
Angelegenheiten, 11. Aufl. (2010), Rn. 551.
29
Junker, Grundkurs ArbR., 13. Aufl. (2014), Rn. 157.
30
Däubler, ArbR. Ratgeber für Beruf, Praxis und Studium, 10. Aufl. (2014), Rn. 708 a.
31
Kappenhagen/Kramer, in: Fachanwaltskommentar-ArbR, 4. Aufl. (2011), AGG, Rn. 3.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783956364341
- ISBN (Paperback)
- 9783956367786
- Dateigröße
- 365 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule – Studienzentrum Duisburg
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- Recht Jura Sozialplan Kappung Abfindungen Abfindung Insolvenz Unternehmer Betriebsstilllegung Kündigung Massenentlassung BetrVG AGG Gleichbehandlung Ungleichbehandlung Diskriminierung KSchG TzBfG Arbeitsgericht BAG EuGH Elternzeitgesetz Betriebsverfassungsgesetz Betriebsverfassung Gleichbehandlungsgrundsätze Verfassungsrechtliche Gleichbehandlung Arbeitsrechtliche Gleichbehandlung Allgemeine Gleichbehandlung Betriebsvereinbarung Betriebsänderung Interessenausgleich Nachteilsausgleich Sozialplanumfang Transfersozialplan Tarifsozialplan Insolvenzsozialplan rentennahe Jahrgänge § 10 S. 3 Nr. 6 AGG Altersgruppenbildung Höchstbetragsklauseln Kappungsgrenzen Schwerbehinderung Gleichgestellte Kündigungsschutz Teilzeitbeschäftigung Befristete Beschäftigung Eigenkündigung Aufhebungsvertrag Stichtagsregelungen Turboprämie Ausschlussgründe Ausschluss
- Produktsicherheit
- Diplom.de