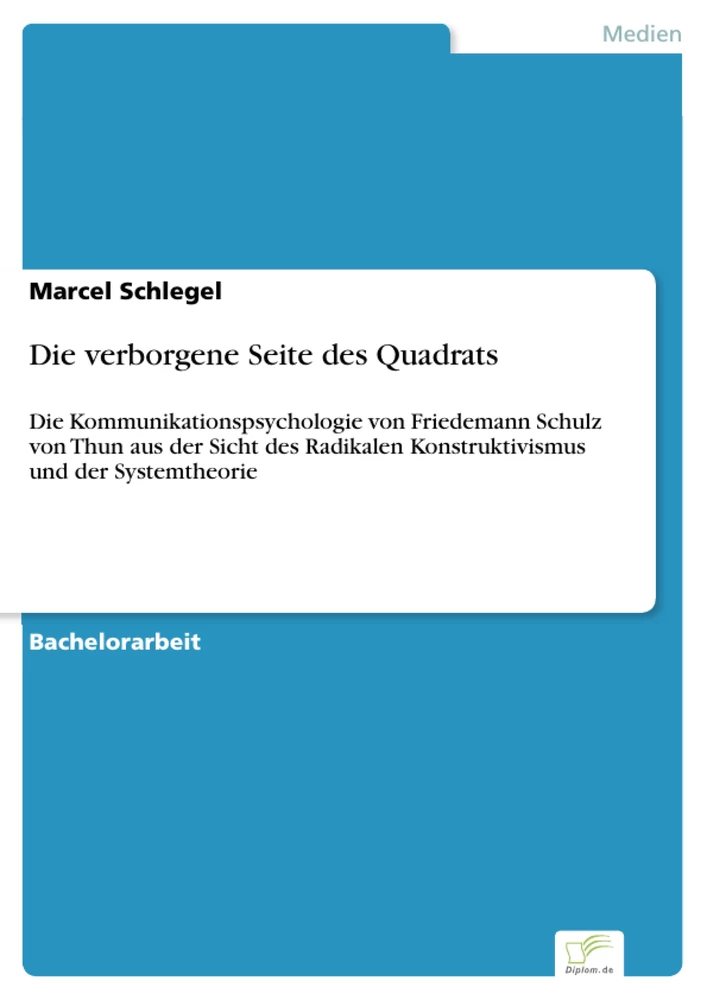Die verborgene Seite des Quadrats
Die Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus und der Systemtheorie
©2014
Bachelorarbeit
79 Seiten
Zusammenfassung
Womöglich ist es, weil es Friedemann Schulz von Thun zeit seines Lebens gerne harmonisch hatte. Gewiss waren es auch die Erfahrungen des jungen Schulz von Thun, die in ihm früh ein Bedürfnis nach Gleichgewicht, nach der Integration des Verschiedenen und nach der Aussöhnung vermeintlicher Gegensätze hervorgerufen haben.Er, der Spätpubertierende, der Sitzenbleiber, der „Spätentwickler auf der Beziehungsebene“ , für den die Logik des Zwischenmenschlichen zuweilen eine (zu) große Bürde gewesen war – ja, den das Leben zunächst vor so manches schier unlösbare Rätsel gestellt hatte. Liest man das umfangreiche Werk des Hamburger Kommunikationspsychologen gewissenhaft, so wird einen der Eindruck nicht los, dass sich Schulz von Thun im dialektischen Verhältnis zweier Pole immerzu als „die Mitte“ betrachtet. Warum ist Schulz von Thun ein Systemiker, weshalb ein Konstruktivist? Und was macht ihn dennoch einzigartig – besser, was unterscheidet ihn von klassischen Vertretern dieser Perspektiven?
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Printed in Germany
Aus dem Inhalt
Bachelorarbeit: Die verborgene Seite des Quadrats
1. Einleitung
1.1. Die Suche nach der Harmonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.2. Die ewige Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3. Aufbau der Arbeit oder: Ein Hauch von Konstruktivismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2. Das Rezept von Schulz von Thuns ,,Gulasch"
2.1. Die einzigartige Dialektik: Zum Verhältnis von Innen und Außen . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.2. Die Entdeckung des Inneren Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.3. Die Humanistische Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.4. Nur die halbe Wahrheit: Das Menschenbild des Friedemann Schulz von Thun . . . .
18
3. Das System der Kommunikation
3.1. Ein neuer Blick auf die menschliche Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
3.2. Der System-Begriff: Von den Teilen zum Wechselspiel des Ganzen . . . . . . . . . . . . . .
25
3.3. Zwischenmenschliche Beziehungen als System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
3.4. Die Kybernetik und ihre Folgen für den Blick auf Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
3.5. Der Mensch im System: Zirkularität und Interpunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3.6. Bateson, Maturana, Varela und der Schritt zur Erkenntnistheorie . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3.7. Das Rätsel des Lebens oder: die Autopoiese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3.8. Menschliches Erkennen und das Verhältnis von Subjekt und Objekt . . . . . . . . . . . . . .
37
4. Der Radikale Konstruktivismus
4.1. Die Entdeckung des Beobachters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
4.2. Die unmögliche Objektivität und die Grenzen des Raumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
4.3. Viabilität und die Vielfalt der Wirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
5. Schulz von Thun als Systemiker
5.1. Kommunikation als Wechselwirkungsgeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5.2. Watzlawick und Bühler im Kommunikationsquadrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5.3. Die Erfassung der Außenseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6. Schulz von Thun als Konstruktivist
6.1. Watzlawicks umgekehrte Kausalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
6.2. Interpunktion schafft Wirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
6.3. Weitere Gemeinsamkeiten in Kürze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
6.4. Das Kommunikationsquadrat als konstruktivistisches Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6.5. Die Ordnung der Wirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
6.6. Subjektivität in der Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
6.7. Liberalismus, Verantwortung und Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
7. Die Birke und der halbe Realismus
7.1. Ein Gespräch, das vieles verändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
7.2. Die ,,realistisch-humanistische" Seite des Quadrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
7.3. Watzlawicks äußerer Fokus und die Angst vor dem technischen Vokabular . . . . . . . . . .
70
7.4. Die Birke und die Erkenntnistheorie der Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
8. Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
9. Literatur, Quellen und Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3
1. Einleitung
Eine Kommunikationspsychologie eigenen Rechts.
1.1.
Die Suche nach der Harmonie
Womöglich ist es, weil es Friedemann Schulz von Thun zeit seines Lebens gerne harmonisch
hatte (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 160). Gewiss waren es auch die Erfahrungen des jungen
Schulz von Thun, die in ihm früh ein Bedürfnis nach Gleichgewicht, nach der Integration des
Verschiedenen und nach der Aussöhnung vermeintlicher Gegensätze hervorgerufen haben
er, der Spätpubertierende, der Sitzenbleiber, der ,,Spätentwickler auf der Beziehungsebene"
(Schulz von Thun 2013: 24), für den die Logik des Zwischenmenschlichen zuweilen eine (zu)
große Bürde gewesen war ja, den das Leben zunächst vor so manches schier unlösbare Rätsel
gestellt hatte. Der hanseatische Schachliebhaber, schon als Schüler ein Außenseiter, dem das
analytische Denken, die Kopfarbeit, so viel lieber gewesen war, als die Beschäftigung mit den
eigenen Gefühlen und der Umgang mit den Mitmenschen. Doch ausgerechnet dieser ,,schlecht
vernetzte Eigenbrötler" (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 160), der während seines Studiums
einsam spazieren gegangen war, um den Kontakt zu seinen Kommilitonen zu meiden
ausgerechnet
dieser Schulz von Thun also, sollte sich später zu einem Pionier der jüngeren
Kommunikationspsychologie
entwickeln, der bis heute mit unter anderem den drei Bänden
von
Miteinander Reden (1981, 1989, 1998) zu einem der meistgelesenen Wissenschaftler des
Landes avanciert ist, und dem mit dem
Situationsmodell, dem Kommunikations- oder dem
Werte- und Entwicklungsquadrats
1
schließlich auch weltweite Aufmerksamkeit zuteil wurde.
2
Sicherlich hatten auch seine Mentoren, Reinhard Tausch und Ruth Cohn, die in der Tradition
der
Humanistischen Psychologie das Humane im Menschen und dessen, in seinem Inneren
noch schlummernde Potenziale zu fordern beabsichtigten, einen markanten Anteil daran, dass
Schulz von Thun letztlich zu diesem
empathischen Lehrer werden sollte, der als Akademiker
und Therapeut für eine Praxis stand, die metaphorisch gesprochen, wie er dies gerne tut
nebst der
Kopf-Arbeit, ferner Fuß, Hand und eben auch das Herz berücksichtigt (Schulz von
1
Das
Wertequadrat verdankt Schulz von Thun (2000b: 38) Paul Helwig. Er entwickelte es aus dem Grundver-
2
Dieser Prozess, die eigene Schüchternheit zu überwinden und die eigene Menschlichkeit zu entdecken, dauerte
lange an. ,,Als ich mit 32 Jahren Professor wurde, konnte ich sehr gut gelehrsam reden und sachliche Zu-
sammenhänge darstellen. Hingegen tat ich mich sehr schwer damit, auszudrücken, wie mir ums Herz war"
(Schulz von Thun 2013: 26).
4
Thun/Zach/Zoller 2012: 124).
3
,,Ich bin ursprünglich Kind zweier Eltern in der Psychologie,
das waren (und sind)
Reinhard Tausch und Ruth Cohn", sagte Schulz von Thun (2013: 61;
Hervorhebungen im Original) anlässlich von Tauschs 80. Geburtstag. ,,
Der Schüler lernt den
Lehrer", betont der chilenische Biologie Humberto Maturana (zit. n. Schulz von Thun/Pörksen
2014: 164, Hervorhebungen im Original), und ganz sicher trifft auch dies zu. Ferner hatte
Schulz von Thun freilich selbst erst jenen biografischen Weg der Auseinandersetzung mit
seinem ,,Inneren Menschen" gehen müssen, ehe er sich selbst, seiner Rolle im akademischen
Umfeld und letztlich seinem Metaideal der ,,Stimmigkeit" und der daraus resultierenden
,,Beratung mit doppelter Blickrichtung" bewusst werden konnte. Erst durch eine eigene
,,Selbstklärung" konnte ihm vermutlich ein solcher Reifeprozess gelingen, welcher sein Ver-
ständnis von stimmiger Kommunikation maßgeblich prägte: einer Kommunikationspsycho-
logie, die dem Bedürfnis Rechnung trägt, Vermittler zu sein, sich als ein Brückenbauer
zwischen zwei Paradigmen zu betrachten, die zuvor als miteinander unvereinbar galten: dem,
der Humanistischen Psychologie
und weiterhin dem systemischen Denken von bspw. einem
Paul Watzlawick (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 14). Er wollte beides ergründen, beides
gehörte für ihn zum Mensch-Sein: das ,,Innen" und das ,,Außen", das ,,System im Menschen"
und der ,,Mensch im System" (nach Helm Stierlin; Schulz von Thun/Zach/Zoller 2012: 213). Er
hatte selbst angeleitet von Ruth Cohn seine ,,Inneren Stimmen" und ,,Teammitglieder" erst
eruieren, sie erst kennenlernen und anhören müssen, um zu jenen Einsichten zu gelangen, die
schließlich in dem bahnbrechenden Modell des
Inneren Teams mündeten. Wie Carl Rogers
(Groddeck 2002: 12), dessen gelebter Humanismus ihn ebenfalls prägte, hatte Schulz von Thun
in seiner akademischen Laufbahn von den Kollegen mitunter einen Mangel an Aufmerksam-
keit und Akzeptanz erfahren, da er mit Paradigmen brach, sie vermengte, ,,Gulasch machte",
wie ihn Watzlawick später einmal warnen sollte (Schulz von Thun 2011: 329). Weil er darüber
hinaus mehr an der praktischen Relevanz und an der Einfachheit seiner Modelle interessiert
war, denn an allzu viel Wissenschaftlichkeit (und der damit einhergehenden Abstraktion von
Wissen), wurde er von der ,,Scientific Community" nicht immer als ihr vollwertiges Mitglied
3
Schulz von Thun steht für eine therapeutische Praxis, die neben theoretischen Modellen und Vorträgen
(,,Kopf"), über die Erkundung des systemischen Umfeldes (,,Fuß") eben auch die Erkundung des ,,Inneren
Menschen", dessen Gefühl und Bestrebungen, berücksichtigt (,,Herz") und dem Coach im Umgang mit dem
Klienten dennoch ein gewisses Basisverhalten, etwa das Aktive Zuhören, mit auf den Weg gibt (,,Hand"),
letzteres aber stets in Abwägung zu den spezifischen und individuellen Gegebenheiten des Patienten und der
Situation betrachtet (Metaideal der ,,Stimmigkeit").
5
betrachtet (Quittmann 1996: 16).
4
Seine Psychologie sei ein Versuch, ,,das ,Menschliche' und
das ,Professionelle' zusammenzuführen" (Schulz von Thun 2013: 8 und 11). Sie sei ein Weg,
die Geheimnisse des Zwischenmenschlichen aus den Universitäten heraus zu bringen und sie
für den gewöhnlichen Menschen verständlich zu machen, anstatt die Einsichten in eine gelun-
gene Kommunikation ,,im Geheimkabinett einzuschließen" (Ebd.: 77). Damit war Schulz von
Thun manchem Wissenschaftler und zuweilen sogar marxistischen Gruppen, die in Hamburg
seine Vorlesungen gestört hatten, ein Dorn im Auge gewesen (Schulz von Thun/Pörksen 2014:
49). Und irgendwann wollte er einfach keiner mehr von ihnen sein:
,,Und schließlich habe ich irgendwann die Lebensentscheidung getroffen, nicht mehr in Fach
kongressen aufzutauchen und in Fachzeitschriften präsent zu sein, sondern Taschenbücher zu
schreiben und unter die Leute zu gehen. Natürlich hat diese Entscheidung eine weitere Universitäts-
karriere nahezu unmöglich gemacht, aber das war angesichts der gewonnenen Lebendigkeit und
auch der Reputation außerhalb der Scientific Community leicht zu verschmerzen." (Ebd.: 48)
Der Erfolg gibt ihm Recht. ,,[E]in Star, der keiner sein will" sei er, stellt Bernhard Pörksen (mit
Schulz von Thun 2014: 9) fest; einer, der geprägt von einer Bescheidenheit und einer Lehre ist,
die sich als zutiefst liberal betrachtet und beinahe jedem andersdenkenden Einfluss seine
Berechtigung gibt (Ebd.: 14). Es ist einerseits die radikale Einfachheit und gleichsam die
ungemeine Tiefe und Schärfe seiner Modelle, die den Gewinn seines Werkes ausmachen.
Und doch hat sich Schulz von Thun jene hanseatische Zurückhaltung, die eingangs erwähnt
wurde, bis zuletzt bewahrt. Nach wie vor sieht er sich als Versöhner zwischen den Paradigmen,
als Mediator im Zwischenmenschlichen, der die Harmonie innerhalb des angesprochenen
Dualismus sucht und weit davon entfernt ist, in seiner Lehre eine absolute, endgültige
Wahrheit zu erkennen. Er will kein Entweder-Oder-Denken manifestieren oder angehenden
Coaches eine therapeutische Schablonentechnik mit auf den Weg geben. Stattdessen hat er ,,die
kommunikationspsychologischen Angebote verschiedener Schulen zu einer Gesamtschaut
integriert und für die Praxis formuliert" (Schulz von Thun 2000b: 12).
4
Einen Gedanken, den man teilen kann: Denn welchen Sinn hätte die Disziplin der Kommunikationsforschung,
wenn es bei ihrer Übermittlung gerade an ihrem Forschungsgegenstand, der Kommunikation, scheitern würde?
Von Beginn an versuchte er die Wissenschaft für die Praxis aufzubereiten und eine Psychologie der Kommuni-
kation zu erschaffen, die nicht zwangsläufig neues Wissen generieren, sondern die vorhandenen Kenntnisse für
eine breites Publikum zugänglich machen sollte. Eine Idee, die Reinhard Tausch in ihm zutage gefördert hatte.
,,Du hast mich damals sensibilisiert für das Damoklesschwert der Psychologie: die Fehlakademisierung, die
darin besteht, nach ausgeklügeltem Fachwissen, raffinierten Diagnose- und Interventionssystemen dort zu
fragen, wo Rückbesinnung auf elementare Menschlichkeit gefragt wäre. Der Elfenbeinturm [Anspielung auf
George A. Millers Anliegen aus den 1960er-Jahren, die Psychologie an der Praxis und weniger an der aka-
demischen Sphäre auszurichten: ,,To give psychology away"; Schulz von Thun/Pörksen 2014: 48] war nicht
deine Heimat und ist es für alle, die mit dir zu tun hatten, nie geworden", sagt Schulz von Thun (2013: 72) in
einer Laudation über seinen Mentor und damit ein bisschen über sich selbst.
6
1.2.
Die ewige Mitte
Liest man das umfangreiche Werk des Hamburger Kommunikationspsychologen jedoch ge-
wissenhaft, so wird einen der Eindruck nicht los, dass sich Schulz von Thun im dialektischen
Verhältnis zweier Pole immerzu als ,,die Mitte"
betrachtet.
5
Stets ist er seinen eigenen Meta-
idealen stringent folgend um eine ,,stimmige, wesens- und situationsgerechte Lösung" be-
müht, immer versucht er scheinbar konträre Standpunkte miteinander zu kombinieren. Und
kaum einmal positioniert er sich eindeutig. Man gewinnt fast den Eindruck, als wolle er dies,
seinem Harmoniebedürfnis folgend, um jeden Preis vermeiden, als scheue er den Konflikt, den
eine etwaige Positionierung hervorrufen könnte. Was der Leser in Schulz von Thuns Büchern
bspw. vermisst, ist eine Einordnung seiner Modelle in die Sphären der Erkenntnistheorie. Ihm
scheint an der Funktionalität der Modelle für die therapeutische Praxis mehr gelegen zu sein,
als an deren Einordnung in eine quasi-philosophische Metaebene. Pörksen erklärt er dies:
,,Es ist tatsächlich erstaunlich, dass ich mich mit solchen Problemen nie wirklich herumgeschlagen
habe [...]. In meinem Normalleben bleibt das Bewusstsein vom Mysterium des Seins ganz im Hinter-
grund. Die Figur im Vordergrund besteht aus dem realitätsgerechten Pragmatismus der alltäg-
lichen Angelegenheiten, die mich ganz in Beschlag nehmen."
(Ebd.: 186)
Erstmals äußert sich Schulz von Thun mit Pörksen als Gesprächspartner in
Kommunika-
tion als Lebenskunst (2014), das erst dieser Tage erschienen ist, zu seiner Erkenntnistheorie. Er
beschreibt sein ,,humanistisch-systemisches Menschenbild" (Schulz von Thun 2013: 120), das
den Menschen in einem dialektischen Verhältnis zwischen äußerer Einwirkung und Abhängig-
keit (,,Mensch im System") und innerer Individualität und Autonomie (,,System im Mensch")
angesiedelt sieht. Doch greift dieser Dualismus nicht zu kurz? Nun würde sich Schulz von
Thun tunlichst davor hüten, sich selbst als Konstruktivisten zu bezeichnen. Und damit ist der
Kommunikationspsychologe in guter Gesellschaft. Denn selbst die Begründer der konstruk-
tivistischen Erkenntnistheorie können mit dem Begriff des
Radikalen Konstruktivismus
6
und
5
Diese Balance zwischen den Extremen möchte er jedoch nicht als einen fixierten, einen statischen Mittelwert
(im Sinne von Aristoteles'
Tugend der Mitte) verstanden wissen, der suggerieren würde, dass es den einen
(Mittel-)Weg gäbe, der womöglich konkret, quasi-mathematisch ermittelt werden könnte. Stattdessen muss ein
jeder
seine Mitte für sich finden, sie immer wieder neu konstruieren und sich letzthin einem immerfort
währenden Aushandlungsprozess zwischen den Polen hingeben. Er spricht daher (hier bezogen auf das
Werte-
und Entwicklungsquadrat) von einer ,,dynamischen Balance, die aus der Verbindung des Unterschiedlichen und
zunächst unvereinbar Erscheinenden eine dritte Qualität entstehen lässt, eine ,,Regenbogenqualität" (Schulz von
Thun/Pörksen 2014: 117; Hervorhebung im Original). Dieser Vorgang ist als Prozess zu verstehen, der, nie
abgeschlossen, eine fortwährende Selbstreflektion/Selbstklärung voraussetzt.
6
Schon an dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, dass es den
einen Konstruktivismus nicht gibt (Pörksen
2011: 15). Er stellt letztlich ein Denkkonstrukt dar, das sich aus einigen Grundpostulaten speist, aus denen in-
dessen verschiedene Vertreter, Denkschulen und wissenschaftliche Fachrichtungen unterschiedliche Schluss-
folgerungen gezogen haben.
7
jenem Formalismus, der eine solche Kategorisierung mit sich bringt, nur wenig anfangen. Sie
weigern sich, in eine Schublade von Begriffen und Definitionen gesteckt zu werden, denn
genau dies würde dem Konstruktivismus jene Erklärungsgewalt rauben, die ihn schließlich
auszeichnet. Er ist ,,nur"
ein Angebot, die Welt zu sehen, er lehnt einen absoluten Gültigkeits-
anspruch ab. ,,Der radikale Konstruktivismus begreift sich selbst als eine Konstruktion und
nicht als eine letzte Wahrheit, er ist eine Möglichkeit, die Dinge zu sehen (Watzlawick/Pörk-
sen 2011: 345). Er ist letztlich selbst nur ein Konstrukt, eine Heuristik.
7
,,Es sagt uns nichts
und kann uns nichts darüber sagen wieviele andere Wege es da geben mag und wie das Erleb-
nis, das wir als Ziel betrachten, mit einer Welt jenseits unserer Erfahrung zusammenhängt"
(von Glasersfeld 2006: 23). Der chilenische Biologe Humberto Maturana, der als Begründer
eines konstruktivistischen Blickes auf den Prozess menschlichen Erkennens gilt, vermeidet die
Nennung des Begriffes.
8
Watzlawick, dessen fünf
Axiome
9
der Kommunikation zum Teil
Eingang in Schulz von Thuns Modelle fanden
10
, prägte zwar den Begriff des ,,Radikalen Kon-
struktivismus", bezeichnet sich zuweilen aber selbst lieber als ,,Wirklichkeitsforscher" (Kreu-
zer/Watzlawick 1988: 9).
11
Francisco Varela
12
kritisiert den Konstruktivismus mittlerweile
7
Bei Heinz von Foerster (mit Pörksen 2002: 24-26; Hervorhebungen im Original) wird diese Aversion gegen
festgelegte Terminologien und absolute Begrifflichkeiten besonders deutlich. Aufgrund des Mediums der
Sprache, so sagt er, sei es aber unvermeidbar, dass Gesagtes und Geschriebenes den Eindruck von unverrück-
baren Wahrheiten suggeriere. Wer sage, ,,etwas
ist", also einen ,,existenziellen Operator" verwende, der gebe
diesem Etwas bereits einen gewissen Absolutismus mit auf den Weg. Von Foerster möchte dieses Problem mit
der Einführung eines
,,selbstreferenziellen Operators" lösen, der jedem Ausdruck die Subjektivität dessen, der die
Aussage tätigt, anheftet. ,,Ich finde...", ,,Ich bin der Meinung ..." etc.
sind solche Operatoren oder besser:
könnten
sein.
8
,,Ich selbst begreife mich nicht als einen Vertreter des Konstruktivismus, auch wenn man mich noch so oft als
einen solchen bezeichnet." Maturana bezeichnet seine biologisch geprägte Erkenntnistheorie halb im Scherz als
,,Superrealismus" (Maturana/Pörksen 2014: 33).
9
Darunter sind generell allgemein gültige Wahrheiten zu verstehen, die keines Beweises bedürfen. Für Watzla-
wick/Beavin/Jackson (2000: 50) sind es ,,die einfachsten Eigenschaften der Kommunikation".
10
In der Einführung zu
Miteinander Reden 1 nennt er seine Inspiratoren konkret: Carl Rogers, Alfred Adler, Ruth
Cohn, Fritz Perls und Paul Watzlawick werden dort aufgeführt (Schulz von Thun 2000a: 13).
11
Der Begriff ,,Konstruktivismus" taucht bei Watzlawick selbst erst recht spät auf. Er verwendet ihn erstmals in
seinem Sammelband zum Radikalen Konstruktivismus, dem Buch
Die erfundene Wirklichkeit, das 1981 erstmals
erschien (Simon 2011: 226). ,,Alle [konstruktivistisch geprägten Lesearten] stehen für psychisch-philosophisch-
erkenntnistheoretische Ansätze, die davon ausgehen, dass individuelle Weltbilder durch eine Geschichte von
Interaktionen, die ein Individuum mit seiner physischen und sozialen Umwelt erfährt, geformt und aktiv
,konstruiert' werden" (Simon 2008: 68).
8
(Pörksen 2002: 15) und Heinz von Foerster leugnet ohnehin, irgendeine Erkenntnistheorie zu
vertreten.
,,[I]ch bin Wiener", sagt er dazu (von Foerster/Pörksen 2013: 43). Schulz von Thun
passt in diese Reihe: Seine Lehre stellt letztlich ebenfalls eine Heuristik dar. Sie könne ein
Kompass für das Zwischenmenschliche sein, doch nicht die Fackel, die dem Suchenden den
Weg zur ewigen Wahrheit leuchtet (sinngemäß bei Schulz von Thun/Pörksen 2014: 40). Sie ist
ein Angebot, die Welt zu sehen, die keinen Zwang ausüben möchte, sondern dazu einlädt, sich
als Mediator zwischen dem System (dem Kontext) und der eigenen Autonomie (der Selbst-
reflexion und der persönlichen Entwicklung) zu begreifen. Er habe keine endgültigen Wahr-
heiten dabei, meint Schulz von Thun zu Pörksen (2014: 186), weil man diese stets individuell,
stimmig, eben wesens- und situationsgerecht für sich selbst finden müsse. Nicht anders würde
der Konstruktivismus argumentieren.
1.3.
Aufbau der Arbeit oder: Ein Hauch von Konstruktivismus
Dass er das systemische Denken verinnerlicht hat, ohne es indessen zu absolutieren, leugnet
Schulz von Thun nicht im Gegenteil: Seine Orientierung an Watzlawick, Mitbegründer der
systemisch-konstruktivistischen Therapie, lässt diesen Schluss ohnehin offensichtlich werden.
Und obwohl Schulz von Thun unter anderem auch auf Paul Watzlawicks Verständnis von
Wirklichkeit erster respektive zweiter Ordnung Bezug nimmt (bspw. 2011: 329), sucht man in
seinem Nachschlagwerk
Miteinander Reden von A bis Z (2012) unter ,,K" vergeblich nach
einem Eintrag für ,,Konstruktivismus". Doch dieser sollte darin eine Erwähnung finden. Denn
schon sein Kommunikationsquadrat mit den ,,vier Seiten einer Nachricht" und den ,,vier
Ohren und Schnäbel" der Interagierenden ist eine konstruktivistische Schöpfung, so die
These dieser Arbeit. Nicht nur, dass er sich bei den vier Seiten zum Teil beim Konstruktivisten
Watzlawick bediente, auch die bloße Annahme, dass ein kommunikativer Akt nie eine eindeu-
tige, absolute und objektive Wahrheit transportieren kann, sondern stets einer individuellen
und damit subjektiven Sinngebung unterliegt, kann als konstruktivistisch beschrieben werden.
12
De facto verneint er, sich je als Konstruktivisten gesehen zu haben. ,,Der klassische Konstruktivismus erscheint
mir keineswegs als eine einleuchtende Idee, da er die eine Seite im Erkenntnisprozess verabsolutiert" (Varela/
Pörksen 2002: 118). Varela schlägt bei der Erklärung von Kognition einen Mittelweg zwischen der Objektorien-
tierung
des
Realismus (vom Erkannten zum Beobachter; siehe auch Fußnote 49) und der subjektorientierten
Auslegung
des
Konstruktivismus (vom Beobachter zum Erkannten) vor. Subjekt und Objekt seien im Prozess
der Wahrnehmung nur im Wechselspiel denkbar, sie bilden eine ,,
Ko-Konstruktion" der Wirklichkeit, ein
Anfang im Sinne der berühmten Ei-Huhn-Problematik ist nicht feststellbar. ,,Beide existieren nur in
wechselseitiger Abhängigkeit und in gegenseitiger Bestimmung [...]. Die Entscheidung für das Subjekt oder
Objekt enthält bereits eine Definition des Erkennens und des Wissens, das man eigentlich erforschen will"
(Ebd.: 117 und 119; Hervorhebungen im Original). Wie auch für seinen Weggefährten Humberto Maturana ist
damit das Überleben eines Systems (aufgrund unter anderem seines Wahrnehmungsapparats) das einzig gültige
Kriterium seiner Wahrheit. ,,Wahr ist [...], was funktioniert" (Ebd.: 122).
9
Jede Aussage kann auf vier Ebenen empfangen werden, sie weist damit ein multiples Angebot
von Bedeutung auf. Dies ist wenn man so will die ,,verborgene", die konstruktivistische
Seite des Quadrats, das Schulz von Thun aber nie explizit als ein konstruktivistisches Element
begreift, und das an späterer Stelle nochmals aufgegriffen werden soll.
Ziel dieser Arbeit ist es daher weniger die Modelle Schulz von Thuns auf ihre Funktionalität zu
prüfen oder diese zu erklären (die Kenntnis des Werkes Schulz von Thuns wird weitgehend
vorausgesetzt), vielmehr soll seine Lehre eine erkenntnistheoretische Einordnung erfahren und
entlang der Genese von dessen Kommunikationspsychologie aufgezeigt werden, welchen An-
teil einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie Schulz von Thuns Modelle tatsächlich auf-
weisen. Es wird die These vertreten, dass Schulz von Thun konstruktivistischer ,,denkt", als er
das selbst äußert. Dazu soll das Werk Schulz von Thuns in dem nun folgenden Schritt näher
beschrieben werden: Wie gelingt ihm der Spagat zwischen einem systemisch(-konstruktivis-
tisch) geprägten Blick auf die Kommunikation und der Berücksichtigung des Einzelnen, welche
ihren Ursprung in der Individualpsychologie hat? Wie verbindet er in seinen Modellen den
Blick auf den ,,Menschen im System" mit der Beschäftigung mit dem ,,System im Menschen"?
Es soll im folgenden Kapitel gezeigt werden, was den angesprochenen Dualismus ausmacht, an
dem sich Schulz von Thun wohl als Erster versuchte. Dazu widmet sich diese Arbeit im zweiten
Kapitel und in aller Kürze dem ,,Inneren Menschen" und damit der Humanistischen
Psychologie. Bei wem bediente sich Schulz von Thun, als er etwa das Modell des Inneren
Teams erfand? Seinen Fokus richtet der vorliegenden Text derweil auf das systemische Denken
und den Radikalen Konstruktivismus, die im Hinblick auf die Ausgangsfrage und die
Hypothese eines vermeintlich partiell konstruktivistisch geprägten Schulz von Thuns daher
auch eine fundierte Darstellung verlangen. Dies soll in den Kapiteln drei und vier geschehen, in
denen die Grundpostulate der systemischen Lehre sowie des Konstruktivismus aufgearbeitet
werden. Die Übertragung dieser beiden Denkrichtungen auf das Werk von Schulz von Thun
geschieht schließlich im fünften und sechsten Kapitel. Warum ist Schulz von Thun ein
Systemiker, weshalb ein Konstruktivist? Und was macht ihn dennoch einzigartig besser, was
unterscheidet ihn von klassischen Vertretern dieser Perspektiven? Im vorletzten Kapitel wird
versucht, die ,,Erkenntnistheorie eigenen Rechts, von der eine weltabgewandte Wissenschaft
nichts weiß und auch nichts wissen will" (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 11), welche Schulz
von Thun letztlich einzigartig macht, zu erläutern, ehe die Arbeit mit einem Resümee ihr Ende
findet.
10
2. Das Rezept von Schulz von Thuns ,,Gulasch"
Die Summe zweier Halbwahrheiten.
2.1.
Eine einzigartige Dialektik: Zum Verhältnis von Innen und Außen
Wie sieht nun das ,,(Gulasch-)Rezept" aus, vor dem Watzlawick den jungen Schulz von Thun
einst in seinem Büro in Palo Alto gewarnt hatte?
13
Aus welchen Denkschulen und Modellen
setzt sich das Werk Schulz von Thuns zusammen? Auch hier kann nicht jedes Modell einzeln
beschrieben werden, zum Teil werden die Inspiratoren, derer sich Schulz von Thun bediente,
aber zugewiesen. Wie im ersten Kapitel beschrieben, kombiniert er in seinen Modellen den
systemisch-(konstruktivistischen) Blick mit der Tiefenpsychologie des Individuums.
2.2.
Die Entdeckung des Inneren Menschen
Während seiner akademischen Laufbahn galt sein Augenmerk zunächst den äußeren Ge-
gebenheiten, die den Menschen in seiner Art und Weise zu kommunizieren prägen. Den
,, Menschen im System", den galt es zu erfassen, um dessen Verhalten nach außen hin, im
zwischenmenschlichen Diskurs, zu optimieren. Als Schulz von Thun Anfang der 1970er
nach Hamburg an den Lehrstuhl von Reinhard Tausch gekommen war, da dämmerte es
ihm, dass die systemische Herangehensweise indessen nur eine Seite eines gewinnbringen-
den Kommunikationstrainings darstellen kann. Mit Inghard Langer und Bernd Fittkau
hatte er Verhaltensseminare für bspw. Eltern und Lehrer, später dann für Führungskräfte
aus der Wirtschaft
14
angeboten und dabei zunächst die Individualität der Menschen außer
Acht gelassen, ergo das ,,System im Menschen":
,,Wir hatten den inneren Menschen übersehen und übergangen, der wir in Wahrheit sind und der
mit den optimierten Sprechblasen oft wenig zu schaffen hatte. Wir mussten erkennen, dass wir die
unsägliche Spaltung zwischen innerer Wahrheit und äußerem Auftreten mit den Mitteln der Schu-
lung noch vorangetrieben hatte [...]. In dem wir alle mit denselben Standardlektionen und Standard-
übungen beglückt haben, haben wir manchmal das Richtige den falschen Leuten beigebracht."
(Schulz
von
Thun
2013:
23ff)
13
Die Anekdote ist nachzulesen in Trude Trunks Lesebuch zu Paul Watzlawick (Schulz von Thun 2011: 327-331).
14
Gemeint sind die immer wieder angesprochenen BP-Seminare, an die sich Schulz von Thun (2013: 67-69) etwa
in
Klarkommen mit sich selbst und mich anderen (2013) erinnert. Darin versuchten seine Mitstreiter und er die
Kommunikationspsychologie für die Praxis aufzuarbeiten und sie für den Laien handfester und greifbarer zu
gestalten. Schulz von Thuns Weg als theoretischer Denker, dem mehr noch an der praktischen Anwendung
seiner Modelle gelegen ist, war damit geebnet. Es reifte in ihm die Erkenntnis, ,,[d]ass es ein Segen ist, wenn ein
Professor seine Studenten auch mal mitnimmt und ihnen eine Brücke von Universität in die Praxis baut.
Damals habe ich deine Brücke [Tausch hatte den Auftrag gegeben] dankbar betreten, und nicht zuletzt diese Ur-
erfahrung war es, die mich heute selber solche Brücken bauen lässt" (Ebd.).
11
Tausch, Wegbereiter der
Gesprächstherapie, gab ihm ,,die Verbindung von Gelehrsamkeit und
menschlicher Haltung, Wertschätzung, Teilhabe und wohlwollender Förderung und Forde-
rung" (Plate 2013: 57) mit auf den Weg Attribute, welche die Mentorin Ruth Cohn in ,,ihrem
Friedo"
15
später noch verstärkte. Denn als Schulz von Thun ab 1977 bei Cohn in die Lehre
ging, entdeckte er vollends den Reiz der Humanistischen Psychologie, die den ,,Inneren Men-
schen" zum zentralen Gegenstand der therapeutischen Praxis erhebt. Aus seiner Beschäfti-
gung mit der inneren Pluralität des Menschen, sowie der Einsicht, dass eine förderliche Kom-
munikation zwar einen Prozess der Selbstklärung voraussetzt und damit identitätsgerecht
(Schulz von Thun 2000c: 15) sein muss, allerdings keineswegs vorbehaltlos authentisch sein
darf, sondern Cohns Ideal der ,,selektiven Authentizität" folgen muss, gleichermaßen also der
jeweiligen Situation und so dem System (situations-)gerecht werden sollte, entwickelte er sein
,,systemisch-humanistisches Menschenbild" und sein spezifisches Ideal der Kommunikations-
lehre: das der ,,Stimmigkeit" (Schulz 2012: 91).
2.3.
Die Humanistische Psychologie
2.3.1. ,,Die dritte Kraft"
Die Humanistische Psychologie, die Ende der 1960er von den USA aus in Richtung Deutsch-
land kam, versuchte integrativ die Annahmen verschiedener Denkströmungen zu verbinden
(Hutterer 1998: 20). Sie ging folglich genau so vor, wie es Schulz von Thun in seinen Modellen
getan hat: sie kombinierte, integrierte und verband. In ihrer Gründerzeit emanzipierte sich die
Humanistische Psychologie als ,,dritte Kraft" neben der
Psychoanalyse und den Behaviorismus.
Passend zu Schulz von Thun positionierte sie sich in jenem Dreiklang in der Mitte. Und anders
als die beiden vorherrschenden Schulrichtungen stand die Humanistische Psychologie für ein
durchweg optimistisches und holistisches Menschenbild, welches die Wertewelt Schulz von
Thuns fortan prägen sollte (Schulz von Thun 2013: 122). Die Psychoanalyse
mit ihren Ver-
tretern Sigmund
Freud und C.G. Jung rückt den ,,kranken" Menschen und dessen un(ter)-
bewusste Triebe in den Vordergrund, dessen defizitärer Zustand bspw. aufgrund von Kind-
heitstraumata und eigentlich immer anhand von früheren Erfahrungen erklärt wird. Sie nimmt
also einen vergangenheits- und defektorientierten therapeutischen Blick ein, der den Kontext
16
15
In einem Gespräch aus dem Jahre 1993, das in
Klarkommen mit sich selbst und mit anderen abgedruckt ist
(Schulz von Thun 2013: 87-118), wird der junge Schulz von Thun als ,,Friedo" bezeichnet.
16
,,Der Kontext ist die Gesamtheit aller Elemente des Milieus, dessen Attribute das System beeinflussen oder
von diesem beeinflußt werden." Er wird oft gesellschaftlich oder kulturell konstruiert (Marc/Picard 1991: 33).
12
des Einzelnen in der Behandlung außen vor lässt und stattdessen eine Individuumszentrie-
rung bevorzugt; die Therapie wählt die Introspektive, der Blick richtet sich auf das Bewusstsein
des einzelnen Menschen (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 131; Watzlawick/Beavin/Jackson
2000: 22). Denn der Mensch sei nicht ,,Herr im eigenen Haus", wie es Freud ausdrückte,
sondern ein Produkt seiner Triebe und Erfahrungen. Die angewandte Psychotherapie
analy-
siert folgerichtig das unbeobachtbare Unterbewusstein, etwa die Träume des Patienten.
17
Ebendem, den nicht zu beobachtbaren Prozessen der menschlichen Psyche, kehrte der Beha-
viorismus zum Beispiel in Form der
Verhaltenstherapie den Rücken. Die von John B. Watson
mitbegründete Denkschule brachte die Psychologie mit den Naturwissenschaften in Verbin-
dung, sie vollzog damit den Weg vom Unterbewusstsein ins Labor. Das nicht abschließend zu
analysierende Bewusstsein spielte im Behaviorismus keine Rolle mehr, ihm war mehr an den
sichtbaren Manifestation, sprich dem Verhalten des Menschen gelegen, welches es zu inter-
pretieren galt. Watson sah in letzterem eine Herangehensweise,
,,nach [der] die Psychologie sich auf das beobachtbare und messbare Verhalten beschränken sollte,
unter vollständigem Verzicht auf die Beschreibung von Bewusstseinsinhalten. Ebenso sollten
psychologische Theorien nur Begriffe enthalten, die sich auf objektives im physikalischen Sinn
beziehen, und Inhalte vermeiden, die nur durch Introspektion (Denken, Fühlen, Wahrnehmen)
gegeben sind".
(zit. n. Müller 2013: 253)
Der Behaviorismus, mit seinem namhaften Vertreter Burrhus F. Skinner, betrachtet den Men-
schen als endlos konditionier- und formbar. Die Umwelt sei es, die dem Individuum sein Ver-
halten diktiere (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 131). Der Mensch ist damit keineswegs frei in
seinen Entscheidungen, sondern durch ,,das Außen" (Gesellschaft, Kultur, etc.) entscheidend
beeinflusst. ,,Wir können uns mit dem Verhalten eines Systems nicht auseinandersetzen, wenn
wir uns ganz in ihm aufhalten; wir müssen uns schließlich und endlich den Kräften zuwen-
den, die auf den Organismus von außen her einwirken" (Skinner 1975: 21). Das sichtbare Ver-
17
Eine eindrückliche Kritik an diesem Vorgehen findet sich bei den systemisch-konstruktivistischen Therapeuten
Watzlawick/Beavin/Jackson (2000: 45-47). Sie argumentieren, dass es letztlich unentscheidbar sei, was
bewusst
und
was
unbewusst ablaufe und dies stattdessen eine subjektive und externe Beurteilung des Verhaltens des
,,Kranken" darstelle. Die menschliche Psyche müsse vielmehr als ,,Black Box" betrachtet werden, die von außen
nicht erforscht werden könne, weil sie für den Therapeuten unzugänglich sei. Erkenntnisse über das ,,Innen-
leben" des Patienten basieren letzten Endes auf dessen Selbstaussagen; sie sind subjektiv, immer verzerrt, weil sie
sich des Mediums der Sprache bedienen. Man müsse stattdessen das Verhalten des Patienten eruieren, weil
dieses eine Manifestation des Inneren nach Außen bedeute. Sie leugnen derweil nicht, dass erst vergangene
Erlebnisse ein pathologisches Verhalten generieren können, doch dürften diese keine Rolle in der Therapie
spielen, da dieselbe ,,Krankheit" auf zahlreiche unterschiedliche Wege zustande gekommen sein könne. Diese
Kritik Watzlawicks erstaunt, hat dieser doch zunächst selbst eine Jung'sche Ausbildung genossen. Seine Abkehr
von der Psychoanalyse, die im vergangenen Verhalten des Patienten ,,Einsicht" sucht, erklärt Watzlawick im
Dialog mit Pörksen (2011: 348): ,,In meiner beruflichen Laufbahn und in meinem eigenen Leben ist es mir
nicht ein einziges Mal gelungen, diesen magischen Effekt der Einsicht zu erleben oder gar hervorzuheben."
13
halten wurde in ein Reiz-Reaktions-Muster verwandelt und entsprechend interpretiert. Das
machte Psychologie messbar.
2.3.2. Potenzial
und
Menschenbild
Während die beiden zuletzt angesprochenen Denkschulen ein pessimistisches Menschenbild
vorschlugen, welches das Individuum als unfrei ansieht, und das letztlich jedweder indivi-
duellen Kreativität, Freiheit, Spontanität, Verantwortung und Entwicklungsfähigkeit eine
Absage erteilt, war es schließlich die Humanistische Psychologie, welche das Individuum als
autonom und selbstbestimmt betrachtete. Im Manifest der ,,Association for Human Psycho-
logy" (AHP) aus dem Jahre 1962 sind die programmatischen Aussagen dieser psychologischen
Denkrichtung formuliert (Hutterer 1998: 19). Der Mensch wird hier im Unterschied zu den
angesprochenen Schulen keineswegs als ein deterministisches Wesen betrachtet, das etwa vor-
behaltlos von unterbewussten Kräften oder äußeren Einflüssen gesteuert wird (Quittmann
1996: 14). Zwar räumen Carl Rogers, Ruth Cohn, Fritz Perls, Juan Moreno und die weiteren
Vertreter dieses personenbezogenen und problemzentrierten Ansatzes ein, dass zwischen-
menschliches Verhalten und damit Kommunikation
18
auch vom Kontext, also dem System, in
dem der Einzelne agiert und in das er hineingeboren wird, geprägt sei, und die Genese der
Persönlichkeit gleichsam von vergangenen Mangelerfahrungen bestimmt sein könne (Schulz
von Thun/Pörksen 2014: 131), sie postulieren allerdings ein optimistisches Bild des Menschen,
nach dem der Einzelne in diesem Ist-Zustand nicht verharren muss. Der Mensch wird betrach-
tet als ein Wesen, das im Unterschied zum Tier zu einem ,,bewussten Erleben
"
19
fähig ist, das
über sich selbst sinniert, daher zielgerichtet und zielorientiert, das heißt entlang klarer Werte
18
Schulz von Thun setzt dies als Folge des Axioms von Watzlawick/Beavin/Jackson (2007: 53), man könne nicht
nicht kommunizieren, ebenfalls gleich. An anderer Stelle verweigert er sich aber einer Definition von ,,Kom-
munikation". Ein jedes Gespräch definiere Kommunikation besser als es eine Definition leisten könne. Und
doch verneint er Watzlawicks Axiom nicht: ,,Ihr Wesen besteht in einer energetischen Verbindung, die etwas
entstehen lässt, das man alleine gar nicht zustande bringen würde" (Schulz von Thun/Pörksen 2014: 52).
19
,,Erleben" und ,,Erfahrung" sind bspw. zentrale Begriffe und Bestandteile des Person-zentrierter Ansatzes
von Carl Rogers, die auch Schulz von Thun prägen sollten. Unter ,,Erfahrung" wird all das verstanden, ,,was
sich innerhalb des Organismus in einem bestimmten Augenblick abspielt und was potenziell der Gewahr-
werdung zugänglich ist" (Rogers, zit. n. Höger 2006: 58). ,,Erfahrung" beschreibt entgegen des gewöhnlichen
Sprachgebrauchs hier indes eine aktuelle Situation und Empfindung, sie spielt sich im Jetzt ab und nicht im
Gedächtnis des Vergangenen. Das ,,Erleben" ist wiederum ,,[...] der Prozeß, der alles dem Bewußtsein
Zugängliche erfaßt, was innerhalb des Organismus vor sich geht" (Rogers/Schmid 1991: 213).
14
und Ziele agiert (Höger 2006: 42).
20
Damit richtet sich diese psychologische Betrachtungs-
weise gegen ihre Vorgänger. Die Humanistische Psychologie vertritt die These, ,,daß die
Person in sich selbst ausgedehnte Ressourcen dafür hat, sich selbst zu verstehen und ihre
Lebens- und Verhaltensweisen [...] konstruktiv zu ändern, und daß diese Ressourcen am
besten in einer Beziehung mit bestimmten definierten Eigenschaften freigesetzt und verwirk-
licht werden können" (Rogers/Schmid 1991: 187.). Weil der Mensch potenziell in jeder Situa-
tion weitgehend
frei über sein Verhalten entscheiden kann, ist er (bis zu einem gewissen Grad)
entwicklungs- und wandlungsfähig (Quittmann 1996: 15). Fritz Perls (1974: 39) spricht jedoch
von einem Grundkonflikt des Menschen zwischen dem intrinsischen Bedürfnis, sich selbst zu
verwirklichen, und der Anforderung der Gesellschaft, sich gemäß von Rollenbildern einzu-
fügen. Diesen versuchte er mit der Gestalttherapie
21
aufzulösen. Der Mensch wird zwar in ein
Umfeld, einen Kontext und eine Familie geboren, er ist als Folge davon
auch das Ergebnis von
Erziehung und äußeren Einflüssen, doch ist er jederzeit in der Lage dazu, seine Lebenssituation
neu zu justieren, das ,,Jetzt" zu ändern gleichgültig, wie es zum ,,Jetzt" gekommen sein mag.
22
Im Gegensatz zu den bis dato gängigen psychologischen Herangehensweisen interessiert sich
die Humanistische Psychologie auch für den ,,normalen", den ,,gesunden Menschen", den sie
noch ,,besser" machen möchte. Es gilt, die inneren Potenziale des Menschen zur Entfaltung zu
bringen. Für Abraham Maslow (1968: 153) ist die angesprochene Selbstverwirklichung ,,a
single ultimate value for mankind, a far goal toward which all men strive". Der Mensch kann,
wenn er zu dieser Einsicht kommt, seinen Ist-Zustand reflektieren und für sich einen Soll-
Zustand formulieren, welchen er schließlich anstrebt. Er kann damit selbstbestimmt, autonom,
aktiv handelnd, ja quasi frei wählend sein. Für die Praxis folgt hieraus eine authentische
Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten, die zum Resultat hat, dass auch der
Therapierende fortwährend ,,mitwächst". Persönlichkeitsentwicklung ist deshalb dynamisch
20
Rogers/Schmid (1991: 211) bezeichneten diese Annahme als ,,Aktualisierungstendenz", sie drückt aus, ,,daß
der Mensch wie jeder andere lebendige Organismus [...] eine ihm innewohnende Tendenz hat, all seine Fähig-
keiten auf eine Art und Weise zu entwickeln, die der Erhaltung oder Steigerung des Organismus dient". Das
Streben nach Wachstum und Selbstverwirklichung kommt auch in Maslows (1941: 375)
Bedürfnispyramide
zur Geltung. Sie stellt die höchste Stufe der Bedürfnisbefriedigung dar, ist diese erreicht, so ist der Mensch ,,fully
human".
21
Die
Gestalttherapie will dabei helfen, das Spannungsverhältnis des Menschen zwischen gesellschaftlicher
Rollenerwartung und individueller Entfaltung zu lösen. Was wir spüren, ist keine existenzielle Sorge, sondern
die Angst, unsere uns angetragene Rolle nicht zu erfüllen. ,,Was wir anstreben, ist die Reifung des Menschen, ist,
die Blockierungen zu beseitigen, die einen Menschen davon abhalten, auf seinen eigenen Beinen zu stehen"
(Perls 1974: 44).
22
Ruth Cohns
Erlebnistherapie drückt eben dies aus: Es geht nicht darum zu analysieren, warum die Beziehungen
und das Zwischenmenschliche zu dem geworden sind, was sie sind sondern
wie sie im Hier und Jetzt sind
(Quittmann
1996:
192).
15
und kommt zustande ,,im Zug eines tief greifenden emotionalen und kognitiven Prozesses der
Selbstauseinandersetzung, die vom Therapeuten mehr oder weniger angeleitet und durch
Empathie, Akzeptierung und Echtheit gefördert wird" (Schulz von Thun 2013: 124). Das
Wechselspiel zwischen Therapeut und Klient darf daher nur bedingt eingeübt sein. Nicht die
therapeutische Methode rückt in den Vordergrund, sondern das Problem des Einzelnen als
solches, das somit ein individuelles therapeutisches Vorgehen beansprucht. Es geht um den
Ratsuchenden und weniger um die Methode selbst. Der Therapeut muss verständnisvoll
auftreten und sich ohne Vorbehalte für den Klienten interessieren; er muss sich als gleich-
berechtigter und fairer Partner verstehen, er muss selbst ,,Mensch werden" (Quittmann 1996:
194). So entwickelt sich des ,,Rätsels Lösung" erst aus der Dynamik der Interaktionspartner
heraus. Denn der Mensch wird als ein soziales Wesen betrachtet (Hutterer 1998: 17). Mensch-
liches Existieren ist damit nur in zwischenmenschlichen Beziehungen denkbar, im System.
23
Schulz von Thun (2013: 21) greift das auf: ,,Die Wahrheit beginnt zu zweit auch und gerade
auf der Beziehungsebene" (nach Friedrich Nietzsche). Er steht somit im fortwährenden
Wechselspiel zwischen dem Streben nach Individualität (dem Innen) auf der einen, und
Fremdbestimmtheit (dem Außen) auf der anderen Seite. Der Umstand, dass er jedoch in jeder
Lebenslage zwischen den ihm angebotenen Optionen frei wählen kann, macht derweil seine
,,Autonomie" aus. Bei Cohns
Themenzentrierter Interaktion (TZI)
24
kommt das zum Vor-
schein: ,,Jedes Ich lebt in Dus, in Wirs und dem Universum" (zit. n. Quittmann 1996: 188). Die
,,Ganzheitlichkeit" des Menschen stellt eine weitere programmatische Aussage der Humanis-
tischen Psychologie dar, die sich aus dem Dualismus aus Selbst- und Fremdbestimmung ergibt.
Ruth Cohn (Ebd.) erklärt das besagte holistische Menschenbild wie folgt: ,,Der einzelne ist eine
Ganzheit, die mehr ist als die Summe ihrer Teile, und er selbst ist ein Teil einer Gemeinschaft,
die mehr ist als die Summe aller einzelnen." Nur wenn er in/mit seinem System wächst, wächst
der Mensch wirklich das ist ein Grundgedanke der
TZI.
25
24
Ruth Cohn sieht das Subjekt und seine persönliche Entwicklung als einen Teil von vier Faktoren. Die
TZI, eine
gruppentherapeutische Methode, möchte das
Ich (die einzelnen Personen mit ihrer Biographie und ihrer
Tagesform),
das
Wir (das sich entwickelnde Beziehungsgefüge der Gruppe; die Interaktion), das Es (den Inhalt,
um den es geht oder die
Aufgabe, zu deren Erledigung die Gruppe zusammenkommt) und den umgebenden
Globus (das organisatorische, strukturelle, soziale, politische, wirtschaftliche, ökologische, kulturelle engere und
weitere
Umfeld, das die Zusammenarbeit der Gruppe bedingt und beeinflusst, und das umgekehrt von der
Arbeit der Gruppe beeinflusst wird. Der Globus wird gedacht als Umrandung dieser drei Pole, die im
Vier-
Faktoren-Modell
ein gleichseitiges Dreieck bilden) gleichermaßen behandeln und analysieren. Ziel der
TZI ist es,
zu innerer Klarheit zu gelangen und somit persönlich zu reifen. Schulz von Thun (2000c: 68; hier sind Begriffe
wie ,,Innere Ratsversammlung", ,,Oberhaupt" und dergleichen zu nennen) ließ sich hiervon inspirieren, als er
das
Modell
des
Inneren Teams entwarf.
16
2.3.3. Das Menschliche im Werk von Schulz von Thun
Wie integriert Schulz von Thun nun diese Denkweise und Modelle in sein Werk? In aller
Kürze und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, soll diese Frage nun geklärt werden. Die Über-
einstimmung zwischen innerer Befindlichkeit und äußerem Gebaren bezeichnen die für Schulz
von Thun/Zach/Zoller (2012: 28) zur Schlüsselqualifikation gewordene ,,Authentizität". Erst,
wenn der Mensch
kongruent kommuniziert (Verhalten entspricht Erleben nach Rogers; Plate
2013: 51), kann seine Persönlichkeit wachsen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. ,,Alles, was
du sagst, sollte wahr sein; aber du solltest nicht alles sagen, was wahr ist" (Cohn, zit. n. ebd. 29).
Cohns ,,selektive Authentizität" ging in Schulz von Thuns Konzept der ,,Stimmigkeit"
ein, das
zu seinem Kommunikationsideal werden sollte. Es bezeichnet eine doppelte Übereinstimmung,
zunächst jene ,,mit mir selbst" (personale Stimmigkeit; ,,dem Innen"). Weiterhin muss die
eigene Kommunikation auch immer zur spezifischen Situation (zum System, ,,dem Außen")
passen, in der man interagiert (situative Stimmigkeit). Stimmigkeit setzt daher ,,Selbst- und
Feldklärung" voraus. Das Situationsmodell dient der Erfassung des Systems, der ,,Wahrheit der
Situation" (Schulz von Thun 2013: 45f). Zur Analyse der inneren Pluralität schlägt Schulz von
Thun das Modell des Inneren Teams vor. Und erneut tritt an dieser Stelle die Humanistische
Psychologie auf den Punkt, welche feststellt, man müsse innere Klarheit haben, um nach außen
gewinnbringend kommunizieren zu können.
26
Auf diese Weise versucht die Humanistische
Psychologie das dem Menschen innewohnende Potenzial zu entdecken und zu fördern. ,,Sei
du selbst und werde, der du bist", sagt Cohn (zit. n. Schulz von Thun/Zach/Zoller 2012: 91).
Den Grundgedanken der ,,positiven Potenzialentfaltung" (Ebd.) greift Schulz von Thun im
Werte- und Entwicklungsquadrat auf.
2.3.4. Erfassung des Inneren Menschen: Inneres Team, Werte- & Entwicklungsquadrat
27
Das Modell des Inneren Teams geht von der Individualität des Menschen aus. Menschen sind
von verschiedener psychologischer Ausgestaltung und mit unterschiedlichen Situationen kon-
frontiert. Dem erstgenannten Umstand trägt das Innere Team Rechnung, in dem es zur
Analyse der ,,inneren Pluralität" dient.
,,Stimmig" kommunizieren kann nur, wer sich über die
26
Schulz von Thun/Zach/Zoller (2012: 98) nehmen das auf: ,,Innere Wahrheit äußere Klarheit. Harmonie nach
innen Wirksamkeit nach außen" so lautet im Hinblick auf das Modell des
Inneren Teams die Erfolgsformel
für eine ,,integrale Person."
27
Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der systemisch-konstruktivistischen Perspektive (dem
,,Menschen im System"), können jene individualpsychologischen Modelle Schulz von Thuns (,,das System im
Menschen") nur kurz und womöglich rudimentär behandelt werden. Die folgenden Ausführungen beziehen
sich
allesamt
auf
Miteinander Reden 3; Einführung bei Schulz von Thun 2000c: 21-66).
17
Ausgestaltung seines eigenen Seelenlebens im Klaren ist. Zu Bernhard Pörksen sagt Schulz von
Thun zum Verhältnis von ,,Innerer Wahrheit und äußerer Klarheit" (,,Parallelitätsthese"):
,,Wer mit sich selbst einig ist [und den Prozess der Selbstklärung, der Auseinandersetzung mit
seinem Inneren Menschen, abgeschlossen hat], der kann der Welt mit vereinten Kräften begegnen.
Seine Kommunikation hat inneren Rückhalt, seine Worte haben Ruhe, Kraft und Autorität. Der
Mensch und seine Worte bilden eine Einheit [...]. Wer sich selbst versteht, der kommuniziert besser."
(Schulz von Thun/Pörksen 2014: 97f)
Die verschiedenen Regungen (nach Goethe: ,,Mehrere Seelen in einer Brust."), die sich in der
Person in einer jeweiligen Situation abspielen, bezeichnet Schulz von Thun als ,,Innere Team-
mitglieder". Jeder Mensch weist daher eine ihm eigene ,,Teamaufstellung" auf. ,,Innere Plurali-
tät" ist dabei das Mit- und Gegeneinander der Mitglieder, die in einem stetigen Aushandlungs-
prozess um Dominanz und Gleichberechtigung stehen; ein stets fortwährender Kampf eben
nicht nur zwischen den, sondern auch
im Menschen selbst. Ein Zustand, der durch gruppen-
dynamische Prozesse hervorgerufen wird. Mit dem Inneren Team können die ,,Aufstellung"
analysiert, die Teammitglieder benannt, Gründe kommunikationspsychologischer Symptome
gesucht, womöglich erklärt und bestenfalls beseitigt werden: indem die Teamaufstellung ange-
passt wird. Die ,,Teamentwicklung" ist ein weiterer Nutzen des Modells, das die Brücke zur
Humanistischen Psychologie schlägt, welche wie erwähnt postuliert, dass der Mensch nicht nur
fremdbestimmt sei. Das Modell geht, wie Schulz von Thun im Allgemeinen, alltags- und
praxisnah, sowie auf das jeweilige Subjekt bezogen vor. Die ,,inneren Stimmen", die sich bei der
Konfrontation mit einer Situation melden, die Mitglieder also, werden als Metaphern gedacht,
sie sind kreativ und umgangssprachlich benannt (,,der Karrieremensch", ,,der Tagedieb" usw.)
und werden in der Therapie plastisch gemalt. Jedes Mitglied steht für ein seelisches Anliegen.
In ihrem Zusammenwirken bilden sie die Persönlichkeit, die durch die Anordnung und unter-
schiedliche Dominanz der Teammitglieder bedingt wird: Wer meldet sich in welcher Situation,
welche Mitglieder schreien laut, welche summen nur leise? Fragen wie diese muss sich der
Patient im Dialog mit dem Therapeuten stellen, um so sein inneres System zu ergründen.
,,Das Werte- und Entwicklungsquadrat ist ein geistiges Element, um menschliche Werte,
Tugenden und Qualitäten genauer zu bestimmen und die darin enthaltenen Chancen und
Gefahren genauer einzuschätzen" (Schulz von Thun 2000c: 237). Dabei werden zwei Werte/
Kräfte in Form eines quadratischen Modells immer in ein dialektisches Verhältnis zueinander
gesetzt. Entsprechend dem Problem werden jeweils zwei konträre Werte gegenübergestellt:
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (eBook)
- 9783956363894
- ISBN (Paperback)
- 9783956367335
- Dateigröße
- 525 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Erscheinungsdatum
- 2014 (November)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- Halbwahrheit Wahrheit Erkenntnis Wissen Kommunikation System Konstruktivismus Systemiker Individuum Watzlawick Tiefenpsychologie
- Produktsicherheit
- Diplom.de