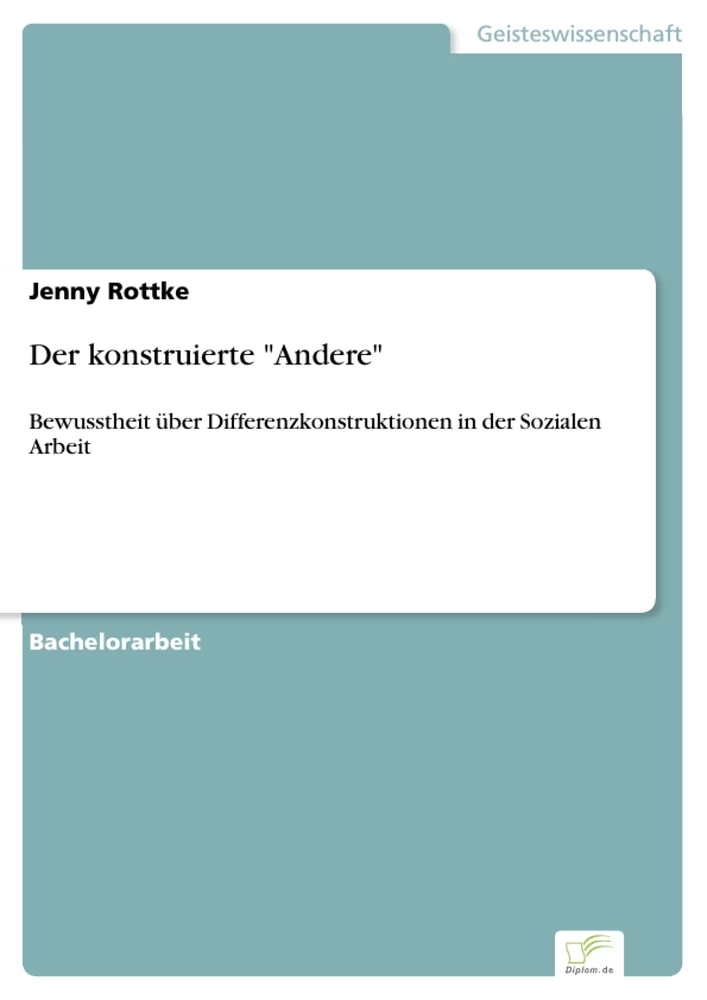Der konstruierte "Andere"
Bewusstheit über Differenzkonstruktionen in der Sozialen Arbeit
©2012
Bachelorarbeit
90 Seiten
Zusammenfassung
Im heutigen Globalisierungszeitalter und den damit in Verbindung stehenden oder auch an sie gestellten Anforderungen an die Menschen, ist eine Auseinandersetzung mit Differenzen unumgänglich. Die Soziale Arbeit wird folglich mit diesen Zusammenhängen konfrontiert, muss sich selbst positionieren und Menschen in den verschiedensten Lebenslagen unterstützen – um den Klienten mit und in ihren Problemlagen aber auch um sich selbst gerecht zu werden. Differenzen rücken in politischen und gesellschaftlichen Diskursen stetig in den Fokus und somit ist auch die Soziale Arbeit angehalten, auf diese Entwicklungen und Thematisierungen zu reagieren. Differenzierte Lebensweisen und ihr Drängen nach Anerkennung in Form von Verminderung auf sie bezogener Diskriminierung und Vorurteilsdenken fordert die Soziale Arbeit auf, über das Konstrukt „Normalität“ und ihre eigene Rolle in einem regulierenden System nachzudenken.
In der vorliegenden Theoriearbeit soll es darum gehen, aufzuzeigen, wie Differenzen konstruiert werden und wenn möglich sich auch über den Sinn dieser Differenzkonstruktionen ein Bild machen zu können. Es soll aufgezeigt werden, inwiefern eine Bewusstheit für dieses Thema in der Sozialen Arbeit von Bedeutung sein kann oder ist und wie Soziale Arbeit mit dem Hintergrund des Wissens um Sinn und Bedeutungszusammenhänge mit Differenz bzw. deren Konstruktion umgehen kann. Der Interaktionsraum der Sozialen Arbeit wird hier auf Deutschland als freiheitlich-demokratischen Sozialstaat beschränkt.
Es soll dargelegt werden inwiefern und auf welcher Basis die Soziale Arbeit in Hinsicht auf gesellschaftliche / politische Konstruktionen reagieren kann bzw. ob sie das kann. Die Soziale Arbeit soll zudem selbst beleuchtet werden in Hinsicht auf eine Grundlage, mit der sie ihre Ziele verfolgen kann und wie dies auf das Thema der Differenz bezogen werden kann. In Hinblick auf den Staat soll außerdem herausgearbeitet werden, was die Soziale Arbeit für eine Rolle spielt – auch in Hinsicht auf Differenzkonstruktionen – als im und für den Staat agierendes Instrument und ob und wie das mit ihren Werten und den sich selbst gestellten Aufgaben vereinbar ist.
Ziel soll es also sein, die Soziale Arbeit zu positionieren und im Hinblick auf Konstruktionen des oder der „Anderen“ zu sensibilisieren, um mit Weitblick und Verständnis – nicht im Sinne von immer hinnehmendem Verständnis - für Konstruktionsvorgänge in Deutschland agieren zu können.
In der vorliegenden Theoriearbeit soll es darum gehen, aufzuzeigen, wie Differenzen konstruiert werden und wenn möglich sich auch über den Sinn dieser Differenzkonstruktionen ein Bild machen zu können. Es soll aufgezeigt werden, inwiefern eine Bewusstheit für dieses Thema in der Sozialen Arbeit von Bedeutung sein kann oder ist und wie Soziale Arbeit mit dem Hintergrund des Wissens um Sinn und Bedeutungszusammenhänge mit Differenz bzw. deren Konstruktion umgehen kann. Der Interaktionsraum der Sozialen Arbeit wird hier auf Deutschland als freiheitlich-demokratischen Sozialstaat beschränkt.
Es soll dargelegt werden inwiefern und auf welcher Basis die Soziale Arbeit in Hinsicht auf gesellschaftliche / politische Konstruktionen reagieren kann bzw. ob sie das kann. Die Soziale Arbeit soll zudem selbst beleuchtet werden in Hinsicht auf eine Grundlage, mit der sie ihre Ziele verfolgen kann und wie dies auf das Thema der Differenz bezogen werden kann. In Hinblick auf den Staat soll außerdem herausgearbeitet werden, was die Soziale Arbeit für eine Rolle spielt – auch in Hinsicht auf Differenzkonstruktionen – als im und für den Staat agierendes Instrument und ob und wie das mit ihren Werten und den sich selbst gestellten Aufgaben vereinbar ist.
Ziel soll es also sein, die Soziale Arbeit zu positionieren und im Hinblick auf Konstruktionen des oder der „Anderen“ zu sensibilisieren, um mit Weitblick und Verständnis – nicht im Sinne von immer hinnehmendem Verständnis - für Konstruktionsvorgänge in Deutschland agieren zu können.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0
Inhalt
Vorwort
1
0. Einleitung
3
1. Rahmenbedingungen: Zeit, Ort und Position(ierung)
7
1.1.
Zeit: Im heutigen Globalisierungszeitalter...
7
1.2.
Ort: Soziale Arbeit im Interaktionsraum Deutschland
10
1.3.
Position(ierung): Soziale Arbeit zwischen Klient und Staat
13
2. Bewusstheit Worüber und wozu?
Oder: Die Bedeutung einer Bewusstheit
14
3. Normalität
und
Differenz
17
3.1.
,,Das ist die Regel" Normalität und Norm
18
3.2.
,,Anomalien" Differenz und Normabweichung
20
4. Differenzkonstruktionen
21
4.1.
Individuelle Differenzkonstruktion und Identität
22
4.2.
Differenzkonstruktionen in Politik und Gesellschaft
29
5. Differenzkonstruktionen im Rahmen der Sozialen Arbeit
44
6. Exkurse
48
6.1.
Die
Sicht
des
,,Anderen"
48
6.2.
Exkurs:
Wahrheit
50
7. Professionsgrundlagen
in Hinsicht auf den Umgang mit Differenz und die eigene Position
51
7.1.
Menschenrechte
53
7.2.
Existenzphilosophische
Grundlage
57
7.3.
Dialog
und
Begegnung 63
7.4.
Phänomenologie
der
Erfahrung
65
7.5.
Professionelle begründete Qualitätssicherung ein Glossar
68
7.6.
(Selbst-)Reflexion für und von
Professionalität
69
7.7.
Zusammenfassung
und
Fazit
-
Grundlagen
71
8. Schwierigkeiten Kritik Widersprüche
71
9. Zusammenfassung Fazit Ausblick
76
10. Literatur
79
1
Vorwort
,,Es gibt keinen und es wird nie einen Menschen geben, der etwas mit Bestimmtheit
weiß." (Xenophanes)
Die vorliegende Arbeit ist in ihrem eigenen Sinne und von ihrem Inhalt her abgeleitet
selbst nicht mehr und nicht weniger als Konstruktion. Es gibt immer Belege und Zitate,
die genau das belegen, was ein Autor/eine Autorin auszudrücken bzw. zu ,,beweisen"
versucht.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema der Differenzkonstruktion, dem ,,Normalen"
und dem ,,Anderen" ist zudem ein schwieriges Unterfangen aufgrund meiner eigenen
Sozialisation und einem damit verbundenen ,,unfreien" Blick.
Diese wissenschaftliche Arbeit ist letztendlich ein Konstrukt, in dem ich als Autorin auf
ein Bewusstsein für eine Bewusstheit hinarbeiten will.
Diese Arbeit kann und will keinen Wahrheitsanspruch erheben zumindest nicht in
Hinsicht auf eine letzte, unumstößliche Wahrheit. Es soll ein Versuch sein, komplexe
Verstrickungen darzustellen, die eben für die Soziale Arbeit von Bedeutung zu sein
scheinen und es meiner Meinung nach auch sind.
Es ist zudem unmöglich, eine differenzierte, alle möglichen Theorien umfassende, von
allen Seiten betrachtende Darstellung zu erbringen es würde ins Uferlose und
letztendlich nirgends hinführen. Deshalb und um dennoch eine Arbeit über Phänomene
bezüglich Differenz schreiben zu können, wurden Definitionen vorgenommen bzw.
versucht und ,,Behauptungen" aufgestellt diese sind dabei nicht etwa aus der Luft
gegriffen, sondern basieren auf wissenschaftlichen Texten und Diskursen.
Es sei darauf hingewiesen, dass verwendete Zitate eventuell aus ihrem ursprünglichen
Zusammenhang herausgerissen verwendet wurden, was unter dem Aspekt einer
Dekonstruktion (in Anlehnung an Spivak bzw. Derridas Dekonstruktion (vgl. Castro
Varela/Dhawan, 2005:57)) zu verzeichnen und somit nachsichtig nicht für unwissen-
schaftlich oder die ursprüngliche Quelle missverstanden gehalten werden sollen.
Ich als Autorin habe zwischenzeitlich in dieser Auseinandersetzung den Sinn und den
Inhalt einer solchen Arbeit aufgrund meines Eingebundenseins in ein System westlicher,
moderner Strukturen bezweifelt nicht zuletzt mit der Frage nach der Motivation für
2
diese Arbeit in Bezug auf ein bewertendes System der Hochschule, welche Vorgaben
macht, um zu ,,testen", ob StudentInnen in der Lage sind, eine wissenschaftliche Arbeit
zu erbringen, wobei in Verbindung mit dem vorgegeben Zeitrahmen und den
Erwartungen seien es nun die eigenen oder die ,,anderer" ein enormer Druck auf
den Schreibenden lastet.
Dennoch liegt es in meinem Interesse, diese Arbeit mehr oder weniger als Denkanstoß
oder Inspiration für ein Weiterdenken vorzulegen.
Für meine eigene zukünftige Arbeit bildet diese Auseinandersetzung einen Grundstein
in Hinsicht auf einen bewussten Umgang mit Differenzkonstruktionen, Positionierungen
und eine kritische Haltung gegenüber der eigenen Arbeit.
,,Seine Umstände kennen. Unsre Kräfte können wir abschätzen, aber nicht unsre Kraft.
Die Umstände verbergen und zeigen uns dieselbe nicht nur nein! Sie vergrößern oder
verkleinern sie. Man soll sich für eine variable Größe halten, deren Leistungsfähigkeit
unter Umständen der Begünstigung vielleicht der allerhöchsten gleichkommen kann:
man soll also über die Umstände nachdenken und keinen Fleiß in deren Beobachtung
scheuen." (Nietzsche, 2011:231)
3
Vorab: Die personenbezogenen Bezeichnungen in dieser Arbeit, die nur in der männ-
lichen Form aufgeführt sind, beziehen sich auf das weibliche und das männliche
Geschlecht gleichermaßen. Auf die weibliche Form wird zugunsten eines besseren Text-
bzw. Leseflusses verzichtet auch wenn in dieser Arbeit genau auf ,,solche" Domi-
nanzverhältnisse aufmerksam gemacht werden will. Ich bitte um Verständnis.
0. Einleitung
,,Eigenartigerweise eint die Menschen gerade ihr Bemühen, sich voneinander zu
unterscheiden." (Reus)
Im heutigen Globalisierungszeitalter und den damit in Verbindung stehenden oder auch
an sie gestellten Anforderungen an die Menschen, ist eine Auseinandersetzung mit
Differenzen unumgänglich. Die Soziale Arbeit wird folglich mit diesen
Zusammenhängen konfrontiert, muss sich selbst positionieren und Menschen in den
verschiedensten Lebenslagen unterstützen um den Klienten mit und in ihren
Problemlagen aber auch um sich selbst gerecht zu werden. Differenzen rücken in
politischen und gesellschaftlichen Diskursen stetig in den Fokus und somit ist auch die
Soziale Arbeit angehalten, auf diese Entwicklungen und Thematisierungen zu reagieren.
Differenzierte Lebensweisen und ihr Drängen nach Anerkennung in Form von
Verminderung auf sie bezogener Diskriminierung und Vorurteilsdenken fordert die
Soziale Arbeit auf, über das Konstrukt ,,Normalität" und ihre eigene Rolle in einem
regulierenden System nachzudenken.
In der vorliegenden Theoriearbeit soll es darum gehen, aufzuzeigen, wie Differenzen
konstruiert werden und wenn möglich sich auch über den Sinn dieser Differenz-
konstruktionen ein Bild machen zu können. Es soll aufgezeigt werden, inwiefern eine
Bewusstheit für dieses Thema in der Sozialen Arbeit von Bedeutung sein kann oder ist
und wie Soziale Arbeit mit dem Hintergrund des Wissens um Sinn und
Bedeutungszusammenhänge mit Differenz bzw. deren Konstruktion umgehen kann. Der
Interaktionsraum der Sozialen Arbeit wird hier auf Deutschland als freiheitlich-
demokratischen Sozialstaat beschränkt.
Es soll dargelegt werden inwiefern und auf welcher Basis die Soziale Arbeit in Hinsicht
auf gesellschaftliche / politische Konstruktionen reagieren kann bzw. ob sie das kann.
Die Soziale Arbeit soll zudem selbst beleuchtet werden in Hinsicht auf eine Grundlage,
mit der sie ihre Ziele verfolgen kann und wie dies auf das Thema der Differenz bezogen
4
werden kann. In Hinblick auf den Staat soll außerdem herausgearbeitet werden, was die
Soziale Arbeit für eine Rolle spielt auch in Hinsicht auf Differenzkonstruktionen als
im und für den Staat agierendes Instrument und ob und wie das mit ihren Werten und
den sich selbst gestellten Aufgaben vereinbar ist.
Ziel soll es also sein, die Soziale Arbeit zu positionieren und im Hinblick auf
Konstruktionen des oder der ,,Anderen" zu sensibilisieren, um mit Weitblick und
Verständnis nicht im Sinne von immer hinnehmendem Verständnis - für
Konstruktionsvorgänge in Deutschland agieren zu können.
Die zu untersuchende Frage wäre demnach: Welche Position und Aufgabe hat die
Soziale Arbeit in Bezug auf Klienten, den Staat und nicht zuletzt auf ihre eigene
Arbeitsgrundlage wenn es um Differenz, Differenz(de-)konstruktion und deren
Auswirkungen geht und wie und auf welchen Grundlagen kann sie diesen Themen
begegnen und letztlich damit umgehen?
Ausgangspunkt für die Arbeit stellt das Buch ,,Differenzierung, Normalisierung,
Andersheit. Soziale Arbeit als Arbeit mit den Anderen" von Fabian Kessl und Melanie
Plößer dar, in dem anhand verschiedener Beispiele und Texte erstens die Relevanz des
Themas Differenz im Zuge der Sozialen Arbeit und zweitens die Formen von
Differenzkonstruktionen im jeweiligen Arbeitskontext aufgezeigt werden. Vor allem in
den Kapiteln, in denen es explizit um die Soziale Arbeit in Bezug auf Differenz geht,
bildet diese Publikation eine weitreichende Untersuchungsgrundlage. Weiterhin bilden
verschiedenste Werke zu Themen wie Differenz, Fremdheit und Normalisierung in den
unterschiedlichen Dimensionen (beispielsweise: ,,Versuch über den Normalismus. Wie
Normalität produziert wird" (2009) von Jürgen Link, oder ,,Differenz und Soziale
Arbeit. Sensibilität im Umgang mit dem Unterschiedlichen" (2003) von
Kleve/Koch/Müller) wie auch soziologische und politikwissenschaftliche Werke (wie
zum Beispiel ,,Wirtschaft und Gesellschaft" (1980) von Max Weber mit seiner
Definition von Macht oder ,,Die Politik der Verortung. Eine postkoloniale Reise zu
einer >ANDEREN Geographie der Welt" (2002) von Julia Lossau) und allem voran
,,Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung" von Maria do Mar Castro Varela
und Nikita Dhawan die Grundlage für die Erörterung des zu untersuchenden
5
Themenfeldes. Die Erörterungen Castro Varelas und Dhawans durchziehen mit auf sie
bezugnehmende, erweiternde Literatur die gesamte Arbeit.
Für die Auseinandersetzung mit Lösungsansätzen bzw. Ideen für eine
fachwissenschaftliche und weitgreifende Grundlage für die Soziale Arbeit bilden unter
Anderem verschiedene Werke zum dialogischen Prinzip Martin Bubers, das Buch
,,Existenzialismus" (2008) von Thomas Flynn, ,,Phänomenologie der Erfahrung"
(1972) von Ronald D. Laign, ein qualitätssicherndes Glossar Silvia Staub-Bernasconis
(in Heiner et.al., 1998) oder auch ,,Menschenrechte und Soziale Arbeit" von den
Vereinten Nationen hier eher als Ausgangslage denn als inhaltlich dargestelltes Werk
eine literarische Basis.
Im Laufe der Arbeit soll deutlich werden, dass bzw. wie relevant das benannte Thema
der Differenz(konstruktion) für die Soziale Arbeit ist, wo Schwierigkeiten oder
Widersprüche auftreten können und wie die Soziale Arbeit Klienten, Staat und ihrer
eigenen Profession gerecht werden kann. Dies beschreibt und umfasst die Bewusstheit,
auf die in dieser Arbeit hingearbeitet werden soll.
Der Bezug zur Praxis soll hier nur innerhalb der dargestellten Theorien und nicht an
ausgewählten Beispielen dargestellt werden. Die Soziale Arbeit wird hier durchaus auch
in ihrem praktischen Handeln beleuchtet. Aufgrund des Umfangs und der Reichweite
der folgenden Betrachtungen und Ausführungen wurde auf ein explizit praxisbezogenes
Beispiel verzichtet. Jedoch können die Untersuchungen sowohl auf die Praxis bezogen
als auch als praxisbildende Grundlage gesehen werden.
Meine persönliche Motivation für diese Arbeit ist mein Interesse an Verhaltensmustern
von Menschen aufgrund ihrer Sozialisation und ihrer somit konstruierten Identität.
Besonders interessieren mich dabei die Hintergründe, die zu einem bestimmten
Verhalten führen bzw. die Folgen bestimmter Einflussfaktoren auf die Menschen. Auch
im gesamtgesellschaftlichen Kontext und im politischen Bereich interessiere ich mich
für konstruierte Normen und ihre eigentlich zugrunde liegenden Motivationen.
Inhaltlicher Verlauf: Den Einstieg in die Thematik und Arbeit bildet die Darstellung der
Rahmenbedingungen, unter denen die Soziale Arbeit hier betrachtet wird und unter und
6
in denen sie agiert. Daraufhin soll die Bedeutung einer Bewusstheit für die Soziale
Arbeit geklärt werden und was diese umfasst.
Den ersten Hauptteil stellen die Definitionsversuche von Normalität und Differenz dar,
sowie darauffolgende Analysen zu Differenzkonstruktionen. Dabei werden sowohl
individuelle als auch gesellschaftliche Konstruktionen in den Blick genommen. Auch
das davon nicht zu trennende Thema der Macht wird in diesem Kontext einer
Betrachtung unterzogen. Daraufhin werden explizit die Differenzkonstruktionen im
Bereich der Sozialen Arbeit betrachtet, die sowohl auf die vorangegangenen
Betrachtungen anschließen sich darauf beziehen, die in sich jedoch noch eigene
Dimensionen tragen. Nachdem sowohl ,,Die Sicht des ,,Anderen"" und ,,Wahrheit" als
ergänzende Exkurse die Betrachtungen erweitern und ,,vervollständigen", werden
verschiedene Professionsgrundlagen vorgestellt, mit denen sich die Soziale Arbeit
sowohl zu positionieren versuchen kann als auch dem Thema der Differenz adäquat
begegnen kann. Diese Untersuchungen und Ausführungen bilden den zweiten Hauptteil.
Diese ebenso große Gewichtung auf Umgangsgrundlagen ist der Annahme geschuldet,
dass Bewusstheit ebenso einen bewussten Umgang und zur Bewusstheit verhelfende
Wege betrifft. Abschließend werden Widersprüche und Kritiken dargelegt, sowie ein
flüchtiger Blick in eine beispielhafte Praxis getan. Den Abschluss bildet ein
zusammenfassendes Fazit.
7
1. Rahmenbedingungen: Zeit, Ort und Position(ierung)
,,Unsere Zustände schreiben wir bald Gott, bald dem Teufel zu, und fehlen ein wie das
andere Mal: in uns selbst liegt das Rätsel, die wir Ausgeburt zweier Welten sind."
(Goethe)
Zunächst sollen die Rahmenbedingungen für die Auseinandersetzung mit dem mit der
Sozialen Arbeit in Verbindung stehenden Thema der Differenzkonstruktion umrissen
werden. Sie sollen Einstieg und Ausgangspunkt für die Betrachtung sein. Die drei zu
betrachtenden Gebiete - die zeitliche Konkretisierung, die örtliche Bestimmung für das
Agieren der Sozialen Arbeit und die Position der Profession der Sozialen Arbeit
korrelieren und bilden somit zwangsläufig eine Einheit. Die Bedingungen können im
Grunde genommen also nur als Ganzes und im gegenseitigen Bezug zueinander
wahrgenommen und betrachtet werden. Trotz Überschneidungen soll der Versuch einer
separaten Betrachtung getan werden.
1.1.
Zeit: Im heutigen Globalisierungszeitalter...
Finanzkrisen, Atomkatastrophen, Klimawandel und Umweltdebatten, Regierungsum-
brüche in arabischen Ländern und der Ruf nach Freiheit ... Standortwechsel von für die
Wirtschaft bedeutenden Unternehmen, Arbeitsplatzverluste, Armut... Multikulturelle
Gesellschaft, die Infragestellung von Geschlechtern und alternative Lebensweisen...
und die Angst, in alldem die eigene Identität zu verlieren oder überhaupt erst keine zu
finden.
Und alles hängt auf die eine oder andere Weise mit der ,,Globalisierung" zusammen.
Kaum ein Bereich lässt sich heutzutage noch von der Globalisierung und damit
vermeintlich in Verbindung stehenden Phänomenen trennen sei es in der Politik,
kulturelle oder soziale Bereiche betreffend oder in der Wirtschaft. Alles wird mit ihr in
Verbindung gebracht und womöglich auf sie zurückgeführt Globalisierung ist zu
einem bedeutenden ,,Modewort" avanciert. (vgl. Brunner, 2006:60) Jedoch sei dazu
angemerkt, dass es sich in der Debatte grundsätzlich und stets nur um die Rede von der
Globalisierung handeln kann - während sie gleichzeitig stattfindet. Es ist der Umgang
mit dem Thema, der wirkmächtig ist und die Globalisierung zu dem macht, was sie ist.
(vgl. Lossau, 2002:161)
8
Weltweite Vernetzungen und Verflechtungen sind zudem nicht erst Entwicklungen des
21. Jahrhunderts. ,,[Es] ist daran zu erinnern, daß Globalisierung grundsätzlich kein
neues Phänomen darstellt, sondern der kapitalistischen Moderne mitsamt ihrer auf
Effizienz und Rationalität beruhenden Expansions- und Vereinheitlichungsintentionen
inhärent ist." (vgl. Wallerstein, 1990 zitiert nach Hà, 2004:78)
Wirtschaftliche und politische Entscheidungen werden unter dem Vorwand gefällt, auf
die Entwicklungen zu reagieren, die im Zuge der Vernetzung von statten gehen, und um
so zu tun, als ginge es um ein Allgemeinwohl aller, als würden sich jegliche
Herrschaften und Machtkonstellationen in der Globalisierung auflösen und das alles
zum Wohle aller oder besser noch dem der ,,Anderen" geschehe. ,,Kulturen" und ihre
vermeintlichen Eigenschaften rücken ins Blickfeld und werden unter dem Aspekt eines
menschenrechtskonformen Idealbilds oder westlichen/eurozentrischen Vorstellungen
beäugt und kritisiert. Durch die Fokussierung auf die Globalisierung und die
,,Anderen", die ja ebenso ihren Teil zum Funktionieren der Weltgemeinschaft beitragen
sollen, werden diese ,,Anderen" (re-)konstruiert, sodass bestehende Machtverhältnisse
aufrecht erhalten oder neue erlangt werden, ohne sich dabei aufgrund der liberalen
und eigens festgelegten Vorreiterpositionierung dafür rechtfertigen zu müssen.
,,Globalisierung, wie sie zur Zeit absehbar ist, bedeutet [eben] nicht, daß die
historischen Phänomene der Machtungleichheit und Ungleichzeitigkeit, die die
kapitalistische Entwicklung in ihren bisherigen Phasen geprägt haben, darin
überwunden werden."(Hà, 2004:77) Sie nehmen innerhalb dieses Prozesses lediglich
andere Formen an. Folgt man den Postkolonialen Theorien, so erfindet der
Kolonialismus immer neue Wege, ,,um sich die Ressourcen der anderen Länder zu
sichern". (Castro Varela/Dhawan, 2005:24) Zudem gibt es demnach immer ,,Über-
schneidungen von Ideen und Institutionen etwa Wissen und Macht im Sinne
Foucaults". (ebd.) Es geht in diesem Zusammenhang stets um Macht und
Repräsentation, die im Rahmen eines Neokolonialismus ausgeübt und angestrebt
werden.
In der heutigen Zeit werden auch in Deutschland nach wie vor
Unterschiede
gemacht, sei es zwischen Frau und Mann (oder anderen Geschlechtern); zwischen
homo-, hetero-, oder anderssexueller Orientierung; zwischen deutsch, ,,deutsch mit
Migrationshintergrund" und ,,nicht-deutsch"; krank oder gesund; jung oder alt oder
9
nach anderen Unterscheidungsmustern (wie beispielsweise immer noch mehr oder
weniger offensichtliche Ost-West-Ungleichheiten).
Obsolete Strukturen werden so gut es eben geht aufrechterhalten und führen
zwangsläufig zum Ausschluss beziehungsweise in jedem Fall zu einer gesonderten
Behandlung ,,alternativer", nicht regelkonformer Ansichten und Lebensmodelle.
So werden in Deutschland durch verschiedenste Debatten, durch Bezeichnungen, allein
durch den politischen und institutionellen Rahmen und die ewige Überzeugung, eines
der Länder zu sein, die wissen, was Demokratie und Freiheit bedeutet
1
und somit
universelle Paradigmen festlegen, Differenzen erzeugt: Differenzen in Bezug auf die
Menschen, über die Debatten geführt werden; in Bezug auf Bezeichnungen von
Menschen, denen mit jener Bezeichnung bestimmte Eigenschaften zugeschrieben
werden, und denen somit eine Gruppenzugehörigkeit unterstellt wird, die sich durch
Andersartigkeit gegenüber dem Rest auszeichnet; in Bezug auf politisch/institutionelle
Vorgaben, durch die Menschen auf welche Art auch immer (und das meist unter
dem Deckmantel des Entgegenkommens) diskriminiert werden. Aus diesen Differen-
zierungen resultieren meist rechtliche, wirtschaftliche, soziale und/oder kulturelle
Nachteile oder aus Sicht der Dominierenden auch Vorteile. Es existieren bestimmte
,,Bilder" von Menschen und ihrer Lebensart, denen sie entsprechen soll(t)en. Im
Entgegenkommen der politischen Führungskräfte und Gesetzgeber durch beispielsweise
neue Gesetze werden Differenzen dieser Art meist nicht beseitigt, sondern nur
verschoben.
Im neoliberalen, auf Nutzen und Kapitalanhäufung ausgerichteten, also utilitaristischen
Zeitalter, in dem die jeweilige erbringbare Arbeitsleistung den Wert des Menschen in
Bezug auf den Staat weit aus mehr bestimmt, als sein Menschsein, sind die Gründe für
die Aufrechterhaltung oder Bestimmung von Regeln und Normen schwer zu
durchschauen.
,,Die allgemeine Durchsetzung des Prinzips des Nutzens als Maßstab der Beurteilung
politischer und sozialer Handlungen, Einrichtungen und Zwecke ist deshalb in
vielfältiger Hinsicht von Interesse: über die hier vertretenen philosophischen und
theoretischen Positionen hinaus und durch sie hindurch hat man es dabei mit einem
wesentlichen Ausdruck des Selbstverständnisses, teils der kritischen Selbstreflexion,
1
Man beachte hierbei einmal, dass Deutschland selbst ,,nicht nur eine ,,verspätete Nation" und eine verspätete
Industriegesellschaft ist, sondern erst recht eine verspätete Demokratie." (Geißler, 2007:40) Demokratische
Strukturen entwickelten sich erst nach dem 2. Weltkrieg und das auch nicht aus eigener Motivation heraus. Nimmt
man zudem die späte Befreiung der ostdeutschen Länder aus der Diktatur der Deutsch Demokratischen Republik
die weder demokratisch noch eine wirkliche Republik war ist das Vorreiterauftreten Deutschlands mit seiner
Suggestion einer schon ewig da gewesenen Demokratie überheblich, selbstbetrügerisch und teils auch ihre eigene
Geschichte leugnend.
10
teils der ideologischen Legitimation und aktiven Unterstützung der erfolgreichen
Etablierung einer liberal-kapitalistischen und zumindest zeitweise auch offenen
imperialistischen Wirtschafts- und Sozialordnung und der ihr entsprechenden
politischen und staatlichen Institutionen, Strukturen und Normen zu tun mithin
Gesellschafts- und Geistesverfassung, die im 19. Und 20. Jahrhundert ganz Europa
sukzessive durchdrungen hat und von dort aus ,globalisiert` wurde." (Asbach, 2009 in
Asbach 2009:21)
Globalisierung ist vielmehr eine Verwestlichung der ,,restlichen" Welt, als ein
gleichberechtigtes Teilnehmen aller am Prozess zur angestrebten Weltgemeinschaft.
Hegemoniale Herrschaften werden durch die (Spät-)Folgen des Kolonialismus und
bestehende neokoloniale und neoliberale Strukturen gesichert und ausgebaut. Menschen
leiden aufgrund wirtschaftlicher Vorgänge und dem Wohlstandsanspruch
bessergestellter Nationen unter Armut und der Vorenthaltung von Entwicklungs-
chancen. Machtausübung geschieht unter dem Deckmantel der Durchsetzung universell
geltender Rechte, was grundsätzlich nicht die Universalität der Rechte in Zweifel zieht,
sondern vielmehr die Absichten der eingreifenden Mächte.
,,[D]em Bild der globalisierten Welt [liegt] letztendlich ein eurozentrischer
Ordnungsrahmen zugrunde (...). [Unter anderem d]as Denken in vermeintlich
homogenen Kultur-Räumen [wird] innerhalb des Globalisierungsdiskurses gleichsam
unter der Hand (re-)produziert (...)." (Lossau, 2002:159) Dies wirkt sich sowohl auf
das Außerhalb als auch auf das Innere eines Staates so auch in und außerhalb
Deutschlands als Vertreter der eurozentrischen Macht aus.
Allein deshalb sind Betrachtungen und Bewusstwerdung über Hegemonie, Macht und
Konstruktionen entlang einer natürlich scheinenden Normalität für die Soziale Arbeit
von Bedeutung. Diese konstruierten Realitäten wirken sich sowohl auf das
Gesellschafts- und ,,Klientensystem" als auch auf die Soziale Arbeit selbst aus
bestimmen sie vielmehr.
1.2. Ort: Soziale Arbeit im Interaktionsraum Deutschland
Die Soziale Arbeit als Institution und Dienstleister kann genauso wenig getrennt von
dem Land und den Strukturen, in denen sie agiert, betrachtet werden, wie jeder einzelne
Mensch, der sich dort aufhält. Der Ort beinhaltet jeweilige bestimmte Bedingungen, die
wiederum gewisse Handlungsmöglichkeiten bestimmen.
11
Deutschland bietet als freiheitlich-demokratischer Sozialstaat auf eben dieser Basis und
den gegebenen rechtlichen Grundlagen einen Rahmen, in dem die Soziale Arbeit als
Profession weiträumig agieren kann. Der Rahmen stellt einerseits einen weiten Raum
und viele Freiheiten für Inhalt und Form der Sozialen Arbeit bereit und ist gleichzeitig
vorgebende und beschränkende Begrenzung.
Auch wenn die Soziale Arbeit in alle möglichen Bereiche eingegliedert ist und seit Jahr-
zehnten stets umfassendere und differenziertere Angebote bereitstellt, muss sie sich
immer wieder in ihrer Profession rechtfertigen und den immer mehr betriebswirtschaft-
lichen Orientierungen wie beispielsweise Qualitätsnachweisen in Form von Statistiken,
Steigerung der Effizienz bei gleichzeitigen Einschränkungen der Mittel oder der
Erfüllung bestimmter Maßgaben nachkommen und gerecht werden. ,,[...] Betriebe
werden nach dem unternehmerischen Rationalitätsprinzip ,,mehr für weniger" geführt.
Das heißt auch [...]: Es stetzt die Bürokratisierung und Verwissenschaftlichung der
kaufmännischen und verwaltenden Tätigkeiten ein." (Geißler, 2006:22)
Deutschland ist vor allem auch eine kapitalistische Gesellschaft. Das Grundgesetz selbst
,,war und ist [...] nicht mehr, aber auch nicht weniger, als der juristische Ausdruck des
Standes der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach dem Kriege, was natürlich
bedeutet, daß es die Verfassung einer kapitalistischen Gesellschaft ist."
2
(Maas,
1985:13)
Die Soziale Arbeit ist auf Finanzierung angewiesen und somit nur so weit handlungs-
fähig, wie der jeweilige Geldgeber und die rechtlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen es zugestehen bzw. ermöglichen. So gibt es vielleicht bestimmte
Bedingungen, unter denen Hilfeleistungen erst möglich sind. Betrachtet man
beispielsweise das staatliche Organisationsprinzip der Dezentralisierung also
Selbstverwaltungskörperschaften wird deutlich,
,,[d]aß es sich hierbei nicht um wirkliche politische Selbstverwaltung im Sinne
unmittelbarer Demokratie (..) , also um autonome, staatsfreie Regelung der eigenen
Angelegenheiten [handelt]. (...) Selbstverwaltung bleibt hier nicht der freien
Selbstbestimmung der jeweils betroffenen Menschen überlassen, sondern ist gesetzlich
genau geregelt und untersteht der staatlichen Aufsicht." (Maas, 1985:19)
In einem freiheitlich-demokratischen, auf dem Recht basierenden Staat wie Deutschland
bilden sich die Regeln und Normen unter anderem und zu großen Teilen durch
Rechtsbeschlüsse. Über das Gesetz werden somit auch soziale Dienstleistungen
2
Dies ist zurückzuführen auf den ,,Wiederaufbau der westdeutschen Wirtschaft nach dem Krieg mit den Mitteln des
sogenannten Marshall-Plans" (Maas, 1985:13) und den damit in Verbindung stehenden Bedingungen. (vgl. ebd.)
12
bestimmt ob, wie, wann, mit wem, zu welchem Zweck, mit welchem Ziel. ,,Die
modernen Gesellschaften [- wie auch Deutschland es ist -] (...) reproduzieren sich in
verästelten normierenden und normalisierenden Verfahren, Techniken, Institutionen und
in einem ihnen adäquaten Wissen." (Sohn, 1999:14)
Je mehr Regeln es zu befolgen gibt, desto eingeschränkter ist der Handlungsspielraum
bzw. sind die Möglichkeiten für nicht regelkonforme oder besser: kreative Aktionen. In
der Sozialen Arbeit werden durch die Verrechtlichung und das Ausführen formaler
Bestimmungen ,,Spontanität und prozeßhafte Entwicklungen [...] ausgeklammert."
(Karolus, in Wendt, 1995:110)
,,Böhnisch nennt vier Eigenschaften von Sozialpolitik und Sozialer Arbeit, die für die
deutsche Entwicklung typisch sind:
· eine besonders hohe Tendenz der Bürokratisierung und Verrechtlichung;
· die prinzipiell sozialintegrative Ausrichtung Sozialer Arbeit
· die in Deutschland besonders komplizierte Verstrickung von Sozialpolitik und
Sozialer Arbeit: der Doppelcharakter von Hilfe und Kontrolle in der Sozialhilfe
und der Sozialen Arbeit
· die eigenartige Lähmung und sanfte Unterwerfung der sozialpolitischen Wohl-
fahrtsverbände unter dem Politikanspruch des Sozialstaates"
(Böhnisch, 1984 zitiert nach Schilling/Zeller, 2007:264)
Die Soziale Arbeit ist als Teil des Systems, in dem sie agiert, eine mehr oder weniger
offensichtlich ausführende Instanz im Sinne der Vertretung der (vor)herrschenden
Normen und Gesetze.
Weiterhin spielt der Stand der Sozialen Arbeit bzw. ihr Relevanz in Bezug auf die
Wirtschaft als nicht-gewinnbringende Instanz eine weitaus geringere Rolle, als
profitbringende Organisationen. Das wirkt sich selbstverständlich auf die Bereitschaft
der Förderung und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln aus.
Betrachtet man neben den für die Soziale Arbeit professionsbezogenen Gegebenheiten
einmal den Umstand, dass aufgrund des Anspruchs auf Nachweisen für die
Wirksamkeit der Arbeit und die zeitlich begrenzten Mittel für Projekte, die
Sozialarbeiter selbst immer in einer Ungewissheit leben, ob und wie lange sie noch im
Arbeitsverhältnis stehen, wird deutlich wie sehr sie ebenfalls den in Deutschland
vorhandenen Strukturen und eventuellen, damit verbundenen Schwierigkeiten
ausgesetzt sind. Sie können dabei in die Situation geraten, so sehr mit eigenen
Problemen beschäftigt zu sein, dass das Gefühl aufkommt, dass allein durch diese
Arbeitsumstände ein für die Klientel optimales Ergebnis gar nicht erzielt werden kann.
Dies soll keine allumfassende Annahme sein, ist jedoch überdies nicht auszuschließen.
13
Auch das ist ein Umstand der Zeit und der herrschenden neoliberalen Orientierung in
Deutschland. Die Soziale Arbeit wird im Grunde schon durch die Kontrolle ihrer
Befähigung durch die personelle Arbeitskraft beeinflusst.
Es besteht bei allem kein Zweifel daran, dass die Soziale Arbeit in Deutschland mehr
Handlungsspielräume hat, als in zum Beispiel nicht-demokratischen Ländern. Es gibt
viele und verschiedenste Möglichkeiten für Angebote und Projekte, unterschiedlichste
Förderer und Fördermittel. Die Soziale Arbeit kann in diesem Rahmen viel bewirken.
Sie kann in gewissem Ausmaß Strukturen und Normen kritisieren und zu Verände-
rungen und Neuerungen beitragen jedoch nur sofern es den obwaltenden allgemeinen
Normen, den Vorstellungen der Finanziers und der Rolle, in der sie sich sieht und mit
der sie sich in das Ganze einfügt, nicht erheblich widerspricht.
1.3. Position(ierung) - Soziale Arbeit zwischen Klient und Staat
Der Gegenstand Sozialer Arbeit ist der Mensch im Zusammenhang mit der Gesell-
schaft, in der er lebt. Jedoch ist mit dem Gegenstand noch nicht klar, welches Ziel sie
hat. (vgl. Gruber, 2009:9f) Die Soziale Arbeit steht in vielerlei Hinsicht zwischen den
Stühlen und muss sich demnach immerfort positionieren. Sie muss einerseits gegenüber
den verwaltenden Kräften und andererseits gegenüber den Adressaten Position beziehen
und gleichzeitig beiden Seiten gerecht werden. Sie versucht in diesem Spagat zudem
ihren eigens auferlegten Kriterien zu entsprechen. Das Doppelmandat in Hinsicht auf
die Erwartungen der Klienten auf Unterstützung und wohlwollender Hilfe auf der einen
Seite und des Eingreifens und der Kontrolle im dienstlichen Auftrag auf der anderen
Seite ist ein immer wieder auftretender Konflikt.
Für Gruber stellt die Soziale Arbeit eine ,,personal vermittelte Solidarität (...)[dar, der
es] um eine in der Gesellschaft und für die Gesellschaft wirksame Praxis von Hilfe und
Unterstützung für Menschen in schwierigen sozialen Situationen [geht]." (Gruber,
2009:11) Diese Basis schütze die Soziale Arbeit vor staatlicher Vereinnahmung. (vgl.
ebd.) Diesem Argument ist allein insofern zu widersprechen, als die Soziale Arbeit sich
den sie umgebenden und durchdringenden Werte- und Normenstandards keinesfalls
entziehen kann. Sie ist ja keine freie, vom Staat losgelöste Instanz, die von außen ohne
Berücksichtigung der dort zugrunde liegenden Ordnung in das Geschehen eingreifen
kann. Sie ist Teil des Geschehens.
14
Nach Maas steht der Grundkonflikt Bedürfnisse contra Rahmenbedingungen in
Verbindung mit Kapital und Arbeit und diesbezüglich gesamtgesellschaftlicher
Konfliktstrukturen. ,,[Die] sogenannten ,,Hilfen" [der Sozialen Arbeit] sind Instrumente
öffentlicher Reproduktion, die dann eingesetzt werden, wenn die private Reproduktion
der Arbeitskraft versagt oder nach den Ordnungsvorstellungen der zuständigen gesell-
schaftlichen Instanzen als gefährdet erscheint." (Maas, 1985:119) Die heutigen
Lebensbedingungen und Einflussfaktoren sind hyperkomplex und es ist eventuell
anzuzweifeln, dass es allein um das Eingliedern der Menschen in den Arbeitsmarkt
geht. Letztendlich jedoch geht es um Wohlstand, Kapital, damit einhergehende Macht
und die daraus resultierende und damit in Verbindung stehende Repräsentation ob nun
als Individuum im gesellschaftlichen Kontext oder als Staat in Bezug auf die Welt.
,,Der gesellschaftliche Standort der Sozialen Arbeit liegt nach Mühlum zwischen den
großen Funktionsbereichen des sozialen Sicherungssystems, des Gesundheitssystems,
des Erziehungssystems und des Sanktionssystems. (...) Überwölbt werden diese
Bereiche vom Gesellschaftssystem, dem kulturellen System, dem Wirtschaftssystem
und dem ökologischen System." (Schilling/Zeller, 2007:202)
In diesem vielseitig kontextualen Gebilde stellt es sich als schwierig dar, Position zu
beziehen. Das führt letztlich zu einer nötigen Bewusstheit über die Umstände der
Positionierungsschwierigkeiten und die Strukturen, die sie bedingen. In jedem Fall
agiert die Soziale Arbeit sowohl mit der Seite des Staates als Normierungsmacht und
stellt diese in gewissem Rahmen selbst dar als auch mit den Klienten als die zu nor-
malisierenden Subjekte.
2. Bewusstheit Worüber und wozu?
Oder: Die Bedeutung der Bewusstheit
,,Abweichungen von der Norm, Unebenheiten, Störungen, Ver-rücktheit, Irr-sinn, das
Unangepaßte und Heterogene sind seit Jahrtausenden das, was transindividuellen
Fähigkeiten den Weg ebnet. Der Angepaßte und der Mitläufer sind zu zaghaft, sie
zeigen wenig Mut; wer den Aufstieg in eine andere Dimension des Bewußtseins wagen
will, muß sich unerschrocken seinen Weg durch die Schranken von Gewohnheiten und
Alltagsdenken bahnen." (Kalweit)
oder: ,,Kurz gesagt, ohne Wahrheit keine Freiheit." (Sartre, 1998:36)
15
Nach dem Herkunftswörterbuch des Dudens ist Bewusstheit das ,,Geleitetsein durch das
klare Bewusstsein" (19. Jh.) und Bewusstsein ,,deutliches Wissen von etwas; Zustand
geistiger Klarheit; Gesamtheit der psychischem Vorgänge, durch die sich der Mensch
der Außenwelt und seiner selbst bewußt wird" (18. Jh.) (Duden, 1989:79f) Es soll
hierbei also geklärt werden, inwiefern und wozu für die Soziale Arbeit ein durch klares
Bewusstsein geleitetes Arbeiten von Bedeutung ist und welche Umstände diese
Bewusstheit umfassen.
Die verschiedenen Ambivalenzen, denen die Soziale Arbeit ununterbrochen ausgesetzt
ist und die sie letztendlich ausmachen und bestimmen, zeigen auf, in welchem
,,Grauzonenbereich" und welch scheinbarer Zerrissenheit sie sich befindet. Allein für
diesen Umstand benötigen Sozialarbeiter das nötige Bewusstsein.
Es ist nahezu unmöglich, es immer allen recht zu machen und den Ansprüchen und
Anforderungen jeweils aller Beteiligten gerecht zu werden. Es ist zudem nicht möglich,
die Gleichzeitigkeit von individuellen Hilfeleistungen und dem begleitenden bis hin
zum kontrollierenden Versuch der (Re-)Integration in das normative System; vom
ganzheitlichen oder multidimensionalen Blick und gleichzeitiger Differenzierung und
Spezialisierung sozialarbeiterischer Theorie und Praxis; die begrenzte Rationalisierung
des Berufs der Sozialarbeiter als Professioneller und Mensch; Integration als Ziel und
das gleichzeitige tendenzielle Bewirken des Gegenteils; dem widersprüchlichen Ansatz
der Hilfe zur Selbsthilfe der letztendlich die Soziale Arbeit überflüssig werden ließe;
die lösungsorientierte Arbeit, die jedoch um die Betrachtung und Beleuchtung des
Problems nicht herumkommt; das Eingebunden sein in vielerlei Kontexte bzw. die
,,Polykontextualität"; und letztendlich die Orientierung an Gerechtigkeit und der
gleichzeitigen Konfrontation mit der Unmöglichkeit des gesetzten Ziels zu überwinden.
(vgl. Kleve, 2000:97ff) Aufgrund dieser Unüberwindbarkeit und der damit einher-
gehenden Entscheidungsunfähigkeit für genau eine Seite, muss sich die Soziale Arbeit
dieser Ambivalenzen durchweg bewusst sein. Diese Bewusstheit für ihre eigene Rolle
und den damit verbundenen scheinbaren und tatsächlichen Widersprüchen, hilft ihr
zumindest, einen Standpunkt eben genau dazwischen zu finden. Mit einem in jedem
Fall erst einmal für sich selbst offenen Umgang damit, steht sie nicht in dem
vermeintlichen Zwang, sich entscheiden zu müssen. Sie kann zudem allein durch die
Bewusstmachung mehr Klarheit in ihr Bild als Profession bringen, da eine Klarheit über
die Unklarheit besteht.
16
Wenn diese Dinge nicht bewusst reflektiert und beobachtet werden und ihre Gleichzei-
tigkeit nicht als unweigerliche
Tatsache angenommen wird, kommt es bewusst oder
unbewusst zu einer Leugnung der einen oder anderen Rolle und Eigenart. Mit dieser
Leugnung lügt sich der Sozialarbeiter jedoch selbst in die Tasche. Er kann zudem
keinen wirklich ehrlichen Kontakt und Umgang mit seinen Klienten haben, wenn er
Realitäten und Rollen leugnet, die zweifellos
da sind, die dem Klienten mehr oder
weniger bewusst sind, sich aber zumindest auf welche Weise auch immer auf ihn
auswirken.
Diese die gesamte Arbeit umfassende Bewusstheit erleichtert einerseits die Arbeit
insofern, als nicht ständig krampfhaft versucht werden muss, einem genau und eher
von außen definierten Bild zu entsprechen, das es gar nicht gibt und nicht geben kann.
Die Soziale Arbeit muss sich in diesem Bewusstsein auch nicht unmittelbar dem Druck
aussetzen, Dinge ändern zu müssen, die aufgrund von Systemstabilitäten schwer zu
ändern sind. Andererseits kann sie auf dieser Basis selbstbewusster und sich ihrer
Position sicherer für Veränderungen eintreten sei es nun auf politischer,
gesellschaftlicher oder individueller Ebene. Die Soziale Arbeit kann sich als
Schnittstelle betrachten, die sowohl die gesamtgesellschaftlichen als auch individuelle
Prozesse im Zusammenhang auch mit sich selbst bewusst wahrnimmt und mit
diesem Hintergrund eventuell innovativer und kreativer, auf jeden Fall aber ehrlicher
arbeiten kann.
Sie kann sich zudem konkreter mit ihren eigenen Paradigmen und zugrundeliegenden
Werten auseinandersetzen, diese kontextual und kritisch reflektieren und sich darüber
selbst definieren. Sie wäre somit auf Zuschreibungen der verschiedenen Seiten, mit
denen sie zu tun hat, nicht angewiesen muss also nicht von außen definiert werden,
wenn sie sich ihrer eigenen Position bewusst ist und das je nach Situation und Umfang
auch nach außen trägt. Zudem kann sie nur in und durch Bewusstheit eine
professionelle und klienten- bzw. bedürfnisorientierte Arbeit leisten.
Eine solche professionsbezogene Bewusstheit schließt Themen wie Konstruktion und
Dekonstruktion mit ein auch und gerade, was den eigenen Anteil betrifft und wie die
Soziale Arbeit damit umgehen kann. ,,Die Gesellschaft verändert sich, und damit auch
die Soziale Arbeit. Klassische Leitorientierungen werden immer problematischer
sowohl aus praktischer als auch aus theoretischer Sicht. Eine solche Leitorientierung ist
17
die Differenz von Norm und Abweichung, Konformität und Devianz."
(Kleve/Koch/Müller, 2003:7)
Es geht vor allem um die Bewusstheit über Konstruktionen des ,,Normalen" und des
Wahrheitsgehalts dieses ,,Normalen", aus denen absolute, apodiktische Maxime
entspringen und denen die Konstruktionen vom ,,Nicht-Normalen" und von
Wahrheitsbestand bedrohenden ,,(Un-)Wahrheiten" inbegriffen sind. ,,Inzwischen ist es
mehr als fraglich geworden, ob Soziale Arbeit die Funktion hat, soziale Abweichungen
von gesellschaftlichen Normvorstellungen zu re-normalisieren." (ebd.) Dies ist der
Ausgangspunkt für eine bewusste Auseinandersetzung und bewusste Positionierung der
Sozialen Arbeit innerhalb des Themenkomplexes von Normalität und Differenz.
Die folgenden Beleuchtungen der Themen von Normalität, Differenz, Differenz-
konstruktion auf sowohl individueller als auch politisch-gesellschaftlicher Ebene
sollen die Notwendigkeit einer Bewusstheit in und durch ihre Darstellung aufzeigen und
dadurch gleichzeitig zu einer Bewusstheit führen.
3. Normalität und Differenz
Definitionen dienen zunächst einem Verständnis von dem, wovon die Rede sein soll.
Die Definitionsversuche und Darstellungen, die hier vorgenommen werden, sollen
sowohl Verständnisgrundlage als auch bereits kritische Betrachtung sein.
Was Normalität ist, scheint zunächst klar zu sein. Betrachtet man den Begriff jedoch
genauer und beabsichtigt ihn zu bestimmen, zeigt sich die Kompliziertheit jener
Bestimmung in seiner Begründbarkeit, seines Entstehungszusammenhangs und seiner
Geltungsanspruchsgrundlage. Ebenso verhält es sich mit den mit der Normalität
zusammenhängenden scheinbar ihr widersprechenden Differenzen. Wenn nicht
eindeutig ist, was normal ist, sind auch jeweilige Abweichungen vom Normalzustand
schwer zu bestimmen. Fest steht: ,,Normen und Normalitäten wurden herausgebildet
und mit ihnen Abweichungen und Abnormalitäten." (Sohn, 1999 in Sohn/Mehrtens
1999:7)
Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie ,,Normalität" Begrifflichkeit und
Wirkmächtigkeit entstanden ist bzw. ,,erschaffen" wurde und wird und wie sie
18
demnach definiert werden kann. Daraufhin sollen die ,,Anomalien" in den Blick
genommen werden.
3.1. ,,Das ist die Regel" Normalität und Norm
,,Die Gesellschaft schätzt ihren normalen Menschen
3
. Sie erzieht ihre Kinder dazu, sich
selbst zu verlieren, absurd zu werden und so normal zu sein." (Laign, 1972:22)
,,normal ,,der Norm entsprechen; regelrecht; üblich, gewöhnlich; geistig gesund"
(Duden, 1989:489)
,,Normal" ist ein alltäglicher Begriff und wirkt zunächst wie eine unmaßgebliche
Floskel. Er ist jedoch mehr als das er ist ,,Schlüsselbegriff moderner Kulturen". (Link,
2009:17) Der Begriff und somit auch das ,,Normale" an sich kamen zum ersten Mal seit
dem 18. Jahrhundert bzw. eher mit dem frühen 19. Jahrhundert in Verbindung mit
moderner Massenproduktion, moderner Massendatenerhebung und der statistischen
Analysen dieser Daten auf. (vgl. Link, 2009:20) Daraus allein kann geschlossen werden,
dass ,,Normalität" etwas Konstruiertes ist, auch wenn es bisweilen als ein
,,selbstverständliches Orientierungs- und Handlungsraster (...)[ ] auch als das
,,Natürliche" oder das ,,Naturgemäße" verstanden [wird]." (Sohn, 1999 in Sohn
Mehrtens, 1999:9) Eben aufgrund dieser verschiedenen Verständnisgrundlagen ist eine
Definition des ,,Normalen" so kompliziert. Link führt zur Verständigung über bzw.
Definition von ,,Normalität" sechs Ungleichheiten auf was Normalität eben zunächst
nicht ist: ,,1. Normalität Normativität; 2. Normalität Alltagsroutine/Alltägliches; 3.
Normalität Bio-Homöostase; 4. Normalität Kybernetik/Technokratie generell; 5.
Normalität ästhetische Banalität; 6. Normalität konstruierte soziale Wirklichkeit
(epistemologisch)" (Link, 1999 in Sohn/Mehrtens, 1999:31) Im Rahmen dieser Arbeit
ist es nicht möglich, die einzelnen Ungleichheiten auszuführen und zu begründen. Es
soll lediglich klar werden, dass Normalität schwer (be)greifbar ist. Neben den vielen
Bezugsmöglichkeiten und Konstituierungsbedingungen soll hier jedoch der
Zusammenhang zwischen Normalität und Normativität aufgegriffen werden. Die
Ungleichheit von Normalität und Normativität wird erst bei genauerer Betrachtung
deutlich. Auch und gerade hier entstehen schnell Überlagerungen und ein funktionales
3
,,Normale Menschen haben in den letzten fünfzig Jahren vielleicht hundert Millionen normale Mitmenschen
getötet." (Laign, 1972:22) Das allein macht die ,,Normalität" oder das ,,Normale" zu einem Absurdum.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783956363573
- ISBN (Paperback)
- 9783956367014
- Dateigröße
- 644 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Alice-Salomon Hochschule Berlin
- Erscheinungsdatum
- 2014 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- Menschenrechte Soziale Arbeit Differenzen Konstruktion Sozialarbeit Andere System Kritische Soziale Arbeit Postkolonialismus Dekonstruktion Gender Profession Bewusstheit
- Produktsicherheit
- Diplom.de