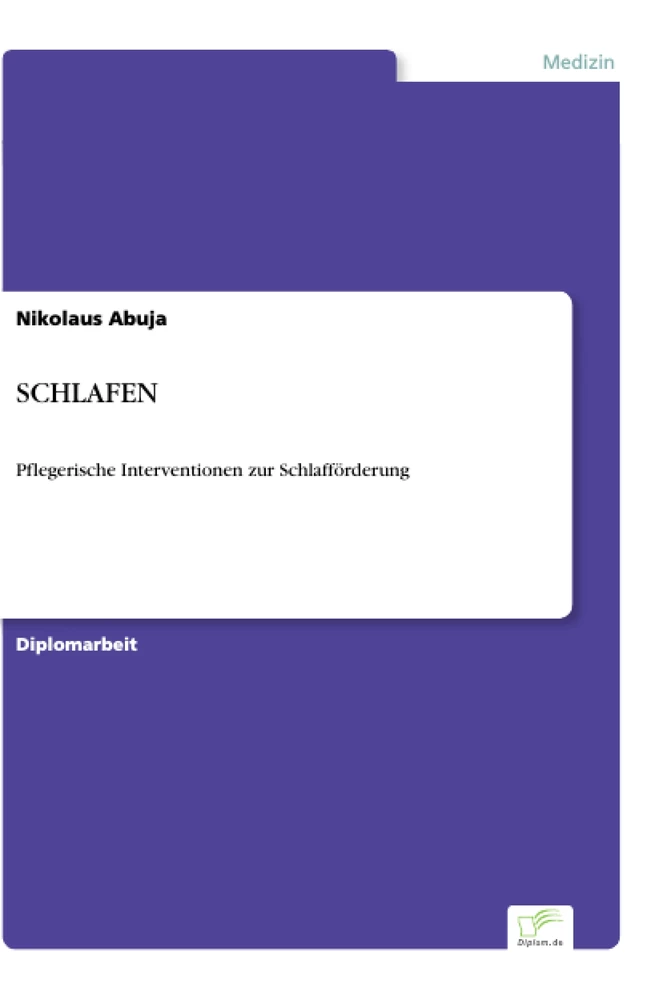SCHLAFEN
Pflegerische Interventionen zur Schlafförderung
©2010
Diplomarbeit
44 Seiten
Zusammenfassung
Diese Arbeit setzt sich mit der Lebensaktivität Schlafen sowie den pflegerischen Interventionen zur Schlafförderung auseinander. Eingeteilt in drei Hauptkapitel: Die Pathophysiologie des Schlafens, die pflegerischen Interventionen zur Schlafförderung und die Rahmenbedingungen.
Es werden die einzelnen pflegerischen schlaffördernden Maßnahmen veranschaulicht, wobei die Interventionen bewusst so beschrieben werden, dass sie der Leser nach dem Lesen der Arbeit auch anwenden kann.
Die Rahmenbedingungen zeigen auf, unter welchen Vorraussetzungen die schlaffördernden Maßnahmen überhaupt stattfinden können. In einem Unterpunkt wird ein geeignetes Dienstplanmodell dargestellt.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass es eine Vielzahl an anwendbaren pflegerischen Interventionen gibt, jedoch hängt die Umsetzbarkeit oft vom Eigenengagement jedes einzelnen Mitarbeiters ab.
Es werden die einzelnen pflegerischen schlaffördernden Maßnahmen veranschaulicht, wobei die Interventionen bewusst so beschrieben werden, dass sie der Leser nach dem Lesen der Arbeit auch anwenden kann.
Die Rahmenbedingungen zeigen auf, unter welchen Vorraussetzungen die schlaffördernden Maßnahmen überhaupt stattfinden können. In einem Unterpunkt wird ein geeignetes Dienstplanmodell dargestellt.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass es eine Vielzahl an anwendbaren pflegerischen Interventionen gibt, jedoch hängt die Umsetzbarkeit oft vom Eigenengagement jedes einzelnen Mitarbeiters ab.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abuja, Nikolaus: Schlafen. Pflegerische Interventionen zur Schlafförderung, Hamburg,
Diplomica Verlag GmbH 2014
PDF-eBook-ISBN: 978-3-8428-3063-9
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2014
Zugl. FH Kärnten, Standort Klagenfurt, Klagenfurt, Österreich, Diplomarbeit, 2010
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2014
Printed in Germany
Kurzzusammenfassung
Diese FBA setzt sich mit der Lebensaktivität Schlafen sowie den pflegerischen
Interventionen zur Schlafförderung auseinander. Eingeteilt wird die FBA in drei
Hauptkapitel: Die Pathophysiologie des Schlafens, die pflegerischen Interventionen zur
Schlafförderung und die Rahmenbedingungen.
Es werden die einzelnen pflegerischen schlaffördernden Maßnahmen
veranschaulicht,
wobei die Interventionen bewusst so beschrieben werden, dass sie der Leser nach dem
Lesen der Arbeit auch anwenden kann.
Die Rahmenbedingungen zeigen auf, unter welchen Vorraussetzungen die
schlaffördernden Maßnahmen überhaupt stattfinden können. In einem Unterpunkt wird ein
geeignetes Dienstplanmodell dargestellt.
Die Ergebnisse dieser FBA zeigen, dass es eine Vielzahl an anwendbaren pflegerischen
Interventionen gibt, jedoch hängt die Umsetzbarkeit oft vom Eigenengagement jedes
einzelnen Mitarbeiters ab.
Abstract
On the one hand this paper explains the activity of sleeping which is one of the activities of
daily living (ADL) and on the other hand it shows the nursing activities to promote sleep.
This paper consists of three main chapters. The first one is the so called pathophysiology of
sleep, then the nursing activities to promote sleep and finally the prerequisites how to
overcome insomnia.
These nursing activities are described so that the reader can use them after reading the
paper.
The final chapter shows what kind of basic structures you need to promote sleep.
A sub chapter demonstrates a good working model of a duty roster for these sleeping
measures.
Results oft the paper show, that there are a lot of suitable and good working nursing
activities.
These measures only work if the staff isn't afraid of changes and is willing to dedicate
themselves to the task completely.
INHALTSVERZEICHNIS
0
VORWORT ... 8
1
EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMDARSTELLUNG ... 9
2
PATHO-PHYSIOLOGIE DES SCHLAFES ... 10
2.1
Definitionen und Ursachen von Schlafstörungen ... 11
2.1.1
Krankenhaus als Pathologische Umgebung ... 13
2.1.2 Lärm
... 13
2.1.3 Schmerzen
...
14
2.2 Epidemiologie
...
15
2.3
Folgen einer Insomnie ... 15
2.4 Medikamentöse
Therapie
...
16
2.4.1 Hypnotika
...
16
2.4.2 Pflanzliche
Präparate
...
16
2.5 Diagnostik
...
17
2.5.1 Anamnese
...
17
2.5.2 Schlaflabor
...
18
2.6 Zusammenfassung
...
19
3
PFLEGERISCHE INTERVENTIONEN ZUR SCHLAFFÖRDERUNG ... 20
3.1 Aromapflege
...
20
3.1.1
Richtlinien und Grundsätze ... 21
3.1.2
Anwendungen bei Schlaffstörungen ... 21
3.2 Getränke
...
24
3.2.1 Tees
... 24
3.2.2 Sonstige
Getränke
...
25
3.3
Anwendungen mittels Wasser ... 26
3.3.1
Wickel und Auflagen ... 26
3.3.2 Waschungen
...
33
3.4
Atemstimulierende Einreibung (ASE) ... 34
3.4.1
Vorbereitung und Durchführung. ... 35
3.4.2
Studien zur schlaffördernden Wirkung der ASE ... 36
3.5 Zusammenfassung
...
37
1
4
RAHMENBEDINGUNGEN ... 38
4.1 Günstige
Dienstplangestaltung
...
39
4.2 Schlafhygiene
...
40
4.2.1
Maßnahmen ... 40
4.3 Zusammenfassung
...
42
5
ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG ... 43
6
LITERATURVERZEICHNIS ... 44
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1:
Waschrichtung ... 33
Abb. 2:
Einreibungsverlauf... 35
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ASE
Atemstimulierende Einreibung
dB Dezibel
DGKS Diplomierte
Gesundheits- und Krankenschwester
DGKP Diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger
DSM-IV
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Version 4
EEG
Elektroenzephalogramm
EL Esslöffel
EOG Elektrookulogramm
FBA Fachbereichsarbeit
Gtt Guttae
HNO
Hals Nase Ohren Heilkunde
ICD-10
International Classification of Diseases and Related Health Problems
Version 10
ICSD-2 International
Classification of Sleep Disorders Version 2
LA Lebensaktivitäten
LJ Lebensjahr
NANDA North-American-Nursing-Diagnosis-Association
Non REM
Non Rapid Eye Movement
REM
Rapid Eye Movement
VAC
Vacuum Assisted Closure
W/O-Lotion Wasser in Öl Lotion
8
0
VORWORT
Im Zuge des Unterrichts wurden Interventionen bei Schlafstörungen eher auf
pharmakologischer Ebene abgehandelt, zudem gehören Hypnotika zu den am meisten
verwendeten Arzneimitteln im stationären Bereich.
Deshalb drängte sich mir immer mehr die Frage auf, mit welchen eigenverantwortlichen
Maßnahmen der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, Schlafstörungen
entgegenwirken kann? Je mehr ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe,
desto größer wurden das Repertoire der pflegerischen Maßnahmen zur Schlafförderung,
sowie das Gefühl, eigenverantwortlich Hilfe in dieser LA anbieten zu können.
Im Nachtdienst sind Pflegepersonen die erste Anlaufstelle für Patienten mit
Schlafstörungen. Gerade deswegen gilt es, schlaffördernde Maßnahmen zu kennen und
nicht als ersten Schritt die oft bedarfsmäßig angeordnete Schlafmedikation zu
verabreichen.
Bereits am Anfang meiner Ausbildung machte ich Erfahrungen mit der ASE und spürte,
dass die Patienten nach der Anwendung deutlich ruhiger und entspannter waren als zuvor.
Unter anderem bestärkte mich dieses positive Erlebnis, mich mit dieser speziellen Materie
intensiver auseinanderzusetzen.
Mein persönlicher Gewinn von dieser Arbeit ist, dass ich in zukünftigen Nachtdiensten
Patienten über pflegerische Maßnahmen zur Schlafförderung umfangreich informieren,
und diese gegebenenfalls auch anwenden kann.
Dass dieses Thema nach wie vor aktuell ist und sein wird, beweisen einerseits viele
Statistiken, wonach die Zahl der Schlafstörungen in den westlichen Industrieländern
ansteigt. Andererseits beschäftigen sich viele aktuelle Fachzeitschriften und Bücher mit
dieser Thematik.
Der Einfachheit halber habe ich in meiner FBA den Begriff Patient verwendet, welcher
auch Bewohner, Klienten, sowie alle zu Pflegenden einschließt und für beide Geschlechter
gilt.
Mein Dank gilt Herrn Daniel Blümel für das Korrekturlesen der Arbeit.
Wittenig, Mai 2010
Nikolaus Abuja
9
1
EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMDARSTELLUNG
Die Fachbereichsarbeit ,,LA Schlafen" beschreibt einen Themenkomplex, der im
stationären Alltag ständig präsent ist: Florence Nighitingale, die britische Pionieren der
modernen Krankenpflege, beschrieb die Förderung eines tiefen Schlafes als unerlässliche
Voraussetzung einer guten Pflege.
Die Patienten konfrontieren meist als erstes die Pflegeperson mit ihren Schlafproblemen
und sehen in ihr eine kompetente Ansprechperson. Schlaffördernde Maßnahmen finden
nicht nur auf medikamentöser Ebene statt, sondern umfassen auch eine Vielzahl an
pflegerischen Interventionen, die den Patienten in dieser Lebensaktivität unterstützen
können. Es gibt noch viele andere schlaffördernde Interventionen, die in dieser FBA nicht
beschrieben werden, da sie nicht ausschließlich in den Tätigkeitsbereich der DGKS/P
fallen, wie z.B. die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson und das Autogene
Training.
Arten und Ursachen von Schlafstörungen gibt es viele, und sie werden oft durch die
fremde Umgebung im Krankenhaus verstärkt. Gerade deswegen gilt es, bereits in der
Pflegeanamnese Probleme mit dem Schlafen zu erfragen und gegebenenfalls Maßnahmen
zu setzen. Patienten die unter Schlafstörungen leiden sind psychisch und physisch weniger
belastbar und können dadurch unter anderem Defizite in den einzelnen Lebensaktivitäten
aufweisen. Auch die medikamentöse Behandlung von Schlafstörungen hat eine Reihe von
Nebenwirkungen, wie z.B.: Toleranzentwicklung, Abhängigkeit oder den ,,Hangover-
Effekt".
Aufgrund der oben beschriebenen Problematik ergibt sich folgende Fragestellung:
Mit welchen pflegerischen Interventionen kann die/der DGKS/P schlaffördernd auf
Patienten mit Schlafstörungen einwirken?
Diese Fragestellung wird mittels Literaturrecherche bearbeitet und beantwortet.
10
2
PATHO-PHYSIOLOGIE DES SCHLAFES
Menche et al. definiert Schlaf folgendermaßen: ,,Schlaf ist ein regelmäßig
wiederkehrender, physiologischer Erholungszustand mit Veränderung der
Bewusstseinslage" (Menche, 2004, S. 531).
Nancy Roper, die englische Pflegetheoretikerin, definiert Schlaf als ,,ein sich
wiederholender Zustand der Bewegungslosigkeit und Reaktionsunfähigkeit, ein
Zustand, in
dem ein Mensch nicht direkt darauf reagiert, was in seiner Umgebung vor sich geht"
(Roper, 2009, S. 64).
NANDA definiert Schlaf als ,,durchgehendes, natürliches, periodisches Aussetzen des
Bewusstseins" (Stefan, 2003, S. 330).
Bezogen auf den Schlafzyklus ist Schlaf eine zusammenfassende Bezeichnung für den
NREM- und den REM-Schlaf. Ein Schlafzyklus verläuft in 5 Phasen (Stadien), wobei 1 bis
4 als ,,Non-REM-Schlaf" (orthodoxer Schlaf) bezeichnet werden; die Phase 5, die am Ende
jedes Schlafzyklus liegt, wird als REM-Schlaf (paradoxer Schlaf) bezeichnet. Im
Durchschnitt durchläuft man 4-5 solcher Schlafzyklen pro Nacht, wobei die REM-Phasen
im Lauf der Nacht immer länger werden.
· Phase 1: Einschlafphase
Die Alphawellen des wachen Gehirns werden im EEG durch Thetawellen abgelöst; im
EOG sind rollende Augenbewegungen sichtbar. Hier befindet sich
der Schlafende in einem
Übergang zwischen Bewusstsein und Schlaf, subjektiv ist dies ein Gefühl des Dösens.
· Phase 2: leichter Schlaf
Diese Phase kann als der eigentliche Schlafbeginn bezeichnet werden; sie beginnt nach
einigen Minuten. Hier bewegen sich die Augen nicht mehr, der Muskeltonus ist im
Vergleich zur Phase 1 deutlich reduziert, jedoch ist der Schlafende in dieser Phase relativ
leicht weckbar.
11
· Phasen 3 und 4: Tiefschlaf
Im EEG werden jetzt typische Deltawellen sichtbar; in Phase 4 nehmen diese quantitativ
zu.
Die Augen sind ganz ruhig, der Muskeltonus sinkt weiter, der Blutdruck fällt ab,
Atmung und Herzschlag werden langsamer. Der Schlafende schläft nun ,,wie ein Stein", ist
schwer zu wecken und der Körper kann sich jetzt gut erholen.
· Phase 5: der REM oder Traumschlaf
Etwa 80 Minuten nach dem Einschlafen erfolgt die REM-Phase. Sie ist das Ende eines
jeden Schlafzyklus und ähnelt im EEG dem Leichtschlaf, jedoch zeigt das EOG die
typischen schnellen Augenbewegungen, daher auch der Name ,,Rapid Eye Movement".
Der Muskeltonus verschwindet fast völlig, der Schlafende beginnt zu träumen und ist
schwer weckbar. Der REM-Schlaf ist sehr wichtig für die psychische Erholung.
1
Der zirkadiane Rhythmus (Schlaf-Wach-Rhythmus) ist unsere innere biologische Uhr und
regelt unser Bedürfnis nach Schlaf (vgl. Morgan, 2000, S. 22). Erwachsene benötigen im
Durchschnitt 7-8 Stunden, wobei es hier individuelle Schwankungen gibt: so brauchen
Kurzschläfer nur 4-5, Langschläfer hingegen 9-10 Stunden Schlaf.
2
2.1 Definitionen und Ursachen von Schlafstörungen
Früher bezeichnete man Schlafstörungen (Dyssomnien) als subjektiv wahrgenommene
Störungen des Ein- und Durchschlafens. Heute, unter Einsatz der Polysomnographie
(Schlafmessung) und der Entwicklung der Schlafmedizin, kann man Störungen objektiv im
Schlaflabor nachweisen. Schlafstörungen sind ein Symptom und keine eigenständige
Erkrankung (vgl. Helga, 2007, S. 1132).
Schlafstörungen sind gravierende psychische und physische Belastungen, welche dem
Betroffenen den lebensnotwendigen regenerierenden Schlaf rauben [Anm. des Verfassers].
1
Müller, T. www.schlafgestoert.de/site-52.html [31.12.200]
2
Müller, T. www.schlafgestoert.de/site-52.html [31.12.200]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842830639
- ISBN (Paperback)
- 9783842880634
- Dateigröße
- 663 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FH Kärnten, Standort Klagenfurt
- Erscheinungsdatum
- 2014 (Juni)
- Produktsicherheit
- Diplom.de