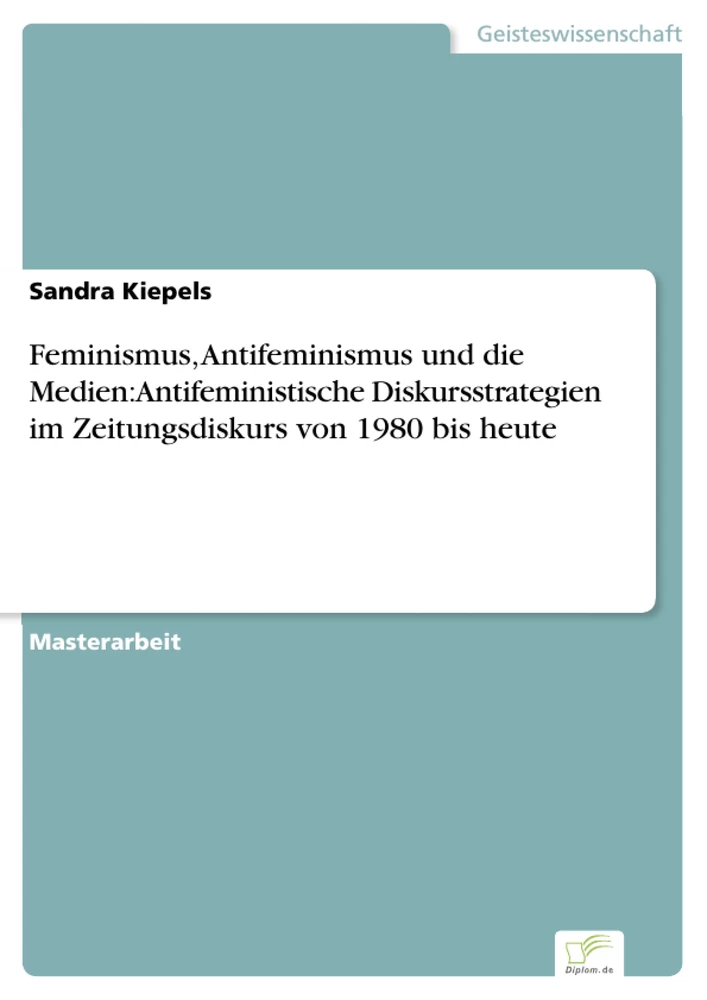Feminismus, Antifeminismus und die Medien: Antifeministische Diskursstrategien im Zeitungsdiskurs von 1980 bis heute
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit:
Die Geschichte des Feminismus und der Erfolg der Frauenbewegung sind unmittelbar mit der Repräsentanz frauenpolitischer Themen in den Medien verknüpft. Vor allem der Zeitungsdiskurs stellt aufgrund seiner hohen Verbreitungsdichte einen wichtigen Faktor in der Prägung der öffentlichen Meinung dar. Dabei ist entscheidend, wie entsprechende frauenpolitische Themen dargestellt werden. In der Vergangenheit wurden durch die Diskussion feministischer Themen im Zeitungsdiskurs Debatten angestoßen, die tatsächlich zu gesellschaftlichen Veränderungen führten. Auch heute ist die Darstellung von feministischen und emanzipatorischen Zielen und Inhalten ausschlaggebend für die gesellschaftliche Meinung über und Akzeptanz von entsprechenden Politiken. Nach einem kurzen Zeitraum, in dem Äußerungen, die sich unmittelbar gegen die weibliche Emanzipation richteten, verpönt waren, lassen sich nun wieder zahlreiche antifeministische und sexistische Äußerungen im medialen Diskurs finden; antifeministische Behauptungen sind wieder sagbar geworden. So zeigt auch die aktuelle Sexismusdebatte, dass sexistische und antifeministische Denkweisen und Aussagen immer noch virulent sind. Aber wie weit verbreitet sind solche Aussagen tatsächlich? Und wo kommen sie – scheinbar plötzlich – her? Diese Arbeit versucht diesen Fragen nachzugehen, und herauszufinden, ob Sexismus und Antifeminismus tatsächlich spontan (wieder-) entstanden sind, oder aber ständig im öffentlichen Diskurs, hier exemplarisch anhand des Zeitungsdiskurses untersucht, mitschwingen. Dabei eignet sich der Zeitungsdiskurs vor allem aufgrund seiner Reichweite, Schriftlichkeit, Aktualität und der engen Verflechtung mit den Diskursebenen Politik und Wirtschaft als Untersuchungsgegenstand. [...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Das Ziel dieser Arbeit
2. Die Diskursanalyse – theoretische Grundlage und Methode
2.1 Die Diskursanalyse
2.2 Zeitungsdiskurs und Feminismus
2.3 Diskurse haben Vergangenheit und Zukunft
2.4 Die Methode
2.5 Weitere zentrale Begriffe dieser Arbeit
3. Antifeministische Diskurse in den 80er Jahren – der Backlash in den USA
3.1 Antifeministische Diskursstrategien
3.2 Ursachen
4. Antifeminismus in der deutschen Presse: Die ‚Political Correctness’- Debatte in den 90er Jahren
4.1 Antifeministische Diskursstrategien
4.2 Ursachen
5. Die Gender Mainstreaming - Debatte 2006
5.1 Antifeministische Diskursstrategien
5.2 Ursachen
6. Aktueller Antifeminismus und die Debatte um die Frauenquote
6.1 Die grundsätzliche Einstellung der Zeitungen
6.2 Antifeministische Diskursstrategien
6.2.1 Bebilderung
6.2.2 Gezielte Verwendung beeinflussender Sprache
6.2.3 Die Behauptung, eine Quote sei unnötig
6.2.4 Darstellung Quotengegner und Quotenbefürworter
6.2.5 Geschlechterverständnis
6.2.6 Die Darstellung von Feminismus und feministischer Theorie
6.2.7 Männerdiskriminierung
6.2.8 Inszenierung als Tabu
6.2.9 Die Frauenquote als Bedrohung
6.2.10 Verschiebung des Deutungsrahmens
6.3 Ursachen
7. Vergleich und Diskussion der Ergebnisse
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis
10. Das Dossier – eine Auflistung der analysierten Zeitungsartikel
Cicero
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Junge Freiheit
Spiegel Online
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
Die Zeit
11. Anhang
11.1 Auswertung der Ergebnisse der Diskursanalyse in Tabellenform
Gezielte Verwendung beeinflussender Sprache
Die Behauptung, eine Quote sei unnötig
Darstellung von Quotengegnern und Quotenbefürwortern
Geschlechterverständnis
Darstellung Feminismus
Männerdiskriminierung
Inszenierung als Tabus
Bedrohung
Verschiebung des Deutungsrahmens
11.2. Der Materialcorpus – alle gesammelten Artikel
Cicero
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Junge Freiheit
Spiegel Online
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
Die Zeit
1. Das Ziel dieser Arbeit
Die Geschichte des Feminismus und der Erfolg der Frauenbewegung sind unmittelbar mit der Repräsentanz frauenpolitischer Themen in den Medien verknüpft. Vor allem der Zeitungsdiskurs stellt aufgrund seiner hohen Verbreitungsdichte einen wichtigen Faktor in der Prägung der öffentlichen Meinung dar. Dabei ist entscheidend, wie entsprechende frauenpolitische Themen dargestellt werden.[1] In der Vergangenheit wurden durch die Diskussion feministischer Themen im Zeitungsdiskurs Debatten angestoßen, die tatsächlich zu gesellschaftlichen Veränderungen führten.[2] Auch heute ist die Darstellung von feministischen und emanzipatorischen Zielen und Inhalten ausschlaggebend für die gesellschaftliche Meinung über und Akzeptanz von entsprechenden Politiken. Nach einem kurzen Zeitraum, in dem Äußerungen, die sich unmittelbar gegen die weibliche Emanzipation richteten, verpönt waren, lassen sich nun wieder zahlreiche antifeministische und sexistische Äußerungen im medialen Diskurs finden; antifeministische Behauptungen sind wieder sagbar geworden.[3] So zeigt auch die aktuelle Sexismusdebatte, dass sexistische und antifeministische Denkweisen und Aussagen immer noch virulent sind.[4] Aber wie weit verbreitet sind solche Aussagen tatsächlich? Und wo kommen sie – scheinbar plötzlich – her? Diese Arbeit versucht diesen Fragen nachzugehen, und herauszufinden, ob Sexismus und Antifeminismus tatsächlich spontan (wieder-) entstanden sind, oder aber ständig im öffentlichen Diskurs, hier exemplarisch anhand des Zeitungsdiskurses untersucht, mitschwingen. Dabei eignet sich der Zeitungsdiskurs vor allem aufgrund seiner Reichweite, Schriftlichkeit, Aktualität und der engen Verflechtung mit den Diskursebenen Politik und Wirtschaft als Untersuchungsgegenstand.
Mein Verständnis des Diskurses richtet sich dabei nach den Thesen Michel Foucaults, dessen Theorieansatz von Siegfried Jäger und anderen in der Diskurswerkstatt im Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung zu einer Methode weiterentwickelt wurde,[5] welche ich in Kapitel 2 ausführlich darstellen werde. Eine zentrale Annahme dieser Methodik ist, dass Diskurse nicht nur in der Gegenwart bestehen, sondern auch eine Vergangenheit haben, aus der sie sich speisen.[6] Auch die Sexismusdebatte schließt – ebenso wie die Debatte um die Frauenquote, um die es im empirischen Teil dieser Arbeit geht – an vorangegangene (antifeministische) Argumentationsmuster an, deren ständige (Re-) Produktion für eine zunehmende Akzeptanz sexistischer und antifeministischer Aussagen sorgen. Daher soll sich diese Arbeit nicht nur in der Analyse der gegenwärtigen Situation erschöpfen. Für eine umfassende Untersuchung der Ursachen für die zunehmende Verbreitung und Akzeptanz antifeministischer Aussagen im öffentlichen, medialen Diskurs ist ein größerer Zeitrahmen zu wählen. Diese Arbeit verfolgt daher einen diachronen Ansatz, indem vier synchrone Analysen im Abstand von circa zehn Jahren durchgeführt werden. Auf diese Weise wird versucht, die Produktion und Reproduktion antifeministischer Diskurse von den 80er Jahren bis heute, ihre Auslöser, Entwicklung, Verfestigung und ihren ‚Erfolg’ in der medialen Öffentlichkeit zu untersuchen.
Als Ausgangspunkt wurde der von Susan Faludi diagnostizierte ‚Backlash’, d.h. das Auftauchen massiver antifeministischer Diskurse in den 80er Jahren, gewählt. Die populärsten antifeministischen Diskursstrategien dieser Zeit werden kurz in Kapitel 3 dargestellt. Durch die aus dem amerikanischen Diskurs übernommene ‚political correctness’ bzw. ‚sexual correctness’- Debatte in den 1990er Jahren wurden auch in Deutschland sexistische und antifeministische Positionen wieder öffentlich vertretbar. Mit welchen Diskursstrategien dies gelingt, werde ich in Kapitel 4 unter Bezugnahme auf die Untersuchungen der damaligen Zeitungsdebatte von Simon Möller und Barbara Huhnke darstellen. Wie langlebig und erfolgreich diese Strategien sind, zeigt sich in Kapitel 5; hier stütze ich mich auf Julia Roßharts Untersuchung des deutschen Zeitungsdiskurses zur ‚Gender Mainstreaming’-Debatte im Jahr 2006. Anschließend folgt in Kapitel 6 eine von mir durchgeführte empirische Untersuchung über die Aktualität antifeministischer Diskursstrategien in der Zeitungsdebatte zur ‚Frauenquote’ des Jahres 2012. Dazu werden aus sieben Zeitungen zwanzig Artikel ausgewählt, von denen jeweils zehn sorgfältig analysiert und ausgewertet werden.
Durch den von mir gewählten diachronen Ansatz soll so aufgezeigt werden, wie antifeministische Diskursstrategien über einen Zeitraum von über 30 Jahren immer wieder produziert, reproduziert und aktualisiert werden, und dabei nicht nur den gesellschaftlichen Diskurs, sondern auch die Einstellung zu feministischen Themen, wie beispielsweise der Frauenquote, massiv prägen.
2. Die Diskursanalyse – theoretische Grundlage und Methode
Das folgende Kapitel umfasst die notwendigen theoretischen Voraussetzungen zum Verständnis dieser Arbeit. In Kapitel 2.1 wird dazu zunächst der Begriff ‚Diskurs’ erläutert und seine machtpolitische Bedeutung im Hinblick auf das gesellschaftliche Wissen und dessen Wahrheit erörtert. Auch werden Ziel und Zweck der Diskursanalyse dargestellt. Kapitel 2.2 beschäftigt sich mit der Bedeutung der Medien und insbesondere des Zeitungsdiskurses für die gesellschaftliche Akzeptanz des Feminismus sowie von gleichstellungspolitischen Maßnahmen. In Kapitel 2.3 wird auf die Bedeutung der Vergangenheit für das Verständnis des aktuellen Diskurses eingegangen und das Konzept dieser Arbeit näher erläutert. In Kapitel 2.4 wird anschließend die von mir verwendete Methode in Bezug auf meine eigene empirische Untersuchung vorgestellt. In Kapitel 2.5 erfolgt zuletzt eine Definition weiterer zentraler Begriffe, welche für den unmittelbar folgenden Teil der synchronen Analysen relevant werden.
2.1 Die Diskursanalyse
Die von mir angestrebte Diskursanalyse orientiert sich an den Analyseschritten, die von Siegfried Jäger und anderen in Zusammenarbeit mit der Diskurswerkstatt im Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung erarbeitet wurden.[7] Diese beruhen auf den Schriften von Michel Foucault[8], dessen Annahmen weiterentwickelt wurden, um „ein Verfahren zu entwickeln, das sich für die Analyse von Diskursen auf allen diskursiven Ebenen eignet“[9], wie beispielsweise auf den Ebenen der Wissenschaft, der Politik oder des Alltages, im Falle dieser Arbeit auf der Ebene der Medien. Dabei
geht es vor allem um die Analyse aktueller Diskurse und ihrer Macht-Wirkung, um das Sichtbarmachen ihrer […] Wirkungsmittel […] und insgesamt um die Funktion von Diskursen als herrschaftslegitimierenden und -sichernden Techniken.[10]
Dazu muss zunächst einmal der Begriff ‚Diskurs’, wie er dieser Analyse zugrunde liegt, erläutert werden. Der Diskurs besteht aus allem, was zu einer bestimmten Zeit sagbar ist, d.h. er umfasst alle Aussagen, deren Äußerung möglich ist.[11] Außerdem umfasst der Diskurs neben dem, was explizit gesagt wird, auch die vielen impliziten Voraussetzungen, auf denen diskursive Äußerungen aufbauen.[12] Diese impliziten Voraussetzungen werden, zusammen mit anderen diskursiven Strategien, mit denen das Feld des Sagbaren eingeengt oder erweitert werden kann,[13] in der Diskursanalyse herausgearbeitet.
Den Diskurs bilden somit alle gesellschaftlichen Äußerungen[14], seien sie alltäglich oder wissenschaftlich.[15] Jedes Individuum wirkt durch die Produktion von Texten an diesem Diskurs mit,[16] auch wenn die Beteiligung des Einzelnen unterschiedlich hoch ausfallen kann.[17] Der Diskurs wird dabei nicht von einem einzelnen Individuum dominiert, sondern ist überindividuell,[18] d.h. der Diskurs ist das Resultat
all der vielen Bemühungen der Menschen, in einer Gesellschaft tätig zu sein. Was dabei herauskommt, ist etwas, daß so keiner gewollt hat, an dem aber alle in den verschiedensten Formen und Lebensbereichen (mit unterschiedlichem Gewicht) mitgestrickt haben.[19]
Ein Text muss daher, obwohl von einem einzelnen Individuum produziert, als soziale Äußerung verstanden werden; d.h. in einen „Kontext des Sozialen“[20] eingebettet werden. Alle Texte, auch Zeitungsartikel, enthalten somit Elemente des herrschenden sozio-historischen Diskurses, und werden als Diskursfragmente bezeichnet.[21] Mehrere Diskursfragmente zu einem Thema bilden einen Diskursstrang, der zusammen mit vielen weiteren Diskurssträngen den Gesamtdiskurs der Gesellschaft bildet, welchen Jäger als „diskursives Gewimmel“ bezeichnet.[22] Die einzelnen Diskursstränge bewegen sich zudem auf verschiedenen Diskursebenen. Dieser Terminus bezeichnet den Ort, von dem aus gesprochen wird, wie zum Beispiel der Politik oder Wissenschaft; im Falle dieser Arbeit die Medien.[23]
Die gesellschaftliche und machtpolitische Bedeutung des Diskurses liegt vor allem darin begründet, dass im Diskurs das gesellschaftliche Wissen fließt, dessen Wahrheit ständig neu verhandelt wird.[24] Ob und welches spezifische Wissen als ‚richtig’ und ‚wahr’ anerkannt wird, ist von gesellschaftlichen Machtverhältnissen abhängig;[25] nur hegemoniales Wissen wird als ‚wahres’ Wissen anerkannt und verfestigt sich für eine Zeit lang.[26] Jäger bezeichnet ‚Wahrheit’ daher als einen diskursiven Effekt.[27] Diese ‚Wahrheit’ bzw. das ‚wahre Wissen’ stützt die Position dominanter Gruppen innerhalb der Gesellschaft, die einen oft bestimmenden Einfluss auf die Frage haben, was ‚wahr’ ist und was nicht.[28] Zugleich prägt das ‚wahre Wissen’ auch die Art und Weise, wie diese Wirklichkeit gesellschaftlich wahrgenommen wird. Somit bilden Diskurse die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern schaffen Wirklichkeit mit, d.h. die gesellschaftliche Wirklichkeit wird nach Maßgabe der Diskurse gestaltet.[29] So kreiert der aktuelle Diskurs, unter Rückgriff auf vergangene Diskurse, die gesellschaftliche Realität.[30] Das Texte produzierende Individuum fungiert dabei als Co-Produzent von Diskurs und Wirklichkeit.[31] Dieser Mitarbeit des Individuums an Diskurs und Wirklichkeit „widerspricht nicht, daß die Diskursverläufe eine Resultante der Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind und sie diese wiederum reproduzieren helfen.“[32] Denn wie die gesellschaftliche Wirklichkeit, so werden auch Machtverhältnisse nicht nur abgebildet, sondern produziert und reproduziert.[33] Zugleich stabilisiert der Diskurs als Träger von ‚wahrem’, d.h. hegemonialem Wissen, die Machtposition dominanter Gruppen, welche wiederum nachdrücklich die Gestaltung bzw. die ‚Wahrheit’ des hegemonialen Diskurses beeinflussen. Der Diskurs stellt damit selbst einen Machtfaktor dar,[34] indem er „zur Strukturierung von Machtverhältnissen in einer Gesellschaft“[35] beiträgt. Bestimmte Gruppen profitieren besonders von diesem ihre Machtposition stützenden hegemonialen Diskurs.[36] Nach Möller kann als eine solche Gruppe die soziale Gruppe der Männer, welche eine Dominanz- und Machtposition innerhalb von Diskurs und Wirklichkeit innehabe, betrachtet werden.[37] Um diese patriarchalen Herrschaftsverhältnisse zu stabilisieren und fortzuschreiben, bedarf es vielfältiger Erhaltungsstrategien und -mechanismen,[38] und „in diesen ‚Bedeutungskämpfen’ spielen die Massenmedien heutzutage als Multiplikatoren eine gar nicht zu überschätzende Rolle.“[39] So sind beispielsweise auf der hier relevanten Diskursebene der Medien viele der untersuchten Publikationsorgane „primär an der Reproduktion dominanter Geschlechterverhältnisse beteiligt, während subversive oder Gegendiskurse weniger stark vermittelt werden.“[40] Die dabei verwendeten Machterhaltungsstrategien und ihre Wirkungsweise herauszuarbeiten, ist das Ziel der Diskursanalyse.[41] So werden
die impliziten und nicht gesagten Voraussetzungen und als Wahrheiten vertretenden Setzungen oder zu Unrecht Konsens beanspruchenden Aussagen oder falsche Verallgemeinerungen und dementsprechende Fluchtlinien etc. sichtbar gemacht […]. Diskursanalyse zeigt also, mit welchen Mitteln und für welche ‚Wahrheiten’ in einer Bevölkerung Akzeptanz geschaffen wird, was als normal und nicht normal zu gelten habe, was sagbar (und tubar) ist und was nicht.[42]
Durch die Analyse kann so der Diskurs, seine Machtwirkungen und ihre Mittel sichtbar gemacht,[43] und seine herrschaftssichernde und -legitimierende Funktion herausgearbeitet werden.[44]
Die Diskursanalyse versteht sich zudem auch als Beitrag zur Medienwirkungsforschung.[45] Schließlich kann davon ausgegangen werden,
dass die Dauerkonfrontation der Rezipienten mit ‚evidenten’ Aussagen über einen langen oder auch sehr langen Zeitraum zu einer festeren Verankerung bzw. zu einer Normalisierung eines Wissens und möglicherweise zur Herausbildung neuer (historisch jeweils gültiger) Wahrheiten führt oder auch zur Festigung ‚alter’ Wahrheiten.[46]
Das heißt, der Diskurs führt durch die ständige Wiederkehr ähnlicher Inhalte, in der Form bestimmter Themen und typischer Argumentationsmuster, sowie durch den gezielten Einsatz bestimmter Diskursstrategien zu der Herausbildung von Wissenskernen.[47] Auf diese Weise trägt der Diskurs dazu bei, individuelles und kollektives (Massen-)Bewusstsein zu formen,[48] wodurch sowohl das subjektive Handeln, als auch „die kollektive Gestaltung von gesellschaftlicher Wirklichkeit“[49] beeinflusst wird. Auch hier wird wieder deutlich, welche Machtwirkungen der Diskurs ausüben kann.
2.2 Zeitungsdiskurs und Feminismus
Die Medien[50] spielen in dem Prozess der gegenseitigen Stabilisation von diskursiver Wahrheit und Macht, sowie in der Prägung des individuellen und kollektiven Bewusstseins eine zentrale Rolle, da sie als Diskursebene einen sozialen Ort darstellen, von dem aus gesprochen und publiziert werden kann, und in dem folglich „Diskurse auftreten, geändert, bearbeitet sowie ausgeschlossen werden.“[51] Insbesondere hegemoniale Printmedien erreichen aufgrund ihrer weiten Verbreitung und ihrer Funktion als Multiplikatoren eine hohe Wirkungskraft, die es ihnen ermöglicht, neben den herrschenden Diskursen auch Bewusstsein zu formen, und so an der (Re-) Produktion und Deutung der gesellschaftlichen Wirklichkeit großen Anteil haben.[52] Aufgrund dieser „subjektkonstituierenden und wissensregulierenden Rolle der Massenmedien“ werden Foucaults diskurstheoretische Thesen daher „auch in der Medienwissenschaft als ‚medientheoretisch relevant’ betrachtet.“[53]
Dabei ist zu beachten, dass ein einzelnes Diskursfragment, wie beispielsweise ein Zeitungsartikel, nur „minimal und kaum spür- und erst recht schlecht nachweisbar“[54] wirkt; allerdings erzielt der gesamte Diskurs, wie beispielsweise alle veröffentlichten Zeitungsartikel eines bestimmten Zeitabschnittes, einen großen Effekt.[55] Hier ist zudem wichtig, dass eine Zeitung nicht nur auf einen einzigen Leser wirkt, sondern dass dieser Leser selbst zum Medium und Multiplikator wird, der das Rezipierte an andere weitergibt. Der Mediendiskurs wirkt auf diese Weise in einer „mit der Leserschaft rückgekoppelten kontinuierlichen Form“.[56]
Der Zugang zu diesem wirkmächtigen Mediendiskurs stellt somit einen entscheidenden Machtfaktor dar,[57] dessen Mangel insbesondere die Gegner der hegemonialen, patriarchalen Machtverhältnisse oft beklagen.[58] Der Zeitungsdiskurs ist aufgrund dieses restriktiven Zugangs, sowie wegen der bestehenden Machtverhältnisse, die vom Diskurs gestützt werden und ihrerseits den Diskurs stabilisieren, relativ homogen, was nicht ausschließt, dass auch hegemonialkritische Diskurspositionen vorkommen.[59] Darüber hinaus weist der Zeitungsdiskurs eine hohe Interdiskursivität auf,
d.h. hier werden häufig auch Diskursfragmente aus anderen Diskursebenen aufgenommen, vor allem aus dem Politikerdiskurs, dem Alltagsdiskurs und aus wissenschaftlichen Spezialdiskursen, sowie aus bereits in anderen Medien veröffentlichten Informationen.[60]
Hier deutet sich schon an, dass die Diskursebene der Zeitungen auch in sich eine starke Verflechtung aufweist, so dass „auch renommierte Leitmedien Informationen und Inhalte aller Art übernehmen, die bereits in anderen Medien aufgetaucht sind.“[61] Der Zeitungsdiskurs ist somit ein sich selbst verstärkendes und reproduzierendes System. Aufgrund dieser Homogenität ist es in der Analyse wichtig, sowohl das Vorhandensein des anvisierten, thematisch und inhaltlich charakterisierten Diskursstranges in einem bestimmten Publikationsorgan festzustellen, als auch zu analysieren, auf welche Weise dieser repräsentiert wird.[62] Diese Frage nach der Art und Weise der Berichterstattung der hegemonialen Zeitungen ist, insbesondere aufgrund der Reichweite dieser Medien und dem daraus resultierenden Einfluss auf die öffentliche Meinung, für den Feminismus von großer Bedeutung.[63] Denn aus dem oben Dargestellten ergibt sich, dass „das medial produzierte Bild des Feminismus […] zu weiten Teilen die gesamtgesellschaftliche Einstellung zum und die Vorstellungen vom Feminismus“ bestimmt.[64] Von dieser Einstellung
hängen wiederum die Chancen feministischer Mobilisierung und politischer Interventionen ab, die auf die Auflösung geschlechtlich kodierter Machtverhältnisse zielen.[65]
Die Bedeutung der medialen Berichterstattung, die entscheidend ist für Akzeptanz und Erfolg des Feminismus in der Gesellschaft, kann daher kaum überschätzt werden. Allerdings könnte eingewendet werden, ob der Leser nicht selbst eine aktive Rolle bei der Aneignung und Bedeutungsproduktion der Texte einnehmen kann. So gibt Stuart Hall zu bedenken, dass Texte meist mehrere Lesarten bieten.[66] Er räumt jedoch ein, dass jeder Text immer auch eine dominante Bedeutungsstruktur und eine präferierte Lesart beinhaltet, welche eng verbunden ist mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen.[67] Wie alle Diskurse, so besteht auch der Zeitungsdiskurs nicht unabhängig von diesen Machtverhältnissen, sondern trägt vielmehr „durch De/Thematisierungen, Grenzziehungen [und] Ausschlüsse“[68] zu dessen Fortsetzung bei. Dies liegt auch daran, dass Zeitungsartikel – wie alle Diskursfragmente – „als Träger und als Produzenten gesellschaftlichen Wissens“[69] fungieren. Dabei wird nicht nur Alltagswissen abgerufen,[70] sondern auch Wissen aus Spezialdiskursen.[71] Dazu zählt auch das Wissen um Gender und feministische Theorie. Bei der medialen Repräsentation dieser Themen im Zeitungsartikel findet allerdings nicht nur eine bloße Wiedergabe statt.[72]
Vielmehr tragen die Aussagen selbst zur Generierung gesellschaftlichen Wissens bei. Hier wird Wissen neu kombiniert, akzentuiert, in neue Kontexte gestellt und den Rezipient_innen [sic!] zugänglich gemacht; wissenschaftliches Spezialwissen wird in das gesellschaftliche Alltagswissen integriert.[73]
Zugleich findet immer auch eine Bewertung dieses Wissens statt; im Falle feministischer Themen werden diese meist abgewertet. Diese Abwertung erfolgt sowohl explizit als auch implizit mittels zahlreicher Strategien, deren Ziel die Delegitimierung des Feminismus ist. Die Wirksamkeit entsprechender Delegitimierungsstrategien hängt davon ab, „ob es gelingt, einen Diskurs zu etablieren, der sich über die Debatte hinaus verfestigt und in das gesellschaftliche Alltagswissen eingeht“.[74] Dies ist bei den hier analysierten antifeministischen Diskursstrategien oftmals der Fall: So stellt Roßhart fest, dass sich die von ihr untersuchten Aussagen – nach der erstmaligen Äußerung in Leitmedien wie Spiegel und FAZ – auch in anderen Medien wiederfinden.[75]
2.3 Diskurse haben Vergangenheit und Zukunft
Bei der Diskursanalyse ist zu beachten, dass Diskurse eingebettet sind in einen mitunter weit zurückreichenden historischen Kontext.[76] Denn Diskurse „entstehen nicht aus dem Nichts“,[77] vielmehr können sie sich – zum Beispiel aufgrund diskursiver Ereignisse – im Laufe der Zeit verändern, können sich mit anderen Diskurssträngen verbinden oder aber auch ganz versiegen.[78] Anders ausgedrückt, haben Diskurse eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft.[79] Ein einzelner Diskursstrang, welcher aus verschiedenen Diskursfragmenten zu einem bestimmten Thema besteht, hat somit neben der synchronen Dimension – d.h. was zu einem bestimmten Zeitpunkt über das Thema sagbar war und gesagt wurde – auch eine diachrone, d.h. geschichtliche Dimension, nämlich was im Verlauf der Zeit bzw. in der Vergangenheit zu dem Thema sagbar war.[80] In dieser diachronen Dimension besteht der Diskurs folglich aus einer Aneinanderreihung mehrerer Diskurse zu verschiedenen Zeitpunkten, aber zu einem einheitlichen Thema. Durch eine diachrone Analyse, die somit aus vielen kleinen synchronen Analysen besteht, kann der Fluss diskursiven Wissens durch die Zeit untersucht werden.[81] Auf diese Weise können sowohl Veränderungen als auch Kontinuitäten im Diskursstrang festgestellt werden, zudem können die jeweiligen Ausprägungen und eventuelle Besonderheiten des untersuchten Diskurses zu verschiedenen Zeitpunkten verglichen werden.[82] Dazu ist es erforderlich, einen größeren Zeitabschnitt auszuwählen, um „Änderungen, Brüche, Versiegen und Wiederauftauchen“[83] der Diskursstränge sichtbar machen zu können. Daher habe ich mich entschieden, eine diachrone Analyse durchzuführen, die einen Zeitraum von circa vier Jahrzehnten umfasst, nämlich die Zeit von den 1980er Jahren bis Anfang des aktuellen Jahres 2013. Um eine derart umfangreiche Untersuchung überhaupt möglich zu machen,[84] empfiehlt Jäger, insbesondere aufgrund der Problematik der historischen Materialerhebung, explizit den Rückgriff auf Ergebnisse, „die in anderen Projekten erhoben worden sind“, und auf diese Weise eine Sekundäranalyse bzw. Meta-Analyse vorzunehmen.[85] Zudem reiche es, wenn die für die Feinanalyse ausgewählten Artikel für den untersuchten Diskursstrang typisch seien.[86] Bei mehreren synchronen Schnitten hintereinander, wie hier angestrebt, warnt er zudem davor „sich nach traditionellen Epochenabschnitten zu richten“,[87] schließlich habe Foucault aufgezeigt, dass Geschichtsschreibung oft verfälschend sei.[88] Daher habe ich zwar relativ klare Abschnitte gewählt, die sich grob in die 80er, 90er, die Nullerjahre und das Jahr 2012 aufteilen; für die vergangenen Zeiträume beziehe ich mich jedoch auf Analysten, die sich keinesfalls streng an zeitliche Grenzen halten, sondern ihre Analyse nach diskursiven Ereignissen, meist der kurz bevorstehenden Verabschiedung von (pro-feministischen) Gesetzen, ausrichten. Explizit stütze ich mich für die Analyse antifeministischer Diskursstrategien in den 80er Jahren auf Susan Faludi, für die 90er Jahre auf die Untersuchungen von Simon Möller und Brigitta Huhnke, und für die Nullerjahre auf Julia Roßhart, welche Zeitungsartikel des Jahres 2006 auf die darin enthaltenen antifeministischen Diskurselemente analysiert. Im Anschluss werde ich eine eigene empirische Untersuchung hegemonialer Zeitungsartikel für das Jahr 2012 durchführen. Auf diese Weise spannt die in dieser Arbeit vorgenommene diachrone Diskursanalyse einen Bogen von den 80er Jahren bis zur Jetztzeit, und soll so – unter Rückgriff auf die oben genannten Autoren – aufzeigen, welche antifeministischen Argumentationsmuster und Strategien wann und wie von den diversen Diskursteilnehmern verwendet werden. Hier ist insbesondere interessant, ob es immer wieder dieselben Strategien sind – wie beispielsweise Bedeutungsverschiebungen von ehemaligen Fahnenwörtern oder Verunglimpfung von feministischen Annahmen, die gegen den Feminismus ins Feld gebracht werden, und welche sich im Laufe der Zeit zu einem Muster weiterentwickelt haben – oder ob es durchaus neue Argumente oder Strategien gibt. Diese Strategien, die von vielen antifeministischen Agitatoren eingesetzt werden, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, können vielfältige Formen annehmen. So wird versucht,
Richtung und Inhalte eines Diskursstrangs im eigenen Interesse und […] unter Verfolgung bestimmter Ziele zu verändern, indem man bestimmte Tricks anwendet wie z.B. ‚Begriffe besetzen’, ‚auf die Schüppe [sic!] nehmen’, ‚polemisieren’, ‚ironisieren’, ‚scheibchenweise nachschieben’, ‚ständig etwas wiederholen’, ‚Journalisten ‚kaufen’’, ‚kritisieren’, ‚auf Evidenzen verweisen’, ‚Alternativlosigkeit behaupten’, ‚binären Reduktionismus betreiben’, ‚geschickte rhetorische Mittel verwenden’, und ‚manipulieren’, ‚Statistiken verdrehen’, ‚Kollektivsymbole einsetzen’, etc. Solche Taktiken sind Waffen in den diskursiven Kämpfen.[89]
Auch die Strategie der permanenten Konnotationsverschiebung scheint sehr erfolgreich zu sein, um vormals positiv besetzte Schlüsselwörter durch die wiederholte Verwendung des Wortes in einem „leicht verschobenen Kontext“ zu einem negativen Stigmawort umzuschreiben.[90]
Durch die oben beschriebene Vorgehensweise ist es möglich, die Vergangenheit des antifeministischen Diskursstranges umfassend zu beleuchten. Zusätzlich kann durch die fortlaufende Einbettung des Diskursstranges in politische und gesellschaftliche Ereignisse und den Vergleich der verschiedenen Einzelanalysen herausgearbeitet werden, in welchem Kontext und aufgrund welcher Rahmenbedingungen antifeministische Diskurse aufblühen und an Macht gewinnen. In der Folge kann anschließend auch eine Prognose für die Zukunft des Diskursstranges gestellt werden.[91]
Aufgrund der breit angelegten Analyse, die sowohl eine diachrone als auch drei synchrone Einzelanalysen umfasst und sich zudem mit deren Vergleich und Bewertung beschäftigt, ist die Fragestellung als Pilotuntersuchung angelegt, die den Weg für weitere Untersuchungen bereitet.[92]
2.4 Die Methode
Bei der Analyse ergibt sich zwangsläufig folgendes Problem: Wie lassen sich Diskursstränge trotz ihrer Verflechtung mit anderen Diskurssträngen analysieren?[93] Jäger empfiehlt, „sich auf die Ermittlung des unmittelbaren diskursiven Kontextes eines zu untersuchenden Diskursstrangs zu beschränken“.[94] Am Anfang der Analyse steht also die Entscheidung für einen thematischen Bereich auf einer bestimmten diskursiven Ebene;[95] hier steht die Berichterstattung über die Frauenquote auf der Ebene des Zeitungsdiskurses im Zentrum. Diese Debatte bietet sich gleich in mehrfacher Hinsicht für eine Analyse an: So wurde die Frauenquote ein ganzes Jahr lang in verschiedenen Zeitungsmedien sehr kontrovers diskutiert, und bietet damit einen umfangreichen Analysecorpus. Zudem wird vermutet, dass die Thematik, welche an gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit und feministischen Zielen rührt, dazu führt, dass in der Debatte zahlreiche antifeministische Strategien zu finden sind. Ziel der Analyse ist es, diese Diskursstrategien sichtbar zu machen. Für die Erstellung eines Materialcorpus[96] werden dazu sieben ausgewählte Zeitungen so lange durchsucht, bis der Diskurs inhaltlich erfasst ist.[97] In der anschließenden Strukturanalyse wird herausgearbeitet, welche Artikel aufgrund Themenrepräsentation, Schwerpunktsetzung, Argumentationsverlauf, Verschränkungen mit anderen Diskurssträngen und Berichtsstil als typisch gelten und einer Feinanalyse unterzogen werden können.[98] Die Bezeichnung ‚typisch’ bedeutet, dass das Fragment den Diskursstrang zwar nicht in all seinen Facetten, aber zumindest in entscheidenden Anteilen repräsentiert.[99] Durch diese Vorgehensweise kann die weitere Analyse stattfinden, ohne unter einer Flut von Fragmenten den Blick für das Wesentliche zu verlieren.[100] Das so entstandene Dossier[101] wird anschließend einer Feinanalyse unterzogen, mit Augenmerk auf dem institutionellen Rahmen bzw. Kontext. Hier ist zum Beispiel entscheidend, um welches Medium es sich handelt und wie wichtig Artikel und Autor für die Debatte sind. Außerdem ist interessant, ob diskursive Ereignisse, wie beispielsweise die nahende Verabschiedung eines feministischen Zielen entsprechenden Gesetzes, vorhanden sind, welche sowohl den einzelnen Artikel, als auch den gesamten Diskurs möglicherweise stark beeinflusst haben. Daneben ist auch interessant, in welcher Weise der Text Bezug auf gesellschaftliches Vorwissen nimmt. Der Text selbst wird zudem auf sprachlich-rhetorische Mittel, wie beispielsweise
Argumentationsstrategien, Logik und Komposition, Implikate und Anspielungen, Kollektivsymbolik/Bildlichkeit, Redewendungen und Sprichwörter, Wortschatz, Stil, Akteure, Referenzbezüge etc[102]
sowie auf inhaltlich-ideologische Aussagen hin untersucht. Dabei geht es um das zugrunde liegende Menschenbild, Vorstellungen von Geschlecht und Gender, das Gesellschaftsverständnis, sowie Normalitäts- und Wahrheitssetzungen.[103] Zum Schluss steht die Frage: Welche Aussagen werden mit welchen Mitteln und an welche Zielgruppe gerichtet? Welche Bezüge gibt es zum hegemonialen Diskurs, und welches Ziel verfolgt der Autor selbst?
Darüber hinaus ist wichtig, dass Diskurse nicht losgelöst von ökonomischen und sozialen Bedingungen sind, welche die Gesellschaft nachhaltig prägen.[104] Daher wird es zu jedem Zeitabschnitt auch ein kurzes Kapitel geben, in dem speziell auf diese Rahmenbedingungen eingegangen wird.
Zwingend für jede Diskursanalyse ist zudem, dass sich der Diskursanalytiker selbst in dem von ihm untersuchten Diskurs verortet und Stellung bezieht. Denn bei der Analyse muss sich der Analytiker
darüber im Klaren sein, dass er/sie sich damit immer nur innerhalb von Diskursen bewegt und sich immer nur auf diese als Teilnehmer am Diskurs beziehen und sich nicht auf eine allgemeine und objektive Wahrheit stützen kann.[105]
In dem folgenden Kapitel wird daher eine grundsätzliche Definition der dieser Arbeit zugrunde liegenden Begriffe erfolgen, um auf diese Weise auch die eigene Positionierung im untersuchten Diskurs zu verdeutlichen.
2.5 Weitere zentrale Begriffe dieser Arbeit
Unabdingbar für das Verständnis dieser Arbeit ist die Definition zentraler Begriffe wie ‚Feminismus’ und ‚Antifeminismus’, aus der sich auch die eigene Positionierung ergibt. Allerdings treten hierbei einige Schwierigkeiten auf: So fällt eine umfassende Definition des Begriffes ‚Feminismus’ aufgrund der vielen verschiedenen Ausprägungen, welche die diversen feministischen Strömungen erfahren haben, sehr schwer: Judith Lorber beispielsweise nennt elf verschiedene Formen von Feminismus, welche auf mitunter weit voneinander divergierenden theoretischen Vorannahmen basieren; darunter so unterschiedliche Variationen wie ‚marxist feminism’, ‚development feminism’ und ‚psychoanalytical feminism’.[106] ‚Den’ Feminismus gibt es folglich nicht. Da sich die hier angestrebte Analyse nicht auf eine bestimmte Strömung bezieht, wird dieser Arbeit ein relativ basales Verständnis von Feminismus zugrunde gelegt: Zentral ist die Annahme, dass Männer und Frauen grundsätzlich gleich(berechtigt) sind. Zudem wird vorausgesetzt, dass Geschlecht bzw. Gender eine sozial-gesellschaftlich konstruierte Kategorie ist,[107] von einem biologistischen Geschlechterverständnis wird abgerückt. Zusätzlich wird angenommen, dass das Ziel einer vollständigen Gleichstellung aufgrund der nach wie vor herrschenden patriarchalen Gesellschaftsform noch nicht erreicht ist.[108]
Antifeminismus ist in der Folge die Umkehrung dieser Annahmen, nämlich in der Form, dass die grundsätzliche Gleichheit und Gleichwertigkeit der Geschlechter geleugnet wird[109] und die Unterscheidung zwischen ‚Gender’ und ‚Sex’ zudem nicht anerkannt wird.[110] Vielmehr dominieren biologistische Erklärungsmuster, die den – als diametral gegenübergesetzt gedachten Geschlechtern – jeweils bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben.[111] ‚Der’ Feminismus wird als einheitliche Ideologie gedacht, „pauschal mit Männerfeindlichkeit oder Männerhass“[112] gleichgesetzt und ohne nähere Auseinandersetzung rundweg abgelehnt. Strukturelle und soziale Diskriminierung werden geleugnet oder wegerklärt.[113] Neben der prinzipiellen Gleichwertigkeit der Geschlechter wird auch die feministische Forderung nach gleicher Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen negiert; eine solche gilt als von den Frauen selbst nicht gewünscht[114] oder als schon lange erreicht: So ist die Behauptung, dass Frauen gegenüber Männern bereits ‚mehr als nur gleich’ seien, nämlich ein ‚Feminat’ herrsche, in dem Frauen systematisch bevorzugt werden, Kern der Agitation antifeministischer Männerrechtegruppen.[115] Dazu gehört auch die Klage über einen angeblich machtvollen, institutionalisierten Feminismus, der sich beispielsweise in der Form von Gleichstellungsbeauftragten äußern würde.[116] Typisch für diesen Antifeminismus ist zudem die Behauptung einer männlichen Opferideologie, in der Männer (und nicht Frauen) die gesellschaftlich Benachteiligten sind.[117] Diese Benachteiligung beginne schon in jungen Jahren aufgrund einer „Feminisierung der Pädagogik“.[118] Antifeministischen Agitationen dieser Art finden sich vor allem im Internet und dominieren dort die Diskussionsforen und Kommentarspalten zahlreicher Zeitungen.[119]
3. Antifeministische Diskurse in den 80er Jahren – der Backlash in den USA
Der Begriff ‚Backlash’ wurde von Susan Faludi in ihrer Analyse über den Erfolg antifeministischer Diskurse in den USA im Zeitraum der 80er Jahre erstmalig verwendet: Faludi stellte fest, dass verschiedene Akteure versuchten, die erst ansatzweise hergestellte Geschlechtergleichheit zu untergraben und erstrittene Erfolge, zum Beispiel im Bereich der weiblichen Berufstätigkeit und körperlichen Selbstbestimmung, ‚zurückzudrehen’.[120] Dieser ‚Backlash’ beschränkte sich nicht nur auf den Medien- bzw. Zeitungsdiskurs,[121] vielmehr arbeitete Faludi antifeministische Argumentationsstrategien auch auf der Ebene der Politik und der Kultur heraus, z.B. im Bereich des Films[122] und der Mode.[123] Mittlerweile ist der Begriff und seine Bedeutung in der feministischen Forschung anerkannt,[124] und zwar nicht nur als vergangenes Phänomen:
As we enter a new millennium, the backlash against feminism that erupted in the 1980s, and that became more firmly established in the 1990s, continues to escalate and proliferate.[125]
Der von Faludi diagnostizierte Backlash der 1980er Jahre ist somit kein Einzelfall: Vielmehr scheint es, dass antifeministische Strategien stets unterschwellig im Diskurs vorhanden sind, dabei immer wieder auftauchen und für eine Zeitspanne den gesellschaftlichen Diskurs dominieren. Fraglich ist, wodurch ein solcher Backlash ausgelöst wird. Ferguson, Katrak und Minor schreiben dazu: „Each wave of antifeminism […] arises after certain gains in women’s rights, and aims to erode such successes.”[126] Auch Faludi sieht die Ursache für den Backlash der 1980er Jahre darin, dass die Chancen der Frauen gestiegen seien, den Kampf um volle Gleichberechtigung zu gewinnen; in der Folge zielten die antifeministischen Strategien darauf ab, diese Bedrohung für die wirtschaftliche und soziale Vormachtstellung der Männer abzuwenden.[127] Als ‚Geburtsort’ des Backlash nennt Faludi die evangelikalen Rechten,[128] zu deren Zielen die Rückkehr zu konservativen Geschlechterrollen gehöre.[129] Hier tauchte die zentrale These des Backlash, nämlich dass „die Gleichberechtigung der Grund für die Unzufriedenheit der Frauen sei“,[130] zum ersten Mal auf. Von dort aus verbreiteten sich die verwendeten Argumentationsmuster und Strategien immer weiter.
Anfang der 80er Jahre hatte sich die fundamentalistische Ideologie ihren Weg ins Weiße Haus gebahnt. Mitte der 80er Jahre, als der Widerstand gegen die Frauenrechte politisch und gesellschaftlich akzeptiert worden war, erfasste sie die Massenkultur.[131]
Faludi spricht von einem ‚Medientrend’,[132] in dem dieselben Argumentationsmuster im Zeitungsdiskurs immer wieder aufgegriffen und unhinterfragt weiterverbreitet werden.[133] Sie kritisiert die selbstreferentielle Struktur des Pressewesens, deren Vertreter sich „intensiv vom jeweils herrschenden politischen Trend beeinflussen“[134] lassen, und die durch unkritische Reproduktion antifeministischer Diskursfragmente den antifeministischen ‚Trend’ fortsetzen. So stelle die Presse, insbesondere aufgrund ihrer großen Reichweite,[135] und
getragen von Strömungen, die kaum je ausgelotet wurden, eine Macht dar, die die allgemeine Einstellung zum feministischen Erbe und zu den angeblichen Leiden, die es den Frauen zufügte, stark beeinflusste.[136]
Faludi gibt hier eine akkurate Beschreibung des Diskurses und seiner (Macht-)Wirkung, auch wenn sie die Terminologie der Diskursanalyse nicht verwendet. Ihre Beobachtungen können daher für diese Arbeit fruchtbar gemacht werden: Der von ihr festgestellte antifeministische ‚Trend’ ist tatsächlich der hegemoniale Diskurs, zu dessen Perpetuierung der Zeitungsdiskurs durch die ständige Produktion und Reproduktion antifeministischer Diskursstrategien wesentlich beiträgt.
3.1 Antifeministische Diskursstrategien
Aufgrund der Pluralität der Sprecher stellt Faludi eine Vielzahl antifeministischer Strategien fest: So würden „sowohl die ‚neuesten’ Erkenntnisse der ‚wissenschaftlichen Forschung’“ als auch althergebrachter Moralismus genutzt, um antifeministische Argumente zu stützen.[137] Sie kritisiert zudem, dass oft Behauptungen ohne jeglichen Beweis aufgestellt, und Statistiken sinnverfälschend verwendet werden würden.[138] Viele der antifeministischen Strategien, wie die Strategie der Bedeutungsverschiebung, wirkten zudem subtil:[139] So werde der zuvor positiv besetzte Begriff der Emanzipation als frauenfeindlich deklariert,[140] indem behauptet werde, dass „genau die Schritte, die die Stellung der Frau verbessert haben, […] in Wirklichkeit zu ihrem Untergang geführt“[141] hätten. Der Feminismus werde zudem als Ursache für alle Probleme dargestellt:
Man machte die Frauenbewegung für nahezu alles Leid verantwortlich, von dem Frauen heimgesucht werden, von Depressionen bis zu mageren Sparkonten, von Teenager-Selbstmorden bis zu Eßstörungen und unreiner Haut.[142]
Diese Diskursstrategie, in der dem Feminismus die Schuld an beliebigen gesellschaftlichen Missständen zugeschrieben wird,[143] findet sich auch bei aktuellen Antifeministen. Dabei zeigt Faludis Aufzählung, dass oft der behauptete kausale Zusammenhang zwischen dem festgestellten Übel (z.B. Essstörung) und der angeblichen Ursache (Feminismus) nicht erkennbar ist. Eine weitere Argumentationsfigur der Antifeministen sei die Übertreibung, sowie gezieltes ‚Angstmachen’. So werde behauptet, dass der Feminismus versuche, Männer bzw. Väter abzuschaffen und herabzusetzen.[144] Gewarnt werde außerdem vor einer geplanten[145] oder bereits eingetretenen[146] weiblichen Machtübernahme. Als weitere Strategie nennt Faludi gezielte Verschleierung und Umbenennungen, so sei von ‚familienfreundlichen’ statt ‚frauenfeindlichen’ politischen Programmen die Rede.[147] In den späten 80er Jahren verband sich diese antifeministische Agitation mit dem populär gewordenen Begriff der ‘political correctness’.[148] Auf diese Weise wurde versucht,
the varied impacts of feminist thought inside and outside the academy, the establishment of women’s studies and ethnic studies programs in academic institutions, and social welfare programs[149]
abzuwehren und rückgängig zu machen. Durch die Berichterstattung über die ‚political correctness’-Debatte in deutschen Zeitungsmedien wurden die antifeministischen und sexistischen Strategien auch im deutschen Diskurs etabliert.
3.2 Ursachen
Als eine der Ursachen für den Erfolg antifeministischer Diskursstrategien nennt Faludi die männlich geprägten Massenmedien.[150] Allerdings stellt sie fest, dass sich auch viele Frauen an der antifeministischen Debatte beteiligten:[151] So stammten „etwa ein Drittel der Artikel und fast die Hälfte der die Frauenbewegung denunzierenden Bücher und Pamphlete aus weiblicher Feder.“[152]
Eng verbunden mit der Forderung nach einer „Rückkehr zur Weiblichkeit“[153] sei zudem eine ‚Krise der Männlichkeit’.[154] Denn
[...]
[1] „Das medial produzierte Bild ‚des Feminismus‘ ist maßgeblich daran beteiligt, den Raum zu definieren, der feministischen Praxen zugestanden wird.“ Julia Roßhart: Bedrohungsszenario Gender. Gesellschaftliches Geschlechterwissen und Antifeminismus in der Medienberichterstattung zum Gender Mainstreaming. Elektronisch veröffentlichte Magisterarbeit der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Universität Potsdam, Berlin 2007, URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/1837/pdf/rosshart_magister.pdf (22.02.2013), S. 20.
[2] Hier sei beispielsweise an die Kampagne “Wir haben abgetrieben” im Stern erinnert, die zu einer Änderung des §218 StGB führte. Anonymus: Wir haben abgetrieben. In: Stern vom 6.06.1971, Nr. 24, Titelseite und S. 16-23.
[3] „Auch hat sich nach einer kurzen Phase, während derer die Berichterstattung in den Medien dem Themenkomplex Feminismus annähernd gerecht wurde, [diese] in den 1990er Jahren wieder verschlechtert, und es ‚häufen sich neuerdings die keineswegs mehr subtil, sondern offen antifeministischen Beiträge’.“ Karsta Frank: PC-Diskurs und neuer Antifeminismus in der Bundesrepublik. In: Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften; 38. Jg. Heft 213, S. 25-38. zit. nach Simon Möller: Sexual Correctness. Die Modernisierung antifeministischer Debatten in den Medien. Opladen 1999, S. 59.
[4] Die aktuelle Sexismusdebatte wurde durch einen Stern-Artikel von Laura Himmelreich über die sexistischen Kommentare von FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle ausgelöst. Vgl. Laura Himmelreich: Der Herrenwitz. In: Stern vom 27.01.2013, Ausgabe Nr. 5, oder im Internet: URL: http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-portraet-ueber-rainer-bruederle-der-herrenwitz-1964668.html (17.02.2013).
[5] Vgl. Siegfried Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskusanalyse. Eine Werkzeugkiste. In: Ders./Jan Zimmermann (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit der Diskurswerkstatt im DISS (Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung). Münster 2010, S. 18.
[6] Vgl. ebd.
[7] Vgl. ebd.
[8] Vgl. ebd., S. 8. Michel Foucault gilt als Begründer der Diskursanalyse. Das Konzept dazu stellte er 1969 in seinem Werk ‚Archäologie des Wissens’ vor. Darin entwickelte er u.a. den Begriff des Diskurses und analysierte dessen Verflochtenheit mit ‚Wissen’ und ‚Macht’. Allerdings hat Foucault nie eine strukturierte Methode für die Diskursanalyse vorgelegt. Vielmehr bezeichnete er seine Thesen als Steinbruch, aus dem andere Wissenschaftler eigene Theorien entwickeln sollten. Daher stütze ich mich hier auf die Methode, die Siegfried Jäger und andere auf der Grundlage von Foucaults Annahmen entwickelt haben. Ihre Vorgehensweise bietet sich unter anderem deshalb an, da die Methode bereits gut erprobt ist: U.a. wurden mit ihr schon Zeitungsartikel auf rassistische Diskursstrategien untersucht. Vgl. Anonymus: Diskurswerkstatt. In: Homepage des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung, URL: http://www.diss-duisburg.de/diskurswerkstatt/ (22.02.2013).
[9] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 8.
[10] Ebd., S. 9.
[11] Vgl. ebd., S. 130.
[12] Vgl. ebd., S. 10.
[13] Beispielsweise durch Verleugnungsstrategien oder Relativierungsstrategien. Vgl. Siegfried Jäger: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. 2. Aufl. Duisburg 1999, S. 130.
[14] „Für Foucault ist der Diskurs aber nicht einfach nur die Menge von Gesagtem oder Geschriebenem. Unter Diskurs versteht er einen Zusammenhang von Aussagen, der das Wissen innerhalb eines räumlich und zeitlich begrenzten Kulturraums bedingt. Es geht Foucault um Aussagen, die einen Wahrheitswert besitzen.“ Arne Klawitter/Michael Ostheimer: Literaturtheorie – Ansätze und Anwendungen. Göttingen 2008. S. 162-177, S. 163.
[15] Grundsätzlich findet eine Unterscheidung zwischen dem Spezialdiskurs (d.h. der Wissenschaft) und dem Interdiskurs (d.h. allen nicht-wissenschaftlichen Diskursen) statt. Aus dem Spezialdiskurs fließen immer wieder Elemente in den Interdiskurs ein. Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 159. Der Interdiskurs umfasst auch das kulturelle, mitunter stark selektive Allgemeinwissen. Vgl. ebd., S. 132.
[16] Vgl. ebd., S. 148. Seit einiger Zeit wird unter dem Textbegriff jede sprachliche Äußerung verstanden. Diese kann sowohl schriftlich als auch mündlich sein. Das klassische Verständnis, nach dem nur schriftliche Texte als Texte aufgefasst wurden, ist somit obsolet und hier nicht gemeint. Vgl. Klaus Brinker: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 7. Aufl. Berlin 2010.
[17] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 148.
[18] Vgl. ebd.
[19] Ebd.
[20] Ebd., S. 171.
[21] Vgl. ebd., S. 117.
[22] Alle Diskurse bilden zudem die „Voraussetzungen für den weiteren Verlauf des gesamtgesellschaftlichen Diskurses.“ Ebd.
[23] Vgl. ebd.
[24] Vgl. ebd., S. 129.
[25] Vgl. Roßhart: Bedrohungsszenario Gender, S. 6.
[26] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 129.
[27] Vgl. ebd. Auch laut Foucault gibt es keine ewig gültigen Wahrheiten. Vgl. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 123. Es handelt sich hierbei nicht um einen objektiven, philosophisch oder mathematisch stichhaltigen Wahrheitsbegriff, sondern ‚Wahrheit’ wird beliebigen zeitweilig und intersubjektiv gültigen und akzeptierten Aussagen zugeschrieben.
[28] Laut Jäger entwickelt jede Gesellschaft eigene Techniken, „um festzulegen, was als wahr und was als nicht wahr gilt.“ Ebd. Diese Regeln sorgen dafür, dass ‚wahres’ von ‚falschem’ unterschieden wird. Dieser Prozess ist eng mit Machtverhältnissen verbunden: „Die Wahrheit ist zirkulär an Machtsysteme gebunden, die sie produzieren und stützen, und an Machtwirkungen, die von ihr ausgehen und sie produzieren.“ Michel Foucault: Dispositive der Macht. Michel Foucault über Sexualität, Wissen, und Wahrheit. Berlin 1978, S. 53f.
[29] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 147.
[30] Vgl. ebd., S. 146f.
[31] Vgl. ebd., S. 146.
[32] Ebd., S. 223.
[33] Foucault schreibt hierzu, dass der Diskurs nicht nur Macht produziert, reproduziert und verstärkt, sondern zugleich unterminiert. Vgl. Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Frankfurt/M. 1983, S. 122. Die gesellschaftliche Macht sei ein Netz, „das sich über die gesamte Gesellschaft spannt.“ Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 210. Allerdings sei die Verteilung nicht homogen, vielmehr bilden die Diskurse einen andauernden Machtkampf ab. (Vgl. ebd.) Obwohl allen Individuen eine gewisse Macht zukomme, gelänge es einzelnen Individuen bzw. Gruppen immer wieder, „ein Feld von Machtbeziehungen zu blockieren, sie unbeweglich und starr zu machen und jede Umkehrung der Bewegung zu verhindern – durch den Einsatz von Instrumenten, die sowohl ökonomischer, politischer oder militärischer Natur sein mögen“ (Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 80). In diesem Fall hätten dann diese Individuen oder Gruppen die Macht erlangt, über andere Menschen zu bestimmen, so dass Ausgrenzung und Ausbeutung der Beherrschten möglich sei; ein Herrschaftszustand sei erreicht. Vgl. ebd., S. 80.
[34] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 149.
[35] Ebd.
[36] Vgl. ebd., S. 223.
[37] Vgl. Möller: Sexual Correctness, S. 96.
[38] Vgl. ebd., S. 21.
[39] Ebd.
[40] Roßhart: Bedrohungsszenario Gender, S. 6.
[41] Vgl. Möller: Sexual Correctness, S. 96.
[42] Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 223. Möller fragt daher mit Blick auf die Erhaltungsmechanismen zugunsten patriarchaler Dominanzverhältnisse: „Welche Strategien des Verschweigens, Betonens, Verschiebens usw. dienen […] zur Legitimation der herrschenden gesellschaftlichen Ordnung mit ihren ungleichen Geschlechterrollenzuweisungen? Welche Strukturen sind es, die bestimmte Äußerungen (un-) möglich machen, und welche Strukturen werden wiederum von den entsprechenden Aussagen stabilisiert? Welche Vorurteile im Sinne eines sexistischen ‚Allgemeinwissens’ werden bestätigt bzw. neu strukturiert?“ Möller: Sexual Correctness, S. 99.
[43] Vgl. Jäger: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 15.
[44] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 127.
[45] Vgl. ebd., S.170.
[46] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 121.
[47] Vgl. ebd., S. 19.
[48] Vgl. ebd.
[49] Ebd., S. 129. Als Beispiel nennt Jäger die Spätfolgen von faschistischer Sprache, die wie kleine Arsendosen wirke und erst nach längerer Zeit ihre Giftwirkung entfalte. Vgl. ebd., S. 130.
[50] Gemeint sind hier sämtliche Medien der Massenverbreitung, d.h. vor allem Funk – und Printmedien, aber auch das Internet.
[51] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse. S. 84f.
[52] Vgl. ebd.
[53] Ebd., S. 86.
[54] Ebd., S. 19.
[55] Vgl. ebd.
[56] Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 194.
[57] Vgl. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 85.
[58] Unter anderem Möller kritisiert, dass „in der Realität feministischen Positionen der Zugang zu den Massenmedien weitgehend verwehrt ist.“ Simon Möller: Operation gelungen. In: Der Freitag vom 21.03.2003, URL: http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/operation-gelungen (22.02.2013). Zudem sei „ein Effekt dieser ungleich verteilten Möglichkeiten zur Gestaltung der veröffentlichten Meinung […], dass in den Medien Konflikte nicht mit Argumenten, sondern über ‚Meinungsmache’ ausgetragen werden“; dies treffe insbesondere auf die mediale Verhandlung feministischer Themen zu. Möller: Sexual Correctness, S. 98.
[59] Vgl. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 86. Dies hängt oft von der grundsätzlichen Positionierung der Redaktion ab. Falls bei einer Zeitung eine solche Abweichung vom Mainstream (d.h. von dem hegemonialen Diskurs) festgestellt wird, dann sei dies ein Indiz dafür, dass diese Zeitung ein Organ des Gegendiskurses (oder des gesellschaftlichen Randes oder aber Vertreter eines wissenschaftlichen Spezialdiskurses) sei. Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse. S. 210.
[60] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 85. Vgl. auch Jäger: Kritische Diskursanalyse. S. 210.
[61] Ebd., S. 163.
[62] Vgl. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 85.
[63] Vgl. Roßhart: Bedrohungsszenario Gender, S. 7 bzw. Möller: Sexual Correctness, S. 101.
[64] Roßhart: Bedrohungsszenario Gender, S. 7f. „Die öffentlich-politische Meinung ist dabei auch Produkt medialer Berichterstattung. […] Eine einzelne Debatte generiert nun in der Regel keine Meinung, die sich in politischen Programmen und gesamtgesellschaftlichen Einstellungen niederschlägt. Allerdings sind einzelne Debatten nicht losgelöst von den sie umgebenden Diskursen denkbar; sie sind verbunden mit vergangenen und zukünftigen Diskursen, und das generierte Wissen bleibt nie wirkungslos bezüglich zukünftigen Wissens. Es geht bei der Frage nach den Folgewirkungen der Debatte also nicht darum, ob sie wirksam ist, sondern auf welche Weise und in welchem Maße.“ Ebd., S. 90f.
[65] Ebd., S. 8.
[66] Vgl. Stuart Hall: Encoding/Decoding. In: ders. u.a. (Hrsg.): Culture, Media, Language. Working Papers in Cultural Studies 1972-1979. London 1980, S. 128-138, S. 134.
[67] Vgl. ebd.
[68] Roßhart: Bedrohungsszenario Gender, S. 8.
[69] Ebd., S. 5.
[70] Ebd., S. 6. Dabei gibt Roßhart zu bedenken, dass Aussagen in öffentlichen Mediendebatten „bereits einen gewissen gesellschaftlichen ‚Stand‘ haben und über gesellschaftlichen Rückhalt verfügen“ müssen, um als ‚allgemeines Wissen’ verbreitet werden zu können. Ebd.
[71] Vgl. ebd., S. 5.
[72] Vgl. ebd., S. 7.
[73] Ebd.
[74] Ebd., S. 92.
[75] Vgl. ebd., S. 6. Ein Leitmedium ist v.a. durch einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung und auf andere Medien definiert, vgl. Jürgen Wilke: Leitmedien und Zielgruppenorgane. In: ders. (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Köln 1999, S. 302-329.
[76] Vgl. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 42.
[77] Ebd., S. 188.
[78] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 202. Diskursive Ereignisse sind Vorkommnisse, die den Verlauf des Diskurses entscheidend beeinflussen. Vgl. ebd., S. 201.
[79] Vgl. ebd., S. 169.
[80] Vgl. ebd., S. 160.
[81] Vgl. ebd.
[82] Vgl. ebd., S. 201.
[83] Ebd., S. 169.
[84] „Wenn man bedenkt, dass bereits ein synchroner Schnitt durch einen thematisch relevanten Diskursstrang hunderte bis tausende von Diskursfragmenten enthält und sich die Anzahl von Diskursfragmenten bei diachroner Untersuchung von Diskurssträngen noch einmal vervielfacht, dann ist zu ermessen, wie riesig der Arbeitsaufwand wäre, strebte man ein solches Ziel an.“ Ebd., S. 171.
[85] Vgl. ebd., S. 198f: „Bei der empirischen Ermittlung von (historischen) Diskurssträngen kann man sich hilfsweise auf Ergebnisse anderer Forschung beziehen .“
[86] Vgl. ebd., S. 172.
[87] Ebd., S. 191.
[88] Vgl. ebd., S. 199.
[89] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 46.
[90] „Diese Taktik [ist] besonders diskursmächtig mit dem Begriff ‚political correctness’ gelungen.“ Brigitta Huhnke: Geschlecht und Politik im Spiegel der Medien. LabourNet Germany, Archiv, Letzte Änderung 17.04.2003, URL: http://labournet.de/diskussion/wipo/glob/huhnke.html (22.02.2013).
[91] Hier muss nach den „wahrscheinlichen und möglichen Zukünften des Diskursstrangs“ gefragt werden, um eine Prognose stellen zu können. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 42.
[92] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 191.
[93] Vgl. ebd., S. 159.
[94] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 42.
[95] Ich richte mich hier nach der Methode von Jäger; allerdings stellt dieser selbst fest, dass der von ihm vorgeschlagenen Vorgehensweise nicht sklavisch gefolgt werden muss. Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 172.
[96] Vgl. ebd., S. 198.
[97] Dies ist der Fall, wenn inhaltlich nichts ‚Neues’ mehr zum Diskurs gefunden werden kann. Vgl. ebd., S. 211. Bereits hier zeigen sich Häufungen, Trends und Schwerpunkte der Debatte. Vgl. Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 122.
[98] Vgl. Jäger: Kritische Diskursanalyse, S. 193.
[99] Vgl. ebd., S. 184.
[100] Vgl. ebd., S. 193.
[101] Vgl. ebd., S. 198.
[102] Ebd., S. 175.
[103] Ebd.
[104] Vgl. ebd., S.157.
[105] Jäger u.a.: Lexikon Kritische Diskursanalyse, S. 21.
[106] Vgl. Judith Lorber: The Variety of Feminisms and their Contributions to Gender Equality. Oldenburg 1997. Ilse Lenz konstatiert dagegen allein für den Zeitraum der 1970er und 80er Jahre circa zehn unterschiedliche Strömungen des deutschen Feminismus. Ilse Lenz: Die neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung. Wiesbaden 2008, S. 31.
[107] Dies bedeutet, „dass das biologische Geschlecht (‚sex’) nicht einfach als ‚gegeben’ zu betrachten [ist], sondern selber als ‚gendered category’, eben als vergeschlechtlichte und vergeschlechtlichende Kategorie zu konzipieren ist. Das bedeutet nicht, ‚Natur’ auszuklammern, sondern systematisch daraufhin zuweisen [sic!], dass ‚Natur’ nur als kulturell gedeutete für uns wahrnehmbar ist.“ Regine Gildemeister: Soziale Konstruktion von Geschlecht. In: Interdependenzen. Geschlecht, Ethnizität und Klasse. Virtuelles Seminar, Kooperationsprojekt der Humboldt-Universität (Berlin), Justus-Liebig-Universität (Gießen) und Christian-Albrecht-Universität (Kiel), URL: http://www2.gender.hu-berlin.de/geschlecht-ethnizitaet-klasse/www.geschlecht-ethnizitaet-klasse.de/indexb5e9.html?set_language=de& bzw. PDF-Version: http://www2.gender.hu-berlin.de/geschlecht-ethnizitaet-klasse/www.geschlecht-ethnizitaet-klasse.de/upload/files/CMSEditor/Soziale%20Konstruktion%20von%20Geschlecht.pdf (22.02.2013), S. 7.
[108] Vgl. Susan Faludi: Die Männer schlagen zurück. Wie die Siege des Feminismus sich in Niederlagen verwandeln und was Frauen dagegen tun können. Hamburg 1993, S. 28. Vgl. auch: „[D]ie Emanzipation der Frau, [ist] allen medial dominanten Einflüsterungen zum Trotz, immer noch ein gesellschaftlich unabgegoltenes Anliegen.“ Stefanie Ehmsen: Der halbe Weg zur Hälfte des Himmels. Vier Jahrzehnte Neue Frauenbewegung. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Blätter 9/2008, S. 91-99, URL: http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2008/september/der-halbe-weg-zur-haelfte-des-himmels (02.10.2012). Vgl. auch Ilse Lenz: Der neue Antifeminismus. Der Fall Kachelmann und das Bild vom männlichen Opfer. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 7/2011, S. 51-59, URL: http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2011/juli/der-neue-antifeminismus (06.11.2012).
[109] Vgl. Hinrich Rosenbrock: Die antifeministische Männerrechtsbewegung. Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung. In: Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Berlin 2012, URL: http://www.boell.de/publikationen/publikationen-antifeministische-maennerrechtsbewegung-13838.html bzw. PDF-Version: http://www.boell.de/downloads/Antifeminismus-innen_endf.pdf (22.02.2013), S. 7.
[110] Vgl. Thorn, Christiane: „Gender Mainstreaming“ im Gegenwind: Die Kontroverse in den Medien und Möglichkeiten feministischer Gegenrede(n)“ [sic!]. Vortrag vom 08.05.2007 im Sozialwissenschaftlichen Arbeitskreis des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt-Universität Berlin, URL: http://www.genderkompetenz.info/veranstaltungs_publikations_und_news_archiv/Archiv/analyse_mediendebatte/index.html/?searchterm=Thorn bzw. PDF-Version: http://www.genderkompetenz.info/w/files/sozak/thorngenderdiskursemai07.pdf (22.02.2013), S. 7. Vgl. auch Rosenbrock: Die antifeministische Männerrechtsbewegung, S. 15.
[111] Dieser Geschlechterdualismus gilt als „biologisch gegeben und somit als soziale (Zwangs-) Norm, die durchzusetzen ist. Statt die Variabilität des Gender-Konzeptes als Befreiung aus geschlechtlich-sozialen Zwangskorsetten zu betrachten, wird die Möglichkeit, sich anders als traditionell zu verhalten, zum Zwang uminterpretiert. Freiheit im Sinne dieser Argumentation bedeutet, an (wissenschaftlich nicht belegbaren) ‚natürlichen’ Vorgaben starr festzuhalten.“ Rosenbrock: Die antifeministische Männerrechtsbewegung, S. 15. Widersprüchlich ist zudem, dass die – eigentlich doch als ‚natürlich’ und ‚unveränderlich’ behauptete – Geschlechtsidentität als durch den Feminismus und Konzepte wie ‚Gender Mainstreaming’ bedroht erfahren wird. Vgl Roßhart: Bedrohungsszenario Gender, S. 79.
[112] Rosenbrock: Die antifeministische Männerrechtsbewegung, S. 11.
[113] Vgl. ebd., S. 14.
[114] Vergleiche die Debatte um die Frauenquote, in der immer wieder geäußert wird, dass Frauen kein Interesse ‚am Chef-Sein’ hätten. Vgl. auch die These: „Mütter werden von der Politik zur Erwerbsarbeit genötigt, wollen das aber gar nicht.“ Andrea Geier: Stellt ihn vom Platz! Eine rote Karte für Volker Zastrows geschlechterpolitische Rhetorik der Diffamierung. In: Literaturkritik.de vom 07.07.2006, Nr. 7/2006, URL: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=9641 (22.12.2012).
[115] So behauptet die Männerrechtsbewegung, „dass der Feminismus die Politik, die Justiz und teilweise auch die Medien (mit)kontrolliert.“ Rosenbrock: Die antifeministische Männerrechtsbewegung, S. 14. In diesem ‚Feminat’ seien Frauen zum „bevorzugten Geschlecht erhoben worden.“ Ebd., S. 77. Tatsächlich kann von einem solchen ‚Feminat’ nicht die Rede sein. Vgl. ebd., S. 28. Vielmehr wird auf diese Weise versucht, „männliche (Vor-)Rechte […] gegenüber den Frauen“ zu verteidigen. Ebd. S. 8.
[116] Vgl. ebd., S. 14.
[117] Dies ist nicht unproblematisch, da neben der Behauptung männlicher Benachteiligung weibliche Diskriminierung völlig ausgeblendet wird. Vgl. Rosenbrock: Die antifeministische Männerrechtsbewegung, S. 14.
[118] Vgl. Claudia Lücking-Michel: Schlaue Mädchen – Dumme Jungen? Gegen Verkürzungen im aktuellen Geschlechterdiskurs. Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums. München 2009, URL: http://www.bundesjugendkuratorium.de/pdf/2007-2009/bjk_2009_4_stellungnahme_gender.pdf (22.02.2013), S. 7, welche dieser Behauptung entgegentritt.
[119] So bemerkt Ilse Lenz, dass vor allem in Diskussionsforen wie ‚Spiegel Online’, ‚Focus Online’ und ‚Zeit Online’ Antifeministen „gezielt intervenieren.“ Lenz: Der neue Antifeminismus. Auch Robert Claus stellt fest: „Lange Zeit unbemerkt, hat sich in unzähligen Internetforen maskulinistischer Provinienz [sic!] die neueste Spielart antifeministischer Agitation formiert. Deren Virtualität sollte jedoch keineswegs zur Unterschätzung der selbsternannten ‚Bewegung‘ führen. Immerhin dominieren sogenannte Männerrechtler mittlerweile die Kommentarspalten vieler Leitmedien, erhalten institutionellen Rückenwind, warten mit ganz ‚analogen‘ Veranstaltungen auf und schärfen damit ihr gesellschaftspolitisches Profil“. Robert Claus: Männerrechtler 2.0.11 [sic!]. Eine Rezension über Andreas Kemper: (R)echte Kerle. Zur Kumpanei der MännerRECHTSbewegung. In: Querelles-net.de, Rezensionszeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung, Bd. 12, Nr. 3, Berlin 2011, URL: http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/962/962 (22.02.2013).
[120] An diesem Backlash wirken vielfältige Akteure mit, sei es direkt (z.B. konservative Frauenvereine) oder indirekt (z.B. zahlreiche Journalisten, die, den Eigenheiten des Zeitungsdiskurses folgend, den Diskurs durch Repetition weiterleben lassen. Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 25. Vgl. auch: „Antifeminist harassment was being launched in the form of censorship, ridicule, job discrimination, and personal threat.” Moira Ferguson/Ketu H. Katrak/Valerie Miner: Feminism and Antifeminism: From Civil Rights to Culture Wars. In: VèVè Clark/Shirley Nelson Garner/Margaret Higonnet/Ketu H. Katrak (Hrsg.): Antifeminism in the Academy. New York/London 1996, S. 35-66. S. 48.
[121] Wie weit verbreitet der ‚Backlash’, von Ferguson und Co. ‚Culture Wars’ genannt, ist, zeigt auch folgendes Zitat: „Part of a national debate, they seep into our daily lives through popular culture and mass-media rhetoric […]. These negative messages against women […] enter both private and public spaces, broadcast into our living rooms via radio and television, discussed in our classrooms, reported in newspapers and magazines.” Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 49.
[122] Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 170ff.
[123] Vgl. ebd., S. 240ff.
[124] Vgl. u.a. Rhonda Hammer: Antifeminism and Family Terrorism. A Critical Feminist Perspective. Maryland 2002, S. 24; Möller: Sexual Correctness, S. 53; Ehmsen: Der halbe Weg zur Hälfte des Himmels; Huhnke, Brigitta: Macht, Medien und Geschlecht. Eine Fallstudie zur Berichterstattungspraxis der DPA, der TAZ sowie der Wochenzeitungen Die Zeit und Der Spiegel von 1980-1995, Opladen 1996, S. 164; Christiane Thorn: „Gender Mainstreaming“ im Gegenwind, S. 6; Scharff, Christina: The new German feminisms: of Wetlands and Alpha‐Girls. In: R. Gill/dies. (Hrsg.): New femininities: postfeminism, neoliberalism and subjectivity. London 2011, URL: http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/cmci/people/papers/scharff/wetlands.pdf (22.02.2013), S. 3; Rochus Wolff: Schuld war nur der Feminismus. Im rosa Kampfanzug: Eva Herman gibt das Strohpüppchen einer neuen reaktionären Familienpolitik. Eine Erledigung. In: Querelles-net.de, Rezensionszeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung, Nr. 20, Berlin 2006, URL: http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/485/493 (22.12.2012); Karen Ross: Gendered Media. Women, Men and Identity Politics. Maryland 2010, S. 38; Schoppengerd, Stefan: Das Unbehagen in der postfeministischen Kultur. Eine Rezension über Angela McRobbie: Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes. Wiesbaden 2010. In: Querelles-net.de, Rezensionszeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung, Bd. 11, Nr. 3, Berlin 2010, URL: http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/899/881 (22.02.2013); Claus: Männerrechtler 2.0.11 [sic!].
[125] Hammer: Antifeminism and Family Terrorism, S. 34.
[126] Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 50.
[127] Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 22f. Vgl. auch: “The eighties saw substantial gains and losses for women. […] Rather than the goal of equality being achieved, it was precisely the fear of women moving towards it that was perceived as a threat.” Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 51.
[128] Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 216. Vgl. auch: Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 50.
[129] Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 22.
[130] Ebd., S. 216.
[131] Ebd., S. 22.
[132] Vgl. ebd., S. 317.
[133] In der Berichterstattung über diese ‚Medientrends’ würden „Fakten durch Prognosen ersetzt“: „Nicht immer gibt sich die Trendstory als solche zu erkennen – aber bestimmte Charakteristika verraten sie: das Fehlen wirklicher Beweise und konkreter Zahlen; die Tendenz, zur Begründung des Trends nur drei oder vier, meist anonyme, Frauen zu zitieren; der Gebrauch vager Wendungen wie ‚Man hat das Gefühl, dass’ oder ‚immer öfter’, ‚immer mehr’; ein häufiger Gebrauch des prophezeienden Futurs (‚Frauen werden immer öfter zu Hause bleiben und mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen’) und die Berufung auf ‚Autoritäten’ wie Verbraucherforscher und Psychologen, die wiederum ihre Behauptungen oft durch andere Trendstorys untermauern.“ Ebd., S. 130f.
[134] Ebd., S. 126.
[135] Vgl. ebd.
[136] Ebd.
[137] Ebd., S. 20.
[138] Vgl. ebd., S. 31ff und S. 61.
[139] Vgl. ebd., S. 24. “Antifeminism of the 1980s and 1990s has operated in often insidious ways. Its uniqueness lies in its clever use of the very hard-earned gains of the feminist movement against women; women’s successes are turned around as the very reasons for women’s losses .” Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 50.
[140] Vgl. ebd., S. 17.
[141] Ebd., S. 20. Faludi stellt dazu fest, dass „wer dem Feminismus vorwirft, durch ihn werde die Lebensqualität der Frauen ‚reduziert’, dem entgeht völlig die eigentliche Absicht des Feminismus, die darin besteht, den Frauen einen größeren Erfahrungsbereich zu schaffen.“ Ebd., S. 27.
[142] Ebd., S. 11.
[143] Vgl. ebd., S. 69: So wurde u.a. die Frauenbewegung für die geringe Geburtenrate verantwortlich gemacht. Vgl. auch: “Hollywood movies, popular psychology, conservative talk radio shows have found ways to turn on their head such goals as autonomy and independence that feminism struggled for, as if these gains in women’s self-reliance are responsible now for all of women’s ills, whether depression, unemployment, or teenage pregnancy.” Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 51.
[144] Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 318.
[145] Vgl. ebd., S. 108.
[146] Vgl. ebd., S. 321.
[147] Vgl. ebd., S. 326.
[148] Vgl. Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 52. Der Begriff ‘political correctness’ wurde dabei zunächst als ironische Selbstkritik verwendet, entwickelte sich aber schnell zum Stigmawort und Vorwurf für ‚überkorrekte’ Ansichten im negativen Sinne. Auf ‚political correctness’ wird weiter in Kapitel 4 eingegangen, der Begriff findet hier nur Erwähnung, da dieses Schlagwort den Übergang von der ursprünglich amerikanischen Debatte in die hier untersuchte Debatte in Deutschland markiert.
[149] Ferguson/Katrak/Miner: Feminism and Antifeminism, S. 48.
[150] Vgl. Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 89.
[151] Vgl. ebd., S. 25.
[152] Ebd., S. 88. Rhonda Hammer prägte für diese Frauen, die sich teilweise selbst als ‚feministisch’ bezeichneten, den Begriff ‚betrayal feminist’ bzw. ‚impersonator feminists’. Hammer: Antifeminism and Family Terrorism, S. 5.
[153] Faludi: Die Männer schlagen zurück, S. 107.
[154] Vgl. ebd., S. 107.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783842831834
- Dateigröße
- 839 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Medienwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (März)
- Note
- 1,0
- Produktsicherheit
- Diplom.de