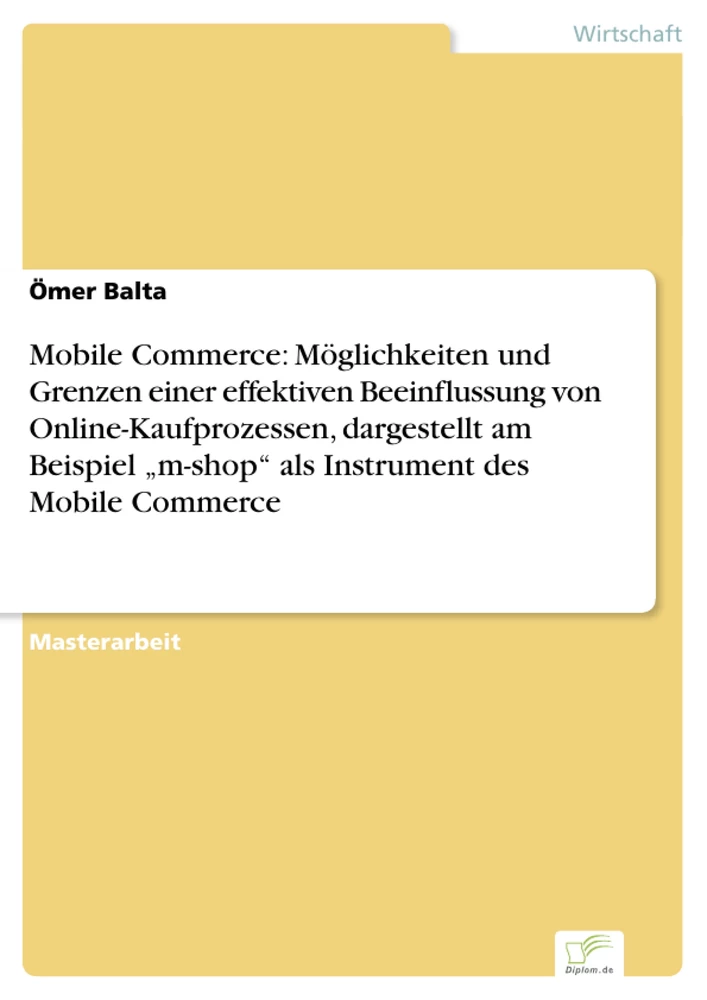Mobile Commerce: Möglichkeiten und Grenzen einer effektiven Beeinflussung von Online-Kaufprozessen, dargestellt am Beispiel „m-shop“ als Instrument des Mobile Commerce
©2013
Masterarbeit
113 Seiten
Zusammenfassung
Einleitung:
Einführung in das Thema:
Das Motto 'Kunde ist König' dominiert jedes Unternehmen und es ist grundsätzlich nicht einfach, die Könige zu erreichen bzw. anzusprechen oder sie an ein Unternehmen zu binden. Um die wünschenswerten Automatismus ermöglichen zu können, benötigen Unternehmen mehrere Verbindungswege bzw. Methoden, welche mit potenziellen Kundengruppen gekreuzt werden, die zusammengefasst als Multi-Channel-Strategien Erwähnung finden. Die Gestaltung der Multi-Channel-Strategien bildet eine gewichtige Säule des Marketing-Mix eines Unternehmens.
Innerhalb der letzten Dekade sind aufgrund einer rasanten Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie neue Vertriebskanäle, wie beispielsweise der Vertrieb mittels des Internets, entstanden. Die zunehmende Verbreitung des Internets hat eine individuelle und interaktive Kundenansprache im Massenmarkt für Unternehmen ermöglicht, um dessen Unternehmens- bzw. Markenbild noch großflächiger zu vermitteln (vgl. Bruhn, 2009, S.256f; Kuß, 2006, S.249).
Darüber hinaus findet auch ein dynamischer Prozess von Weiterentwicklungen innerhalb der Mobilfunkwelt statt, der den Einsatz mobiler Technologien sehr interessant für den Handel macht. Die Übertragung multimedialer Inhalte durch das mobile Internet eröffnet neue Wege für Unternehmen, um Produkte und Leistungen differenzierter zu vermarkten. Dadurch kommt der Mobilfunkplattform eine wachsende Bedeutung im Marketingkontext zu. Das aktuelle Thema Mobile Commerce, der Handel im Bereich mobiler Technologien, schließt neue Aufgabengebiete anhand kundenbezogener Virtualisierungsstrategien von Unternehmen mit ein. Insbesondere die Abwicklung von Geschäften über mobile Endgeräte gewinnt immer stärker an Bedeutung. Im Vergleich zum stationären Internet gewinnt aufgrund der großen Anzahl der Mobilfunkanschlüsse und der personalisierten Charakteristik der Mobileendgeräte der Wert des Mobile Commerce in Form eines neuen Kundeninteraktionskanals immer stärker an Bedeutung.
Das Potential des Mobile Commerce wird mittlerweile von vielen Wirtschaftszweigen wahrgenommen. Aber die Herausforderung eines einzelnen Unternehmens liegt darin, im harten Konkurrenzkampf die Konsumenten adäquat bedienen zu können, um den entscheidenden Vorsprung gegenüber Konkurrenten zu sammeln. [...]
Einführung in das Thema:
Das Motto 'Kunde ist König' dominiert jedes Unternehmen und es ist grundsätzlich nicht einfach, die Könige zu erreichen bzw. anzusprechen oder sie an ein Unternehmen zu binden. Um die wünschenswerten Automatismus ermöglichen zu können, benötigen Unternehmen mehrere Verbindungswege bzw. Methoden, welche mit potenziellen Kundengruppen gekreuzt werden, die zusammengefasst als Multi-Channel-Strategien Erwähnung finden. Die Gestaltung der Multi-Channel-Strategien bildet eine gewichtige Säule des Marketing-Mix eines Unternehmens.
Innerhalb der letzten Dekade sind aufgrund einer rasanten Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie neue Vertriebskanäle, wie beispielsweise der Vertrieb mittels des Internets, entstanden. Die zunehmende Verbreitung des Internets hat eine individuelle und interaktive Kundenansprache im Massenmarkt für Unternehmen ermöglicht, um dessen Unternehmens- bzw. Markenbild noch großflächiger zu vermitteln (vgl. Bruhn, 2009, S.256f; Kuß, 2006, S.249).
Darüber hinaus findet auch ein dynamischer Prozess von Weiterentwicklungen innerhalb der Mobilfunkwelt statt, der den Einsatz mobiler Technologien sehr interessant für den Handel macht. Die Übertragung multimedialer Inhalte durch das mobile Internet eröffnet neue Wege für Unternehmen, um Produkte und Leistungen differenzierter zu vermarkten. Dadurch kommt der Mobilfunkplattform eine wachsende Bedeutung im Marketingkontext zu. Das aktuelle Thema Mobile Commerce, der Handel im Bereich mobiler Technologien, schließt neue Aufgabengebiete anhand kundenbezogener Virtualisierungsstrategien von Unternehmen mit ein. Insbesondere die Abwicklung von Geschäften über mobile Endgeräte gewinnt immer stärker an Bedeutung. Im Vergleich zum stationären Internet gewinnt aufgrund der großen Anzahl der Mobilfunkanschlüsse und der personalisierten Charakteristik der Mobileendgeräte der Wert des Mobile Commerce in Form eines neuen Kundeninteraktionskanals immer stärker an Bedeutung.
Das Potential des Mobile Commerce wird mittlerweile von vielen Wirtschaftszweigen wahrgenommen. Aber die Herausforderung eines einzelnen Unternehmens liegt darin, im harten Konkurrenzkampf die Konsumenten adäquat bedienen zu können, um den entscheidenden Vorsprung gegenüber Konkurrenten zu sammeln. [...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Balta, Ömer: Mobile Commerce: Möglichkeiten und Grenzen einer effektiven
Beeinflussung von Online-Kaufprozessen, dargestellt am Beispiel ,,m-shop" als
Instrument des Mobile Commerce, Hamburg, Diplomica Verlag GmbH 2013
PDF-eBook-ISBN: 978-3-8428-3325-8
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2013
Zugl. Hochschule Bremen, Bremen, Deutschland, Masterarbeit, Februar 2013
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2013
Printed in Germany
Danksagung
Die vorliegende Arbeit bildet den Abschluss meiner Ausbildung im
Masterstudiengang ,,International Studies in Economics and Business
Administration" an der Hochschule Bremen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die durch ihre persönliche
und fachliche Unterstützung zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.
In erste Linie möchte ich mich bei meinen Eltern sowie meiner Cousin Levent
Veda Isik für die Unterstützung während meines gesamten Studiums bedanken.
Herrn Diplom-Ökonom Detlev Kühl danke ich für die Aufgabenstellung und die
Betreuung dieser Arbeit. Mein Dank gilt auch aufseiten der Hochschule Bremen
Herrn Prof. Dr. Wilfried Teichert für weiterführende Ideen und motivierende
Gespräche.
Abschließend möchte ich noch meinen Freunden für deren Geduld, Korrekturen
und Formulierungsvorschlägen meinen Dank aussprechen.
~ I ~
Inhaltsverzeichnis
I.
Einleitung
_________________________________________________________ 1
1
Einführung in das Thema ________________________________________________ 1
2
Problemstellung und Zielsetzung _________________________________________ 2
3
Abgrenzung ____________________________________________________________ 3
4
Aufbau der Arbeit ______________________________________________________ 3
II.
Theoretische Ansätze
______________________________________________ 6
1
Marketing ______________________________________________________________ 7
1.1 Product ________________________________________________________________________ 9
1.2 Price _________________________________________________________________________ 11
1.3 Place _________________________________________________________________________ 11
1.4 Promotion _____________________________________________________________________ 14
2
Mobile Commerce _____________________________________________________ 16
3
Kaufverhalten _________________________________________________________ 21
3.1 Erklärungsmodell von Howard und Sheth _________________________________________ 23
3.2 Formen der Kaufentscheidung ___________________________________________________ 25
4
Die Rolle des Mobile Commerce im Kaufverhalten ________________________ 28
4.1 Anreize durch mobile Internet-Online Werbeformen _______________________________ 29
4.2 Informationssuchverhalten und ,,m-shop" ________________________________________ 31
4.2.1 Symbolische und soziale Informationen ______________________________________ 31
4.2.2 Struktur des Informationssuchverhaltens _____________________________________ 34
4.3 Sicherheitsbedenken ___________________________________________________________ 36
4.4 Struktur der Kaufentscheidungen ________________________________________________ 37
4.5 Hypothesen ___________________________________________________________________ 38
4.5.1 Ausgangshypothese A: Steuerveranlagung unterschiedlicher Produkte im Mobile
Commerce _____________________________________________________________________ 38
4.5.2 Ausgangshypothese B: Wirksamkeit von unterschiedlichen Werbeformen ________ 39
4.5.3 Ausgangshypothese C: Schnittstellen für eine Anbindung an den ,,m-shop" ______ 40
4.5.4 Ausgangshypothese D: Wichtige Informationsvariablen (Konstante) bei der
Informationssuche von Konsumenten ______________________________________________ 41
4.5.5 Ausgangshypothese E: Bevorzugte Zahlungsmethoden _________________________ 42
4.5.6 Ausgangshypothese F: Zusammenhänge zwischen soziodemographischen
Parametern und erarbeiteten theoretischen Kategorien _____________________________ 43
~ II ~
4.6 Ableitung der Fragen aus den Hypothesen ________________________________________ 44
III.
Praxisansatz
______________________________________________________ 46
1
Erstellung des Untersuchungskonzepts __________________________________ 47
1.1 Untersuchungsziele ____________________________________________________________ 47
1.2 Methode der Datenerhebung ____________________________________________________ 47
1.3 Untersuchungsdesign ___________________________________________________________ 49
1.3.1 Fragebogen und Fragemethodik _____________________________________________ 49
1.3.2. Umfrageinstrument Online-Befragung _______________________________________ 51
1.4 Eingrenzung des Untersuchungsfeldes ____________________________________________ 52
1.4.1 Stichprobenziehung ________________________________________________________ 52
1.4.2. Erhebungszeitraum ________________________________________________________ 54
Fragebogen _____________________________________________________________________ 57
2
Umsetzung der Untersuchung __________________________________________ 59
2.1 Testphase _____________________________________________________________________ 59
2.2 Veröffentlichung der Umfrage ___________________________________________________ 59
3
Auswertung der Untersuchung __________________________________________ 60
3.1 Methoden der Datenanalyse _____________________________________________________ 60
3.1.1
Datenbereinigung ________________________________________________________ 60
3.1.2
Gruppierung der Daten in offenen Antwortmöglichkeiten ____________________ 62
3.1.3
Computergeschützte Kodierung der Daten __________________________________ 63
3.2
Empirische Befunde ___________________________________________________________ 65
3.2.1 Zeitstempel _______________________________________________________________ 65
3.2.2 Charakterisierung der Beispiele _____________________________________________ 66
3.2.3 Das Kaufverhalten _________________________________________________________ 70
4
Hypothesen vs. Befunde _______________________________________________ 85
5
Kritischer Rückblick ___________________________________________________ 90
IV.
Handlungsempfehlungen
_________________________________________ 92
1
Produktpolitik _________________________________________________________ 93
2
Preispolitik ___________________________________________________________ 94
3
Kommunikationspolitik _________________________________________________ 95
4
Distributionspolitik ____________________________________________________ 97
5
Fazit _________________________________________________________________ 98
V.
Zusammenfassung
_________________________________________________ 99
VI.
Literaturverzeichnis
____________________________________________ 101
~ III ~
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematischer Ablauf der Arbeit __________________________________ 4
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Ablaufs des Theorieteils _______________ 6
Abbildung 3: Schnittmenge von Electronic Business und Mobile Business und Electronic
Commerce und Mobile Commerce. ____________________________________________ 19
Abbildung 4: Erklärungsmodell des Konsumentenverhaltens von Howard und Sheth __ 23
Abbildung 5: Einflussfaktoren anhand der Art von Kaufentscheidungen _____________ 26
Abbildung 6: Schematische Darstellung der Ablauf des Praxisteils ________________ 46
Abbildung 7: Verteilung der Teilnahme nach Datum & Uhrzeit ___________________ 65
Abbildung 8: Verteilung von Geschlecht und Alter _____________________________ 66
Abbildung 9: Mobile Endgerätart ____________________________________________ 67
Abbildung 10: Mobile Endgeräteart-Verteilung nach Geschlecht ___________________ 68
Abbildung 11: Rufen Sie Produktinformationen von Ihrem mobilen Endgerät auf? ___ 68
Abbildung 12: Wie oft rufen Sie Produktinformationen ab? ______________________ 69
Abbildung 13: Produktkategorien ____________________________________________ 71
Abbildung 14: Verteilung der Produktkategorien nach Geschlecht ________________ 71
Abbildung 15: Verteilung der Produktkategorien nach Einkaufsverhalten __________ 72
Abbildung 16: Werbeformen ________________________________________________ 72
Abbildung 17: Verteilung der Werbeformen nach Geschlecht ____________________ 73
Abbildung 18: Verteilung der Werbeformen nach Produktkategorien ______________ 74
Abbildung 19: Produkt Vergleichsmethoden ___________________________________ 75
Abbildung 20: Produkt Vergleichsmethoden-Verteilung nach Geschlecht ___________ 76
Abbildung 21: On- und Offline-Produktvergleichsmethoden _____________________ 77
Abbildung 22: Suchmaschine- Nennungen _____________________________________ 77
Abbildung 23: Produktvergleichsseiten-Nennungen _____________________________ 78
Abbildung 24: Wegweisende Informationen bei der Produktauswahl ______________ 79
Abbildung 25: Wegweisende Informationen bei Produktauswahl-Verteilung nach
Geschlecht _______________________________________________________________ 80
~ IV ~
Abbildung 26: Wegweisende Informationen bei der Produktauswahl- Verteilung nach
Produktkategorien ________________________________________________________ 81
Abbildung 27: Online-Produktdarstellungsformen ______________________________ 81
Abbildung 28: Online-Produktdarstellungsformen-Verteilung nach Geschlecht ______ 82
Abbildung 29: Online-Produktdarstellungsformen-Verteilung nach Produktkategorien 83
Abbildung 30: Bevorzugte Zahlungsarten _____________________________________ 83
Abbildung 31: Bevorzugte Zahlungsarten _____________________________________ 84
Abbildung 32: Bevorzugte Zahlungsarten-Verteilung nach Produktkategorien ______ 85
~ V ~
Tabellensverzeichnis
Tabelle 1: Marketing-Mix _____________________________________________________ 9
Tabelle 2: Klassifikation von B2C Services im Mobile Commerce. _________________ 20
Tabelle 3: Fragenkatalog ____________________________________________________ 45
Tabelle 4: Konzept der Onlinebefragung ______________________________________ 56
Tabelle 5: Code-Plan ______________________________________________________ 64
Tabelle 6: Einbettung in Marketing-Mix ______________________________________ 98
~ VI ~
Abkürzungsverzeichnis
3D: dreidimensional
App: Applikation
AusgH.: Ausgang Hypothese
B2C: Business-to-Consumer-Markt
Bsp.: Beispiel
BVDW: Bundesverband Digitale
Wirtschaft
Bzw. : Beziehungsweise
CD: Compact Disc
DVD: Digital Video Disc
e.V.: eingetragener Verein
E-Business: Electronic Business
E-Commerce: Electronic Commerce
E-Coupon: Electronic Coupon
E-Mail: Electronic Mail
Etc. : et cetera
f.: und folgende Seite
ff.: die folgenden Seiten
IMC: Integrated Marketing
Communications
M- Commerce: Mobile Commerce
M-Business: Mobile Business
m-shop : Mobile Onlineshop
N: Anzahl
NebenH.: Neben Hypothese
PC.: Personal Computer
S.: Seite
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
S-O-R : Stimulus Organismus
Reaktion
SR Modell: Stimulus Reaktion
vgl.: vergleich
z.B.: zum Beispiel
E i n l e i t u n g
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|1
I.
E
INLEITUNG
1 Einführung in das Thema
Das Motto ,,Kunde ist König" dominiert jedes Unternehmen und es ist grundsätzlich
nicht einfach, die Könige zu erreichen bzw. anzusprechen oder sie an ein
Unternehmen zu binden. Um die wünschenswerten Automatismus ermöglichen zu
können, benötigen Unternehmen mehrere Verbindungswege bzw. Methoden, welche
mit potenziellen Kundengruppen gekreuzt werden, die zusammengefasst als Multi-
Channel-Strategien Erwähnung finden. Die Gestaltung der Multi-Channel-Strategien
bildet eine gewichtige Säule des Marketing-Mix eines Unternehmens.
Innerhalb der letzten Dekade sind aufgrund einer rasanten Entwicklung im Bereich
der Informations- und Kommunikationstechnologie neue Vertriebskanäle, wie
beispielsweise der Vertrieb mittels des Internets, entstanden. Die zunehmende
Verbreitung des Internets hat eine individuelle und interaktive Kundenansprache im
Massenmarkt für Unternehmen ermöglicht, um dessen Unternehmens- bzw.
Markenbild noch großflächiger zu vermitteln (vgl. Bruhn, 2009, S.256f; Kuß, 2006,
S.249).
Darüber hinaus findet auch ein dynamischer Prozess von Weiterentwicklungen
innerhalb der Mobilfunkwelt statt, der den Einsatz mobiler Technologien sehr
interessant für den Handel macht. Die Übertragung multimedialer Inhalte durch das
mobile Internet eröffnet neue Wege für Unternehmen, um Produkte und Leistungen
differenzierter zu vermarkten. Dadurch kommt der Mobilfunkplattform eine
wachsende Bedeutung im Marketingkontext zu. Das aktuelle Thema Mobile
Commerce, der Handel im Bereich mobiler Technologien, schließt neue
Aufgabengebiete anhand kundenbezogener Virtualisierungsstrategien von
Unternehmen mit ein. Insbesondere die Abwicklung von Geschäften über mobile
Endgeräte gewinnt immer stärker an Bedeutung. Im Vergleich zum stationären
Internet gewinnt aufgrund der großen Anzahl der Mobilfunkanschlüsse und der
personalisierten Charakteristik der Mobileendgeräte der Wert des Mobile Commerce
in Form eines neuen Kundeninteraktionskanals immer stärker an Bedeutung.
Das Potential des Mobile Commerce wird mittlerweile von vielen
Wirtschaftszweigen wahrgenommen. Aber die Herausforderung eines einzelnen
E i n l e i t u n g
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|2
Unternehmens liegt darin, im harten Konkurrenzkampf die Konsumenten adäquat
bedienen zu können, um den entscheidenden Vorsprung gegenüber Konkurrenten
zu sammeln.
Dafür sollten Unternehmen die aktuellen Bedürfnisse, Situationen
und Erwartungen der Konsumenten verstehen und darüber hinaus sich gezielt mit
stark verändernden Marktanforderungen auseinandersetzen.
2 Problemstellung und Zielsetzung
Aufgrund dessen soll zunächst die Rolle des Mobile Commerce aus
Konsumentenansicht übergeprüft werden und die tatsächlichen Potentiale des
Handels über mobile Endgeräte in Deutschland untersucht werden. Anhand der
ausgeführten Erkenntnisse und Entwicklungen stellt sich die Grundfrage:
x Wie kann das Onlineshopping über das mobile Endgerät in Deutschland
zukünftige Kaufprozesse beeinflussen bzw. ändern?
Diese Grundfrage führt zum Ausgangspunkt der Abschlussarbeit. Um an diesem
Grundgerüst arbeiten zu können, werden folgende Überlegungen hinsichtlich der
Grundfrage verknüpft:
x Welche Faktoren entscheiden über eine erfolgreiche Gestaltung eines
Onlineshops für mobile Endgeräte?
x Mit welchen Problemen sieht sich ein Onlineshop für mobile Endgeräte
aus Sicht der Kunden konfrontiert?
Um die oben vorliegenden Fragen beantworten zu können, wird das Ziel
innerhalb dieser Arbeit anhand der Identifikation von Erfolgsfaktoren und
möglichen Barrieren eines Mobil-Online-Vertriebs gerichtet. Anhand dessen
sollen die wichtigsten Aspekte eines Onlineshops für Mobile Commerce mithilfe
von marketingorientierten Ansätzen untersucht werden. Die Arbeit wird
grundlegende Informationen über das Konsumentenverhalten liefern, welche
zum einen die Bedeutung des Zusammenspiels einzelner Faktoren im
Kaufverhalten verdeutlichen wird und zum anderen die Entscheidungsfindung bei
der Gestaltung eines Onlineshops unterstützen soll.
E i n l e i t u n g
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|3
3 Abgrenzung
Das Thema Mobile Commerce stellt ein sehr umfangreiches und komplexes
Gebiet dar. Daher wird eine klare Abgrenzung innerhalb des Themengebiets
benötigt. In der vorliegenden Arbeit wird der Vertrieb von Konsumgütern über
Mobil-Onlineshop fokussiert. Der Ansatz beschränkt sich auf den Business-to-
Consumer Bereich, nicht aber auf ein bestimmtes Gebiet bzw. Branche. Die
Themenfelder hinsichtlich Infrastruktur der Mobilfunknetze, Netzbetreiber oder
Funktionalität der mobilen Endgeräte wird nicht behandelt. In der Arbeit werden
weder technische Ausführungen erläutert noch neue Standards definiert.
Ebenfalls werden keine Erläuterungen über finanzielle Leistungen angegeben.
Das Gesamtbild dieser Arbeit soll als grundlegende Informationsmöglichkeit für
Unternehmen dienen, die eine Einführung eines Onlineshops im Mobile
Commerce planen oder eine Optimierung ihrer bisherigen Onlineshops für mobile
Endgeräte anstreben. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird Mobil-Onlineshop
als ,,m-shop" bezeichnet, um Komplikationen bzw. Verwirrungen zu vermeiden.
4 Aufbau der Arbeit
Um die angeführten Vorhaben umsetzen zu können sowie ein umfassendes Bild
darzustellen, müssen verschiedene wissenschaftliche Disziplinen in der
vorliegenden Arbeit berücksichtigt werden. Daher erstreckt sich diese
Ausarbeitung insgesamt auf fünf Kapitel, welche in Einleitung, Theoretische
Ansätze, Praxisansatz, Handlungsempfehlungen und Zusammenfassung unterteilt
wurde. Nach der Einführung in das Thema werden relevante Begrifflichkeiten in
die nächsten Kapitel aus verschiedenen Blinkwickeln und in vier Abschnitten
einzeln betrachtet.
Im ersten Abschnitt des theoretischen Ansatzes wird dem Lesenden zunächst ein
grundsätzlicher Überblick über das Marketing vermittelt, um anschließend mit
dem Thema Mobile Commerce anzuknüpfen. Der zweite Abschnitt beschäftigt
sich mit begrifflichen Grundlagen des Electronic und Mobile Commerce, wobei
die unterschiedlichsten Bereiche behandelt werden. Im dritten Teil werden
Kaufverhalten sowie Kaufentscheidungsformen eruiert. Dazu werden
unterschiedliche Einflussgrößen auf das Kaufverhalten des Konsumenten mithilfe
E i n l e i t u n g
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|4
eines Verhaltensmodells näher betrachtet. Im letzten Teil der theoretischen
Ansätze wird eine mögliche Rolle des Mobile Commerce anhand des
Konsumentenverhaltens erörtert und daraus Hypothesen abgeleitet. Diese
werden auf Fragen operationalisiert und innerhalb eines Fragenkataloges
zusammengefasst.
Mit Kapitel 3 beginnt der zweite Teil der Arbeit, der vor allen Dingen der
empirischen Untersuchung gewidmet wird. Die Praxisteil befasst sich mit der
Konzipierung, Durchführung und Auswertung der Online-Umfrage. Dabei werden
zunächst die Methode der Datengewinnung, das Untersuchungsdesign, die
Erhebungsinstrumente, der Untersuchungsablauf sowie die
Abbildung 1: Schematischer Ablauf der Arbeit (Quelle: eigene Darstellung)
Forschungsproblem
Theorie Ansatz
x Marketing
x Mobile Commerce
x Konsumentenverhalten
x Gegenstandsbenennung
o Hypothesen
o Forschungsfragen
Schlussfolgerungen
Praxis Ansatz
x Erstellung des Untersuchungs-
konzepts
x Umsetzung der Untersuchung
x Auswertung und Darstellung der
Ergebnisse
x Hypothesen vs. Befunde
x Kritische Rückblick
E i n l e i t u n g
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|5
Auswertungsstrategien näher erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse der
Untersuchung dargestellt und mit Hypothesen verglichen. Als letztes soll ein
kritischer Rückblick auf die gesamte Untersuchung geworfen werden.
Das vierte Kapitel dient als Diskussions-Etappe der Arbeit, wobei zunächst die
Schlussfolgerungen auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse erläutert werden, die
wiederum Handlungsempfehlungen für eine Gestaltung des Konzepts eines
Onlineshops für mobile Endgeräte liefern sollen. Anschließend wird eine
theoretische Einordnung der wesentlichen Erkenntnisse vorgenommen sowie
methodisch kritische Aspekte diskutieren.
Innerhalb des Kapitels fünf werden die Literaturquellen aufgeführt, um
abschließend die vollständigen Erhebungsinstrumente im Anhang vorzustellen.
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|6
II.
T
HEORETISCHE
A
NSÄTZE
Zur Sicherung des allgemeinen Verständnisses wird im folgenden Kapitel ein
genereller Überblick über zentrale Begrifflichkeiten sowie relevante
Grundlagenliteratur der Arbeit gegeben. Innerhalb dieses Abschnittes werden die
Grundlagen in zunächst drei Teilbereichen vorgestellt und die Rolle des Mobile
Commerce anhand des Kaufverhaltens im letzten Abschnitt erfragt.
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Ablaufs des Theorieteils (Quelle: eigene Darstellung)
· Begrifflichkeiten
· Abgrenzung des Themas M- Commerce
· Marketing-Mix
· Produktpolitik
· Preispolitik
· Kommunikationspolitik
· Distributionspolitik
· Einführung in das Thema
· Erklärungsmodell von Howard und Sheth
· Formen der Kaufentscheidung
· Anreiz durch Online-Werbeformen
· Online Informationssuchverhalten
· Symbolische und soziale Informationen
· Sicherheitsbedanken
· Hypothesen
· Fragenkatalog
Marketing
M-Commerce
Kaufverhalten
Rolle des Mobile
Commerce im
Kaufverhalten
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|7
In den folgenden Abschnitten werden die Begrifflichkeiten Marketing, Marketing-
Mix sowie deren Instrumente erläutert. Im zweiten Teilaspekt wird auf das
Thema Mobile Commerce eingegangen. Nachfolgend wird das Kaufverhalten
innerhalb des dritten Abschnitts definiert und ein Erklärungsmodell sowie die
Formen der Kaufentscheidung vorgestellt. Im letzten Abschnitt werden Themen
wie Online-Werbeformen, -Informationssuchverhalten, symbolische sowie
soziale Informationen, Sicherheitsbedanken und Struktur der
Kaufentscheidungen behandelt. Aus diesen Themen werden Hypothesen
abgeleitet und anhand der Erstellung eines Fragenkatalogs das Kapitel
abgeschlossen.
1 Marketing
Der Begriff Marketing entstand ursprünglich im englischsprachigen Raum. Um das
Jahr 1910 entwickelte sich das Wort ,,Marketing" (Englisch: to market = kaufen
oder verkaufen) in den USA zu einem Schlagwort für die Absatzwirtschaft bzw.
die systematische Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen (vgl.
Schneider/Kornmeier, 2007, S.2).
Die ursprüngliche Bedeutung des Marketingbegriffes hat sich parallel der
Weiterentwicklung innerhalb der Gesellschaft und im Markt von einer
betrieblichen Funktion zu einem Leitkonzept der Unternehmensführung
entwickelt, welches eine konsequente Ausrichtung des gesamten
unternehmerischen Denkens und Handelns hinsichtlich der Bedürfnisse des
Marktes steuern soll. Dieses umfasst die marktorientierten Aktivitäten eines
Unternehmens, die zwischen Lieferanten, Wettbewerbern, Absatzmittlern und
Konsumenten
existieren, um eine kontinuierliche Befriedigung der
Konsumentenbedürfnisse und Verwirklichung der Unternehmensziele zu
verfolgen (vgl. Wirtz, 2008 S.14; Bruhn, 2007, S.13).
Der Begriff Marketing wird in der Literatur konträr diskutiert. In folgenden
Zitaten wird Marketing von Kotler und Bliemel als ein allgemeines soziales
Phänomen betrachtet. Dagegen wird es laut Bruhn als ein Managementprozess
dargestellt.
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|8
,,Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den
Einzelpersonen und Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche
befriedigen, indem sie Produkte und andere Dinge von Wert erzeugen,
anbieten und miteinander austauschen." (Kotler & Bliemel, 2001 S.12)
,,Marketing ist eine unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert
sich in der Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher
interner und externer Unternehmensaktivitäten, die durch eine
Ausrichtung der Unternehmensleistungen am Kundennutzen im Sinne
einer konsequenten Kundenorientierung darauf abzielen,
absatzmarktorientierte Unternehmensziele zu erreichen." (Bruhn, 2009,
S.14)
Marketing als Managementprozess umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten. Meffert,
Burmann und Kirchgeorg unterteilen die Aufgaben des Marketingmanagement in
fünf Bereiche. ,,(1) Analyse, (2) Strategische Marketingplanung, (3) Operative
Marketingplanung, (4) Realisation, (5) Erfassung und Rückkopplung der
Erfolgswirkungen. Die Teilgebiete 1 bis 3 stellen die Elemente einer
Marketingkonzeption dar" (vgl. Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2008 S.21).
Um ein umfassendes Marketingkonzept aufzubauen, wird zunächst die
Ausgangslage der Unternehmen anhand einer Situationsanalyse untersucht sowie
die markt- und gesellschaftlichen Entwicklungen prognostiziert (1. Analyse). In
einem nächsten Schritt werden langfristige Marketingziele festgelegt, durch die
das Unternehmen künftige Entwicklungen erreichen soll. Darauf aufbauend
werden Marketingstrategien abgeleitet (strategische Marketingplanung), welche
durch Festlegung entsprechender marketingpolitischer Instrumente und deren
Einsatz konkretisiert werden (operative Marketingplanung). Die Gesamtheit der
einzelnen Marketinginstrumente wird als Marketing-Mix bezeichnet (vgl. Meffert,
Burmann, & Kirchgeorg, 2008 S.21).
Der Marketing-Mix stellt eine übersichtliche Systematik aller operativen
Marketing-Instrumente dar, ,,die Aktions- und Entscheidungsgrößen umfassen,
mit denen ein Unternehmen den Markt bearbeitet" (vgl. Kleinhückelskoten &
Helm, 2000 S.29). Dabei handelt es sich um eine Realisierung von
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|9
Marketingstrategien durch Einsatz einer gut aufeinander abgestimmten
Kombination von marketingpolitischen Instrumenten, welche einen wesentlichen
Einfluss auf den Erfolg des Unternehmenszieles haben (vgl. Bruhn, 2009, S.27f).
Die Einteilung des Marketing-Instrumentariums von E. Jerome McCarthy in vier
Bereiche, die sogenannten ,,4 P's", wurde zur klassischen Definition des
Marketing-Mixes sowohl in der Literatur als auch in der Praxis, wie im Folgenden
dargestellt (vgl. Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2008 S.22; Bruhn, 2009, S.27f):
P
roduct Produktpolitik
Marketing- Mix
Produkt-Submix
P
rice Preispolitik
Kontrahierungs-
Submix
P
lace - Distributionspolitik
Distributions-Submix
P
romotion -
Kommunikationspolitik
Kommunikations-
Submix
Tabelle 1: Marketing-Mix (eigene Darstellung in Anlehnung an Kleinhückelskoten & Helm 2000)
Die Elemente des Marketing-Mix dürfen nicht voneinander isoliert betrachtet
werden, da sie in engem Zusammenhang zueinander stehen. Die Kombination der
einzelnen Instrumente ist maßgeblich für den Erfolg eines Marketingkonzepts
(vgl. Kleinhückelskoten & Helm, 2000 S.29f).
1.1 P
roduct
Produktpolitik umfasst ein konkretes Leistungsangebot eines Unternehmens,
welches aus Produkten und/oder Dienstleitungen besteht. Produktpolitik wird
daher auch als Angebots- oder Leistungspolitik bezeichnet. Das Ziel der
Produktpolitik besteht darin, die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten zu
befriedigen (vgl. Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2008, S.398f; Bruhn, 2009,
S.123). Die Produktpolitik bildet ein grundlegendes Instrument des Marketing-Mix
und spielt eine zentrale Rolle im Rahmen des operativen
Marketingmanagements. Sie umfasst alle Entscheidungen über das Sortiment,
das Leistungsprogramm, dessen Ausstattungsmerkmale und Eigenschaften, wie z.
B. Inhalt, Gestaltung, Markenimage und Art der Gewährleistung. Die Aufgabe der
Einsatz
der
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|10
Produktpolitik besteht darin, die Produkte bzw. Dienstleistungen eines
Unternehmens zu prägen und dabei intensiv auf Kundenbedürfnisse und deren
Wünsche einzugehen. Aus Sichtweise des Marketings sollte die Produktpolitik
nicht nur als technische, sondern auch als marktbezogene Aufgabe verstanden
werden (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 2008 S.397ff).
Die Produktpolitik umfasst ein äußerst umfangreiches Entscheidungspektrum.
Diese Entscheidungsbereiche können aus Marketingperspektive auf drei Ebenen
abgegrenzt werden: Produkt, Produktlinie und Produktprogramm (vgl. Bruhn,
2009 S.126).
Auf der Ebene des Produktes wird der Begriff Produkt hinsichtlich der
Nutzenelemente diskutiert. Nach dem Modell von Kotler & Bliemel werden die
Nutzenelemente eines Produktes in drei Rangstufen eingegliedert: Auf der ersten
Stufe befindet sich der Kernnutzen bzw. die Grundleistung des Produkts. Die
zweite Stufe umfasst die Eigenschaften, die Qualität, den Markennamen, die
Verpackung und das Styling des Produkts. Das erweiterte Produkt bildet die
dritte Stufe dieses Modells und beinhaltet zusätzliche Serviceaufgaben wie
Garantieleistungen, After-Sales-Service, Installation und kostenlose Lieferung
(vgl. Kotler & Bliemel, 2001 S.716ff).
Eine Produktlinie besteht aus einem Zusammenschluss von Produkten, ,,die auf
Grund bestimmter Kriterien wie z. B. Bedarfs- oder Produktionszusammenhang
in enger Beziehung zueinander stehen" (Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2008,
S.401). Dabei finden Entscheidungen über Erweiterung der Produktlinie durch
Einführung neuer Produkte oder Eliminierung bestimmter Produkte aus der
vorhandenen Produktlinie statt (vgl. Bruhn, 2009, S.126). Jede Produktlinie
besitzt ein Marktprofil, bei dem der Fokus oft auf der Erstellung eines
gemeinsamen Marketingkonzeptes liegt (vgl. Kotler, 2003, S.413f).
Das Produktprogramm umfasst die Gesamtheit aller Produkte und Produktlinien
eines Unternehmens und wird oft auch als Sortiment bezeichnet. Darüber hinaus
wird hinsichtlich der Breite (Anzahl der Produktlinien) und Tiefe (Anzahl der
Produkte in einer Produktlinie) strukturiert (vgl. Meffert, Burmann, &
Kirchgeorg, 2008, S.402).
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|11
1.2 Price
Preispolitik umfasst sämtliche Maßnahmen eines Entgeltprozesses hinsichtlich
verbindlicher Vereinbarungen eines Unternehmens gegenüber seinem Kunden,
welche den monetären Gegenwert einer Leistung sowie dessen
Zahlungsrahmenbedingungen darstellen soll (vgl. Bruhn, 2009, S.165). Die
Bestimmung eines optimalen Preises für ein Produkt/ eine Dienstleistung basiert
auf dem Verlangen eines Unternehmens, den bestmöglichen Gewinn unter
Berücksichtigung des aktuellen und potenziellen Wettbewerbs, der sich auch auf
dem Markt durchsetzt, zu erzielen (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 2008,
S.478f). Der Preis kommuniziert ferner den beabsichtigten Qualitätsmaßstab
eines Produktes/ einer Dienstleistung im Markt, welcher ein bedeutendes
Kriterium für die Kaufentscheidung eines Konsumenten darstellt (vgl. Kotler,
2003, S.470).
Preispolitik wird laut Bruhn auch als Kontrahierungspolitik betrachtet, da sie das
zentrale Element der Kontrahierungspolitik darstellt. Darunter fallen sämtliche
vertraglichen Konditionen, die im Zusammenhang mit einem Produkt stehen.
Derlei Konditionen können beispielsweise Rabatte, Kredite, Boni, Skonti sowie
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sein (vgl. Bruhn, 2009 S.165f). Sie spielen
eine weitere bedeutende Rolle in der Einflussnahme innerhalb des
Konsumentenverhaltens (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 2008, S.478f).
In die preispolitischen Entscheidungen fließen verschiedene Faktoren ein, welche
zur Preisbildung separat betrachtet werden müssen. Diese umfassen die
Kostenstruktur der Unternehmen, die Preisbereitschaft der Nachfrager, die
Zielsetzungen der Unternehmen sowie das Wettbewerbsverhalten (vgl. Meffert,
Burmann, & Kirchgeorg, 2008, S.485; Bruhn, 2009, S.170). Die
Konkurrenzsituation wird wiederum durch Merkmale des Marktes bzw. der
Marktform geprägt (vgl. Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2008, S.502f).
1.3 Place
Distributionspolitik
bildet eine absatzseitige Marketingaktivität eines
Unternehmens, die in der Literatur auch als Vertriebspolitik bezeichnet wird. Sie
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|12
koordiniert alle Maßnahmen, welche eine effektive und effiziente Übertragung
der Unternehmensleistung an den Nachfrager ermöglicht. Hierbei sollen
Entscheidungen in Bezug auf die optimale Lieferung des Produktes vom
Unternehmen zum Käufer getroffen werden (vgl. Kuß 2006, S.243).
In der entscheidungsorientierten Auffassung wird die Distributionspolitik als
,,Competence Based View und Market Based View von Meffert, Burmann und
Kirchgeorg betrachtet. Competence Based View orientiert sich am effektiven
und effizienten Einsatz der verfügbaren Ressourcen bei der Erstellung der
Distributionsleistung. Dagegen stellt Market Based View den Einsatz eines
Absatzkanals dar, der den Wünschen und Bedürfnissen der anvisierten
Zielgruppe am besten entspricht" (Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2008,
S.560).
Zunächst können die Aufgabenbereiche der Vertriebspolitik in zwei
zweckgerechte Subsysteme in Form einer logistischen und akquisitorischen
Distribution aufgeteilt werden. Die logistische Distribution zielt darauf ab, die
physische Bereitstellung der Unternehmensleistung für Abnehmer an den
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, im richtigen Zustand und in der richtigen Menge
mit möglichst geringeren Kosten sicherzustellen. Darunter fallen entsprechend
Themen wie z. B. Transport, Lagerhaltung, Kunden- und Lieferdienst. Die
akquisitorische Distribution umfasst dagegen Maßnahmen zur Gestaltung der
Absatzwege/Absatzkanäle und deren Umsetzungsprozesse - die Anbahnung,
Kundengewinnung und den Abschluss von Transaktionen (vgl. Bruhn, 2009,
S.246,272; Schneider, 2007, S.143ff; Wirtz, 2008, S.15).
Hinsichtlich der akquisitorischen Aspekte bzw. des Absatzkanalmanagements
nach Meffert, Burmann und Kirchgeorg handelt es sich um eine Entscheidung
bzgl. einer Ausgestaltungsform der Bereitstellung (direkter und indirekter
Vertrieb) von Unternehmensleistungen. Wenn Transaktion unmittelbar zwischen
Hersteller und Abhnehmer ohne in Anspruchnahme eines Absatzmittlers
stattfinden, wird dieses als direkter Vertrieb bezeichnet. Dagegen bezeichnet
der indirekte Vertrieb Transaktionen, bei denen zwischengeschaltete
Absatzhelfer eine Vielzahl von Distributionsaufgaben übernehmen (vgl. Meffert,
Burmann, & Kirchgeorg, 2008, S.560). Dafür wird ein Vertriebssystem aufgebaut,
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|13
welches aus unternehmensinternen und externen Absatzsorganen besteht. Die
Auswahl und Kombination der Absatzorgane stellen die Vertriebswege eines
Unternehmens dar (vgl. Homburg & Krohmer, 2006, S.266f).
Jeder Vertriebsweg der Distributionskette übernimmt verschiedene
wertschöpfende Funktionen, um eine Unternehmensleistung für die Abnehmer
bereitzustellen (vgl. Homburg & Krohmer, 2006, S.266f). Die Funktionen der
Distrubtionpolitik mit dem Ziel einer kontunierlichen Marktpräzenz der
Unternehmensleistung nach Kotler werden wie folgt angegeben:
x Informationsfunktion:
o Aus Unternehmensicht: über Kunden, Wettbewerber und andere
Akteure
o Aus Abnehmersicht: über Produkte und Konditionen
x Kommunikationsfunktion: Kontaktaufnahme mit Endabnehmern
x Neogationsfunktion
x Logistische Funktion: physische Steuerung der Produktbereistellung
x Finanzierungs- und Zahlungsfunktion: weitere Transaktionen durch
Kaufabschluss
x Beratung und Service: Produktzusatzsleistungen (vgl. Kotler, 2003, S.507)
Durch Einsatz von kombinierten Vertriebswegen kann besser auf die Kauf- und
Konsumgewohnheiten der Nachfrager eingegangen werden und
Wettbewerbsvorteile sowie zusätzlicher Kundennutzen erzielt werden. In der
Praxis werden oft mehrere Vertriebswege zusammengesetzt, welche ein
Mehrkanalsystem, auch Multi-Channel-Vertrieb genannt, darstellen (vgl. Meffert,
Burmann, & Kirchgeorg, 2008, S.578). Des Weiteren können durch ein
Mehrkanalsystem anhand von Produkt- und Preisdifferenzierungen mehrere
Marktsegmente angesprochen werden (vgl. Heinemann, 2011, S.49).
Der Einsatz mehrerer Vertriebswege bringt aber auch diverse Gefahren mit sich.
In erster Linie können durch verschiedene Anreizsysteme, Steuerung,
Freiheitsgrade und Kontrollspannen der Vertriebswege Konfliktfelder innerhalb
der Absatzkanäle entstehen (vgl. Bruhn, 2009, S.259). Ferner kann das
Unternehmen in weitere Konfliktsituationen mit Kunden treten, wenn
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|14
unterschiedliche Botschaften, Preise und Verhaltensweisen gleichzeitig mittels
verschiedener Absatzkanäle vermittelt werden (vgl. Meffert, Burmann, &
Kirchgeorg, 2008, S.578). Daher sind Integration und Koordination der einzelnen
Absatzkanäle in der gesamten Distributionspolitik unabdingbar.
1.4 P
romotion
Kommunikationspolitik lässt sich als vierte und zunehmend bedeutende
Komponente des Marketing-Mix einordnen. Bruhn (2009
S.199) geht auf diese ein
und beschreibt das Ziel der Kommunikationspolitik in Form einer
Wechselbeziehung zwischen einem Unternehmen und seiner Zielgruppe.
Als Kommunikationspolitik wird die Gesamtheit der
Kommunikationsinstrumente und -maßnahmen eines Unternehmens
bezeichnet, die eingesetzt werden, um das Unternehmen und seine Leistungen
den relevanten Zielgruppen der Kommunikation darzustellen und/oder mit den
Anspruchsgruppen eines Unternehmens in Interaktion zu treten (Bruhn, 2009,
S.199).
Meffert, Burmann und Kirchgeorg (2008) definieren wie folgt:
,,Aus Marketingperspektive versteht man unter Kommunikation das Senden von
verschlüsselten Informationen, um beim Empfänger eine Wirkung zu erzielen.
Dementsprechend ist die Aufgabe der Kommunikationspolitik die systematische
Planung, Ausgestaltung, Abstimmung und Kontrolle aller
Kommunikationsmaßnahmen des Unternehmens im Hinblick auf alle relevanten
Zielgruppen, um die Kommunikationsziele und damit die nachgelagerten
Marketing- und Unternehmensziele zu erreichen" (Meffert, Burmann, &
Kirchgeorg, 2008, S.632)
Bei der Kommunikationspolitik eines Unternehmens handelt es sich um einen
Austausch von Informationen mit der Zielsetzung, eine möglichst effektive
Wechselbeziehung im Unternehmensumfeld aufzubauen. Zum einen beschäftigt
sich die Kommunikationspolitik mit der Frage, wie Unternehmensaktivitäten
verständlich und wirkungsvoll gegenüber den Anspruchsgruppen vermittelt
werden können. Zum anderen wird eine Informationsgewinnung über die
Marktbeteiligten, wie zum Beispiel die Konsumenten und Wettbewerber,
T h e o r e t i s c h e A n s ä t z e
Ö m e r B a l t a
S e i t e
|15
angestrebt (Kuß, 2006, S.216f). Die Informationsvermittlung dient dazu,
Unternehmensleistungen vollständig gegenüber seiner Umwelt darzulegen, die
Bedürfnisse der Kunden zu beeinflussen und zum Kauf zu bewegen (vgl. Wirtz,
2008 S.15; Wirtz, 2010, S.471). Eine Informationsgewinnung zielt dagegen darauf
ab, unvollkommene Kenntnisse über Anspruchsgruppen im Unternehmensumfeld
zu ergänzen.
Die Unternehmenskommunikation kann grundsätzlich intern und extern, einseitig
und zweiseitig ausgerichtet sein (vgl. Bruhn, 2009, S.200; Wirtz, 2010, S.471).
Interne Kommunikation findet im Unternehmen statt. Dagegen ist die externe
Kommunikation eine marktgerichtete Beziehung und bezieht sich auf
Interessengruppen außerhalb des Unternehmens (vgl. Bruhn, 2009, S.200). Bei
der einseitigen Kommunikation geht es ausschließlich um die Sendung der
Botschaft und es wird keine Gelegenheit zur Rückmeldung vom Empfänger
ermöglicht. Die zweiseitige Kommunikation erlaubt einen interaktiven Dialog
zwischen Absender und Empfänger (vgl. Wirtz, 2010, S.471).
Die einzelnen Kommunikationsmaßnahmen werden als
Kommunikationsinstrumente zusammengefasst und hängen von der
Kommunikationsart ab. Instrumente der Kommunikationspolitik werden laut
Bruhn (Bruhn, 2009 S.200) wie folgt aufgezählt:
¾ Mediawerbung
¾ Verkaufsförderung
¾ Direct Marketing
¾ Public Relations
¾ Sponsoring
¾ Persönliche Kommunikation
¾ Messen und Ausstellungen
¾ Event Marketing
¾ Multimediakommunikation
¾ Mitarbeiterkommunikation
Folglich besitzen Unternehmen diverse Einsatzmöglichkeiten für die
Kommunikationsinstrumente und -kanäle, die eine Kommunikation auf
verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen ermöglicht.
Allerdings besteht auch hier die Gefahr eines uneinheitlichen und
widersprüchlichen Auftretens des Unternehmens gegenüber Rezipienten, wenn
Instrumente der Kommunikationspolitik nicht aufeinander und mit anderen
Marketing-Mix-Instrumenten abgestimmt wurden. Dabei wird der Ansatz einer
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783842833258
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Bremen – International Studies in Economics and Business Administration
- Erscheinungsdatum
- 2014 (März)
- Note
- 1,5
- Produktsicherheit
- Diplom.de