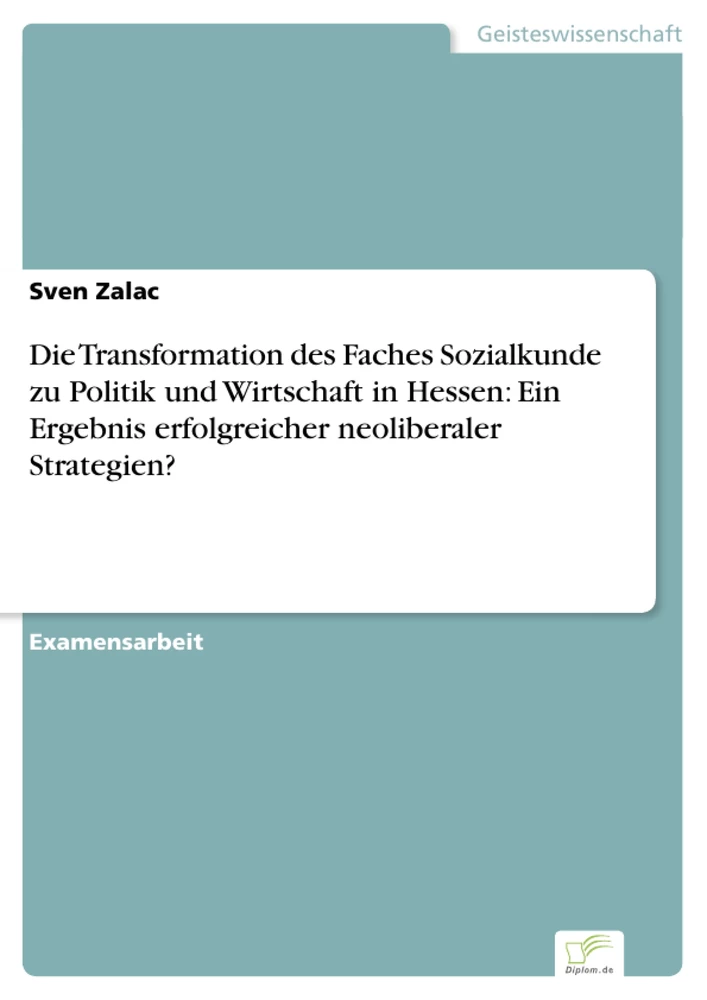Die Transformation des Faches Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft in Hessen: Ein Ergebnis erfolgreicher neoliberaler Strategien?
Zusammenfassung
1. Einleitung - die inhaltliche Gegenstandsdefinition dieser Arbeit:
‘Die hessischen Lehrpläne für ‚Politik und Wirtschaft‘ von 2002 [haben sich] (insbesondere die für die Gymnasien) dem Zeitgeist geöffnet und den globalen Paradigmenwechsel mit vollzogen, der die Freiheit der Märkte zum obersten Richtwert macht’ (Steffens & Widmaier 2008, S. 4). So sehen es zumindest Steffens und Widmaier in ihren einleitenden Worten zu einem Band, der sich mit der Ökonomisierung der politischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen beschäftigt. Sie beziehen sich dabei auf die Einführung der neuen Lehrpläne 2002, welche die Änderung des Fachs Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft inhaltlich in Kraft gesetzt hat.
Auf diese Transformation des Schulfachs beziehe ich mich im Rahmen dieser Arbeit. Dabei werde ich überprüfen, ob sich, wie von Steffens und Widmaier beschrieben, ein Paradigmenwechsel überhaupt in den Lehrplänen nieder-geschlagen hat und ob eventuell Interessengruppen, die für ein bestimmtes Marktmodell stehen, diesen Wechsel im Dienste von Eigeninteressen forciert haben.
Da im Rahmen von bildungspolitischen Entscheidungsfindungen die Zahl der Akteure nahezu unüberschaubar ist (vgl. Hepp 2011, S. 6), werde ich meine Betrachtungen unter folgenden Prämissen eingrenzen. Ich werde eine exemplarische Strategie, die nachweislich von relevanten Interessengruppen zur Zielrealisierung genutzt wird, auf ihren Einfluss untersuchen, den Sachzwang.
Ich werde überprüfen, ob die neoliberale Strategie des Sachzwangs gezielt dazu eingesetzt wurde, um Einfluss auf die Gestaltung der Lehrpläne des Fachs Politik und Wirtschaft in Hessen zu nehmen, und ob so erfolgreich marktliberale Ziele umgesetzt wurden.
Zur Begründung: Die eingangs zitierte oberste Priorisierung der Märkte weckt unwillkürlich Assoziationen zu Vorgängen der Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung. Prozesse, die in der öffentlichen Diskussion mit Schlagwörtern wie Abbau des Sozialstaates, mehr Markt, weniger Staat oder Ich-AG begleitet wurden. Diese meist sehr undifferenziert verwendeten und emotional stark aufgeladenen Begrifflichkeiten, werden unter Globalisierungsprozessen und ihren negativen Auswirkungen subsumiert. Ich möchte im Rahmen dieser wissen-schaftlichen Hausarbeit untersuchen, inwiefern sich diese Entwicklungen auf die Lehrpläne ausgewirkt haben, und zwar an dem ganz konkreten Beispiel der Umwandlung des Fachs Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft in Hessen. [...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung – die inhaltliche Gegenstandsdefinition dieser Arbeit
2. Die Strategie des Sachzwangs als Mittel zur Durchsetzung von (neo-)liberalen Eigeninteressen
2.1. Neoliberalismus – eine Abgrenzung im Kontext dieser Arbeit
2.2. Der „Homo oeconomicus“
2.3. Der Sachzwang – ein systemisches Instrument
3. Die Initialzündung zur Transformation des Fachs Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft in Hessen
3.1. Die öffentliche Diskussion im Vorfeld der Umwandlung
3.1.1. Interessenlage auf Unternehmerseite – Memorandum der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
3.1.2. Schulfach Ökonomie – das Memorandum des Deutschen Aktieninstituts
3.1.3. Positionspapier der Deutschen Vereinigung für politische Bildung
3.1.4. Stellungnahme der Lehrerverbände – das Memorandum „Ökonomische Grundbildung ist Teil der Allgemeinbildung“
3.1.5. Erstes Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung – die gemeinsame Stellungnahme der Interessenverbände
3.1.6. Position der Ständigen Konferenz der Kultusminister
3.1.7. Zusammenfassendes erstes Zwischenfazit
3.2. Erfolge der Interessenparteien – die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Kultusminister
4. Sozialkunde vs. Politik und Wirtschaft – eine Gegenüberstellung
4.1. Die Rahmenpläne für Sozialkunde und Gemeinschaftskunde (1995)
4.2. Der Lehrplan Sozialkunde (2002)
4.3. Zusammenfassung der Veränderungen zwischen Rahmenplan und Lehrplan
5. Der Ausbau ökonomischer Bildung aus didaktischer Perspektive
5.1. Der mündige (Wirtschafts-)Bürger – Argumente der Befürworter
5.1.1. Die wirtschaftswissenschaftliche Methode als Erweiterung des sozialwissenschaftlichen Instrumentariums
5.1.2. Mangelnde Berücksichtigung ökonomischer Inhalte
5.1.3. Defizitäre Lehrerausbildung
5.1.4. Positiveffekte der Kosten/Nutzen-Verhaltenstheorie – normative Begründungen für einen Ausbau wirtschaftswissenschaftlicher Denkschemata
5.2. Das entmündigte Wirtschaftssubjekt – Argumente der Vertreter klassischer politischer Bildung
5.2.1. Die praktische Undurchführbarkeit des „Disziplinismus“
5.2.2. Unangemessene quantitative Forderungen der Wirtschaft(sdidaktiker)
5.2.3. Integrative Multiperspektivität als notwendige Voraussetzung zur Erschließung der Lebenswelt
5.2.4. Die Eindimensionalität der Verhaltenstheorie und deren Unvereinbarkeit mit dem Beutelsbacher Konsens
6. Resümee
Bibliografie
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gegenüberstellung der Themenbereiche Rahmenplan 1995 und des
Lehrplans 2002
Abbildung 2: „Klassische“ politische Bildung (nach Massing 2008, S. 195)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung - die inhaltliche Gegenstandsdefinition dieser Arbeit
„Die hessischen Lehrpläne für ‚Politik und Wirtschaft‘ von 2002 [haben sich] (insbesondere die für die Gymnasien) dem Zeitgeist geöffnet und den globalen Paradigmenwechsel mit vollzogen, der die Freiheit der Märkte zum obersten Richtwert macht“ (Steffens & Widmaier 2008, S. 4). So sehen es zumindest Steffens und Widmaier in ihren einleitenden Worten zu einem Band, der sich mit der Ökonomisierung der politischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen beschäftigt. Sie beziehen sich dabei auf die Einführung der neuen Lehrpläne 2002, welche die Änderung des Fachs Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft inhaltlich in Kraft gesetzt hat.
Auf diese Transformation des Schulfachs beziehe ich mich im Rahmen dieser Arbeit. Dabei werde ich überprüfen, ob sich, wie von Steffens und Widmaier beschrieben, ein Paradigmenwechsel überhaupt in den Lehrplänen nieder-geschlagen hat und ob eventuell Interessengruppen, die für ein bestimmtes Marktmodell stehen, diesen Wechsel im Dienste von Eigeninteressen forciert haben.
Da im Rahmen von bildungspolitischen Entscheidungsfindungen die Zahl der Akteure nahezu unüberschaubar ist (vgl. Hepp 2011, S. 6), werde ich meine Betrachtungen unter folgenden Prämissen eingrenzen. Ich werde eine exemplarische Strategie, die nachweislich von relevanten Interessengruppen zur Zielrealisierung genutzt wird, auf ihren Einfluss untersuchen, den Sachzwang.
Ich werde überprüfen, ob die neoliberale Strategie des Sachzwangs gezielt dazu eingesetzt wurde, um Einfluss auf die Gestaltung der Lehrpläne des Fachs Politik und Wirtschaft in Hessen zu nehmen, und ob so erfolgreich marktliberale Ziele umgesetzt wurden.
Zur Begründung: Die eingangs zitierte oberste Priorisierung der Märkte weckt unwillkürlich Assoziationen zu Vorgängen der Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung. Prozesse, die in der öffentlichen Diskussion mit Schlagwörtern wie Abbau des Sozialstaates, mehr Markt, weniger Staat oder Ich-AG begleitet wurden. Diese meist sehr undifferenziert verwendeten und emotional stark aufgeladenen Begrifflichkeiten, werden unter Globalisierungsprozessen und ihren negativen Auswirkungen subsumiert. Ich möchte im Rahmen dieser wissen-schaftlichen Hausarbeit untersuchen, inwiefern sich diese Entwicklungen auf die Lehrpläne ausgewirkt haben, und zwar an dem ganz konkreten Beispiel der Umwandlung des Fachs Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft in Hessen. Ich werde ganz bewusst nicht die in diesem Kontext naheliegenden Begrifflichkeiten, wie methodische Fragen der politischen Bildung an Schulen oder eine Herausbildung eines neuen Politikverständnisses, in den Fokus stellen. Selbstverständlich werden diese Aspekte dort, wo es dieser Arbeit dienlich ist, angemessen behandelt. Aber unter der von mir gewählten Perspektive rückt vor allem die Begründungsebene in den Mittelpunkt. Warum fand die Transformation gerade zu diesem Zeitpunkt statt? Welche neuen Erkenntnisse haben ein Überdenken der bisherigen Strukturen notwendig gemacht? Welche Ziele wurden umgesetzt und wessen Ziele waren das?
Die gerade skizzierten Sachverhalte werden meist mit dem neoliberalen Umbau in Verbindung gebracht. Der Begriff des Neoliberalismus wird oft diffus und unscharf verwendet. Aus diesem Grund werde ich gleich zu Beginn des inhaltlichen Teils eine diesbezügliche Gegenstandsdefinition vornehmen. Ich werde die Abgrenzung unter den für diese Arbeit relevanten ökonomischen Gesichtspunkten durchführen und einige für das grundlegende Verständnis der Diskussion, um eine Erweiterung der ökonomischen Bildung, notwendige Begrifflichkeiten einführend erläutern.
Um eine mögliche Einflussnahme nachzuweisen, werde ich zunächst die im Vorfeld stattgefundene Diskussion einschließlich der initialen Impulsgeber nachvollziehen. Beginnen werde ich mit einem vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber verfassten Memorandum „Mehr Ökonomie in der Schule“ (BDA 1998), dass als eine Art Startpunkt für die nachfolgende Diskussion über eine Ökonomisierung des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen gelten kann. Im Folgenden werde ich eine Analyse der sich in diese Auseinandersetzung einschaltenden wichtigsten Interessengruppen und Wortmeldungen nachzeichnen.
Ziel ist zu überprüfen, inwiefern sich die Argumente der beteiligten Parteien unterscheiden.
Den Abschluss des ersten thematischen Abschnitts wird eine skizzierte Darstellung der Ergebnisse der Ständigen Konferenz der Kultusminister darstellen, um so einen Niederschlag der Interessengruppen nachzuvollziehen.
Um dem Rahmen dieser Arbeit gerecht zu werden und verschiedene Besonderheiten, die sich aufgrund der föderalistischen Struktur von Bildung in Deutschland ergeben, ausklammern zu können, werde ich mich exemplarisch auf das Bundesland Hessen konzentrieren. Um eine aussagekräftige und von jeweiligen Besonderheiten des Bundeslandes bereinigte wissenschaftlich fundierte Aussage treffen zu können, sollten die Analysen für jedes Land gesondert vorgenommen werden. Als Hinweis für die Notwendigkeit einer solchen Fokussierung sei an dieser Stelle beispielhaft auf die sehr unterschiedlichen Lösungen verwiesen, für die sich die einzelnen Bundesländer bei der Fachumwandlung von Sozialkunde, Gesellschaftslehre beziehungsweise Arbeitslehre entschieden haben (vgl. Tschirner 2008, S. 75-83).
Im vierten Abschnitt dieser Arbeit werde ich basierend auf den bis dahin gewonnen Erkenntnissen, den eventuellen Niederschlag von möglichen marktliberalisierenden Eigeninteressen diskutieren. Dazu überprüfe ich zunächst, was genau sich in den Curricula geändert hat. Dies werde ich anhand einer strukturierten vergleichenden Gegenüberstellung erarbeiten, einschließlich der sich ergebenden Konsequenzen für den Unterricht. Dazu werde ich sowohl die Vertreter der klassischen politischen Bildung als auch die Befürworter der Fachtransformation zu Wort kommen lassen und deren Positionen diskutieren. Was unter den jeweiligen Interessenlagern genau zu verstehen ist, werde ich jeweils vorab erläutern. Ziel ist es festzustellen, ob überhaupt neoliberale (Eigen-) Interessen umgesetzt wurden und welche möglichen Auswirkungen dies auf den Unterricht hat bzw. haben kann.
Im abschließenden Resümee werde ich die Teilergebnisse in einer zusammenführenden Diskussion erörtern und auf die These dieser Arbeit beziehen.
2. Die Strategie des Sachzwangs als Mittel zur Durchsetzung von (neo-) liberalen Eigeninteressen
Bevor ich den Begriff und die Funktionsweise des Sachzwangs genauer auseinandersetzen werde, möchte ich im Rahmen der Zielsetzung meiner Arbeit zunächst den Begriff des Neoliberalismus abgrenzen bzw. erörtern, was unter einer neoliberalen Strategie zu verstehen ist.
2.1. Neoliberalismus – eine Abgrenzung im Kontext dieser Arbeit
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es kaum noch jemanden der sich selbst als Neoliberalen bezeichnen würde, da der Begriff aktuell hochgradig negativ konnotiert ist. Er wird in der öffentlichen Debatte eher als Schimpfwort verwendet und kommt einer Stigmatisierung gleich (vgl. Willke 2003, S. 11-14). Trotzdem ist er überall präsent, sowohl medial als auch im wissenschaftlichen Diskurs. Global operierende zivilgesellschaftliche Gruppen erklären öffentlichkeits-wirksam den (neo-)liberalen Umbau und das Diktat der „freien Märkte“ für beendet (vgl. Occupy 2012), kritische wissenschaftliche Auseinandersetzungen die den „fairen Wettbewerb“ als Konzept prinzipiell in Frage stellen (Tiehlemann 2010) und besorgte Wissenschaftler, die sich zu einem Aufruf gegen die paradigmatische Auslegung der Wirtschaftswissenschaften, einem der Grund-pfeiler neoliberaler Argumentation, veranlasst sehen (Thielemann, von Egan-Krieger, Thieme 2012), zeugen von der ungebrochenen Aktualität des Themas.
Seinen Ursprung hat der Neoliberalismus per Wortdefinition im Liberalismus. Skizzieren möchte ich hier nicht den politischen, sondern den ökonomischen Liberalismus, da hauptsächlich er für den Fokus dieser Arbeit relevant ist.
Als einer der wichtigsten Wegbereiter des (Wirtschafts-)Liberalismus gilt gemeinhin Adam Smith mit seiner, auch in der heutigen Diskussion allgegenwärtigen, „unsichtbaren Hand“ (Loheide 2011, S. 36). Das Werk „Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker“ (Smith 2005), in dem er diesen metaphorischen Begriff prägt und das dazugehörige Modell des Warenverkehrs formuliert, gilt als die Grundsteinlegung zur modernen Volkswirtschaft (Loheide 2011, S. 36). „Adam Smith bezeichnete … [mit der unsichtbaren Hand] unbeabsichtigte, positive Nebenwirkungen individuellen Handelns auf Märkten“ (Hedtke 2008, S. 317). Durch eigennütziges Agieren von Unternehmern mit Gewinnabsicht steigt quasi als Nebenprodukt das Volkseinkommen. „Dieser indirekte Mechanismus fördere das Gemeinwohl meistens besser, als wenn man es zielgerichtet und direkt verfolge“ (ebd.). Die Grundannahme hinter Smiths Marktmodell ist ein Gleichgewicht, dass sich durch Angebot und Nachfrage indizierte Preisbildung selbstständig herstellt. Bei Smith war die Theorie des Marktes noch eng verzahnt mit der Idee eines Gerechtigkeitsprinzip (vgl. Willke 2003, S. 39-14) und besaß durchaus religiöse Anleihen (vgl. Segbers 2006, S. 199). Die „neuen“ Liberalen haben vor allem die Marktmechanismen übernommen und weiterentwickelt.
Der Neo liberalismus hat seinen Ursprung als „ … Reaktion auf das Versagen der liberalen Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschaftskrise 1929-32. Gegen den internationalen Trend zu einer aktiven und regulierenden Wirtschaftspolitik im Rahmen des umverteilenden Wohlfahrtsstaates … suchten die Neoliberalen nach einer neuen Legitimationsgrundlage für den entfesselnden Kapitalismus“ (Ptak 2005, S. 132). Während sich das (wirtschafts-)politische Klima zugunsten des Keynesianischen demand management veränderte, also zugunsten von Nachfrage stützenden öffentlichen Investitionen sowie einer wirtschaftslenkenden Funktion des Staates (vgl. Willke 2003, S. 30), arbeiteten einige neoliberale Vordenker weiter an verschiedenen Wirtschaftstheorien (vgl. Ptak 2008, S. 41-50). Diese rückten die Kräfte des Wettbewerbs und die daraus entstehenden Dynamik als probates Mittel zur Krisenbewältigung in den Fokus (vgl. ebd., S. 30). In den 1970er Jahren fand eine Verschärfung der wirtschaftlichen Situation statt. „Die steigende Arbeitslosigkeit galt nunmehr als Ergebnis nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik, was eine Erosion des keynesianischen Grundkonsens in der Bundesrepublik bedeutete und eine Abkehr vom interventionistischen Wohlfahrtsstaats auslöste“ (Engartner 2008, S. 39). Das politische Klima änderte sich zugunsten der neoliberalen Theorien. Ihnen allen gemeinsam war, dass deren „… oberste[s] Credo … lautete, daß optimale Ergebnisse immer dann erzielt werden, wenn sich Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Waren und Dienstleistungen durch den Mechanismus der Preisbildung selbst regulieren, ohne staatliche oder sonstige Eingriffe…“ (Crouch 2011, S. 39).
Dadurch bekommt „der Markt“ einen vermeintlich naturwissenschaftlichen Charakter. Er folgt (Natur-)Gesetzmäßigkeiten, die durch ein menschliches Eingreifen in die diffizilen Mechanismen zwangsläufig gestört werden müssen. Aus dieser Logik heraus scheint eine Marktliberalisierung die einzig rationale Option. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein kompletter politischer Rückzug angestrebt wird. Allerdings haben staatliche Eingriffe vornehmlich den Sinn, „… die Bedingungen für die Freiheit des Marktes herzustellen, der von Neoliberalen als ein äußerst empfindlicher und zerbrechlicher Mechanismus imaginiert wird“ (Demirovic 2008, S. 25).
Dieser Aspekt der (neo-)liberalen Theorien wird den perspektivischen Fokus dieser Arbeit ausmachen, da er die Basis für die Argumentation bezüglich der Besonderheiten des wirtschaftswissenschaftlichen Zugangs bildet. Der Begriff neoliberal wird von mir synonym zu wirtschaftsliberal verwendet. „Wirtschafts-liberal soll hier in erster Linie den politischen Grundsatz des (absoluten) Vorrangs der individuellen ökonomischen Freiheit bezeichnen, der auf einem individualistischen, marktoptimistischen Menschen- und Gesellschaftsbild gründet…“ (Hedtke & Möller 2011, S. 8).
Was unter diesem Menschenbild zu verstehen ist, werde ich im Folgenden genauer erläutern. Es ist in seiner Bedeutung grundlegend für das Verständnis der Auseinandersetzung und der Argumente, die die Fachumwandlung begleitet haben.
2.2. Der Homo oeconomicus
Ein Begriff der mit den (neo-)liberalen Strömungen eng verwoben ist, bzw., wie bereits angedeutet, eine Grundlage für deren Theoriebildung darstellt, ist der „Homo oeconomicus“. Vor allem dieses Modell der Erklärung menschlichen Verhaltens steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen um eine Ökonomisierung des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen. Darüber hinaus ist er mit dem Sachzwang eng verwoben und stellt für dessen Verständnis eine Voraussetzung dar.
Es handelt sich bei dem Homo oeconomicus um einen Begriff, der das Spezifikum definiert, nachdem der Mensch, in diesem Zusammenhang der Marktteilnehmer, seine (ökonomischen) Entscheidungen trifft, zumindest nach Meinung der Vertreter (neo-)liberaler Markttheorien. Der „… Homo oeconomicus [verfügt] über ein widerspruchsfreies Zielsystem (ohne Zielkonflikte) und er entscheidet rational. Er wählt immer diejenige Maßnahme, die seinen Zielen am besten dient, und er handelt immer zu seinem Vorteil“ (BPB 2009, S. 16). Der Mensch handelt also ausschließlich nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung. Jegliches Handeln und Agieren wird damit erklärt, dass sich der Akteur einen irgendwie gearteten Vorteil von seinem Tun verspricht. Dies gilt in aller Konsequenz auch für vermeintlich selbstlose oder altruistische Handlungen. Solidarität und Fürsorge findet nur dort statt, wo sie einen Vorteil oder einen Genuss verspricht, z. B. durch Realisieren von ethischen Zielen oder soziale Anerkennung. Somit werden Gesellschaftsverbände und Solidargemeinschaften aber auch kulturelles Schaffen letztlich reduziert auf das Modell der persönlichen Nutznießung.
Der Homo oeconomicus stellt somit eine (ökonomische) Verhaltenstheorie dar. Mit diesem Sammelbegriff werden Theorien zusammengefasst, die versuchen, menschliches Verhalten mittels Modellen und auf der Basis quantitativer Analysen menschliches Verhalten zu erklären. Mit den quantitativen Methoden lassen sich zwar Aussagen zu Korrelationen und Tendenzen bezüglich menschlichem Verhalten treffen, aber nicht ursächlich erklären[1] (vgl. Kriz 1973, S. 242). Dies gilt auch für die hier relevante ökonomischen Verhaltenstheorie.
Auf der einen Seite gibt es Probleme mit der Annahme, dass das Individuum immer die für sich beste Entscheidung trifft. Diese setzt eine genaue Kenntnis aller relevanten Parameter voraus, welche nicht immer gegebenen sein kann oder an der begrenzten Informationsverarbeitung scheitert (vgl. Crouch 2011, S. 59-60). Neuere Ansätze der Verhaltenstheorien berücksichtigen diese Probleme in erweiterten Modellen, allen gemeinsam ist allerdings die Erklärung, dass der Mensch Entscheidungen aus Motiven des Eigeninteresses auf rationaler Ebene trifft (vgl. BPB 2009, S. 16).
Darüber hinaus ist die Theorie sehr geschlossen und lässt keine weitere Denk- und Interpretationsebene zu. „Die Kausalitätsargumentation zieht nur Ursachen in Betracht, die sich mathematisch beschreiben und bearbeiten lassen. Ursachen, die sich solcher Rechenhaftigkeit entziehen, werden allenfalls noch als Hilfserklärung zugelassen, …wo Erklärungsdefizite zum Thema werden“ (Hartmann 1995, S. 28). Dadurch verleiten Modelle, wie sie vor allem auch in den Wirtschafts-wissenschaften verwendet werden, dazu, anzunehmen, menschliches Verhalten sei eben nur aus diesem Modell heraus erklärbar.
Die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind sehr weitreichend und münden, auch wenn dies zumindest von den wissenschaftlichen Ansätzen nicht intendiert ist, im ökonomischen Kontext in ein System von Sachzwängen.
2.3. Der Sachzwang - ein systemisches Instrument
Die taktische Vorgehensweise des Sachzwangs wird im Rahmen der Globalisierungsprozesse immer wieder für die Durchsetzung von Zielen bemüht. Es handelt sich beim Sachzwang um ein grundlegendes Prinzip, eine „Strategie“, welche die jeweilige Interessenpartei in seiner angepassten Ausformulierung zur Erreichung eigener Ziele ins Feld führt.
Ich habe den Begriff Strategie bewusst in Anführungszeichen gesetzt, weil er einen Initiator, sei es eine einzelne Person oder eine Gruppierung, suggeriert, der mit ihr zielgerichtet Ziele verfolgt. Warum das in diesem Fall, zumindest je nach Sichtweise, nur teilweise richtig ist, wenn überhaupt, werde ich im weiteren Verlauf dieses Abschnitts erörtern.
Der Begriff des Sachzwangs ist eng verbunden mit Vorgängen im Rahmen des Prozesses der Globalisierung. Einen öffentlichkeitswirksamen Höhepunkt des Sachzwangs in Deutschland stellte die Kür des Wortes „alternativlos“ zum „Unwort des Jahres 2010“ (UDJ 2010) von der Gesellschaft für deutsche Sprache dar. Den Begriff der Alternativlosigkeit hat Bundeskanzlerin Merkel häufig im Zusammenhang mit der sogenannten Bankenkrise verwendet. Die zum Großteil aus Sprachwissenschaftlern bestehende Jury führt in ihren Begründungen zur Wahl aus: „Das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Behauptungen dieser Art sind 2010 zu oft aufgestellt worden, sie drohen, die Politik-Verdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken“ (ebd.). Diese Begründung lässt bereits erahnen, warum diese Thematik vor allem vor dem Hintergrund der politischen Bildung gleich auf zweifacher Ebene von Bedeutung ist. Der Sachzwang dient einerseits als Mittel zur Durchsetzung, andererseits hat er eine entdemokratisierende Wirkung (vgl. Lösch 2008, S. 250-257).
Wie bereits erläutert, bildet der Homo oeconomicus die Basis um den Sachzwang auszulösen. Dadurch, dass der einzelne Mensch lediglich seine eigene Nutzenmaximierung im Sinn hat, folgt er dem Modell eines klassischen betriebswirtschaftlichen Unternehmens. Dieses muss, zumindest nach der im Augenblick vorherrschenden Ausfassung, zwangsläufig nach Nutzenmaximierung streben, da es den Gewinn wieder reinvestieren muss, um weiter zu wachsen und sich größere Marktanteile zu verschaffen. „Unternehmen, die das nicht tun, werden von ihren Konkurrenten überflügelt und verschwinden vom Markt“ (Crouch 2011, S. 80).
Auch der einzelne Mensch steht als Individuum und als Teil einer Gruppe in Konkurrenz zu anderen. Durch sein Bestreben nach Nutzenmaximierung findet eine Ökonomisierung statt. Er steht in seinem Betrieb im Wettbewerb um den besten Arbeitsplatz und mit Billigarbeitskräften an irgendeinem anderen Ort der Erde um den Standort. Selbst Staaten werden zu Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen, sie konkurrieren um die intelligentesten Köpfe, die wichtigsten Unternehmen, die zukunftsträchtigsten Technologien und die besten Standortbedingungen. Bei jeder Krise verschärft sich die Konkurrenz und die Rezepte der Parteienlandschaft gleichen sich immer mehr an. „Alle verfolgen das Ziel, den bundesdeutschen Arbeitsmarkt im internationalen Wettbewerb irgendwie konkurrenzfähiger zu machen. Übereinstimmend wird diagnostiziert, dass die Bundesrepublik ein massives Standortproblem habe, ausgelöst von zu hohen Löhnen, Lohnnebenkosten und Sozialleistungen. Auch die Therapieansätze gleichen sich: Senkung der Lohnnebenkosten, der Unternehmenssteuern, der sozialen Leistungen oder gleich Umbau des gesamten Steuer- und Sozialabgabensystems“ (Flassbeck & Spiecker 2006, S. 219).
Die vermeintliche Naturgesetzmäßigkeit des Marktes, in Kombination mit der permanenten Konkurrenzsituation auf nationaler und globaler Ebene verbindet sich schließlich zum Sachzwang. Durch ihn werden Stück für Stück empfindlichste Einsparungen plötzlich „alternativlos“. Einschnitte ins soziale Netz und der Abbau von kulturellen Errungenschaften lassen sich mit ihm rechtfertigen, auch wenn sie sozial ungerecht erscheinen. „Es liegt nicht mehr im Ermessen einer Gesellschaft, was sich ein politisches Gemeinwesen an sozialer Sicherheit leisten will, sondern die Wettbewerbsbedingungen einer globalen Wirtschaft diktieren das Maß sozialstaatlicher Politik“ (Lösch 2005, S. 175). Die Zugeständnisse müssen akzeptiert werden, weil „das Kapital“ sonst weiterzieht, nach Aussagen der (Neo-)liberalen auch weiterziehen muss, um nicht zugrunde zu gehen. Dies, so betonen die Vertreter der Freien Marktwirtschaft, hätte empfindliche Konsequenzen. Es würde einen Abbau von Sozialleistungen aller Art nach sich ziehen, weil kein Geld mehr am Markt vorhanden ist und letztlich, so das finale „Totschlagargument“, würden die Arbeitsplätze gefährdet. Gepaart mit dem Abbau des sozialen Netzes, das gerade auf Drängen der neoliberalen Ideologien bereits stattgefunden hat, würde dies ein Abrutschen vieler Bürger in ein Leben am Rande der Gesellschaft bedeuten und wäre somit existenzbedrohend im wahrsten Wortsinn.
Die neoliberalen Ideologien werden ganz gezielt von think tanks lanciert und in den öffentlichen Diskurs implementiert (vgl. Lösch 2008, S. 274-283). „Einer der einflußreichsten und finanzstärksten Akteure der öffentlichen Meinungsbildung bzw. –Manipulation ist derzeit die ‚Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft’ (INSM)“ (ebd., S. 275). Sie ist vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion um einen Ausbau ökonomischer Bildung von Bedeutung, da sie wichtigen treibenden Kräften, z. B. den unten zu Wort kommenden Wirtschaftsdidaktikern Kaminski und Eggert, den Geschäftsführern des Instituts für ökonomische Bildung (IÖB), erhebliche Ressourcen zur Verfügung stellt und aktiv an dem Projekt mitarbeitet (vgl. Möller 2011, S. 29). Die INSM ist allerdings nur ein Akteur von vielen, die in diese Richtung arbeiten (vgl. ebd., S. 31-35).
Ein beispielhaftes strategisches Mittel zur Befeuerung des Sachzwangs, ist das Verbreiten von Rankinglisten und Benchmarkings. Es handelt sich um Instrumente, die in verschiedenen Kontexten Vergleichshierarchien aufstellen. Sie thematisieren beispielsweise Wirtschaftswachstum, Effizienz, Arbeitsproduktivität, sowie alles andere, was der Wirtschaftslobby und ihren nahestehenden Gruppierungen Vorteile verspricht. Die Rankinglisten werden unter massivster Ressourcennutzung von den unternehmerischen Kräften eigeninitiativ verfasst und in Umlauf gebracht. Durch die Rankinglisten gerät man als Betroffener in eine Vergleichssituation. Aktuell sind sie im Rahmen der Weltwirtschaftskrise, durch die Ratingagenturen der Finanzwirtschaft (vgl. Wahl 2009, S. 47-49), in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Ratings wurden eigentlich als „… eine wettbewerbsorientierte Managementmethode für Unternehmen entwickelt...“ (Sack 2005, S. 18), lassen sich aber auch auf andere Inhalte anwenden. Im Schulkontext ist die Pisa-Studie ein bekanntes Beispiel. Das Benchmarking, der Vergleich mit den Besten, kann aber auch auf Staaten angewendet werden. Regierungen müssen dann zum Beispiel Stellung nehmen zu der Frage: Warum hat Staat x ein Wirtschaftswachstum von 5 % und wir nur 2 %? Es wird eine Konkurrenzsituation geschaffen, die oft weder bestanden hat, noch intendiert war, zumindest nicht von den Bewerteten. Es handelt sich letztlich um Agendapolitik am Staat und an demokratischen Prozessen vorbei, denn „… die Logik des Instruments verlangt Angleichung“ (Sack 2005, S. 19). Dass heißt, durch das Messen mit den Besten wird rationaler Druck aufgebaut. Im Kontext der Globalisierung wird Benchmarking und Rating beispielswiese im Rahmen des Standortwettbewerbs eingesetzt, um Lohndumping oder Deregulierungen durchzusetzen.
Demokratisch wird, wenn überhaupt, nur noch verhandelt, wie auf den Sachzwang reagiert wird, aber nicht mehr ob dieser überhaupt besteht oder ob man diese Konkurrenzsituation überhaupt möchte. Das heißt, die neoliberalen Interessenparteien nutzen ganz gezielt ihre Ressourcen, um Ziele unter dem Deckmantel der Rationalität und Objektivität durchzusetzen. Auch Reglementierungen erscheinen undenkbar, denn der Markt folgt schließlich seinen eigenen, vermeintlich objektiven (Natur-)Gesetzmäßigkeiten und jeder Eingriff, wie vor allem die marktliberalisierenden Kräfte hervorheben, führt zu einer empfindlichen Störung des freien Marktes.
3. Die Initialzündung zur Transformation des Fachs Sozialkunde zu Politik und Wirtschaft in Hessen
Der ursächliche Gegenstand, den ich hier unter oben genannten Gesichtspunkten analysieren möchte, ist die Umwandlung des Fach Sozialkunde zum Fach Politik und Wirtschaft im Bundesland Hessen. Dort wurden die alten bisherigen Fächer Sozial- bzw. Gemeinschaftskunde „… zum Integrationsfach „Politik und Wirtschaft“ umgewandelt, gleichzeitig wurde am Gymnasium der Anteil der ökonomischen Bildung deutlich ausgeweitet und die Gesamtunterrichtszeit … deutlich reduziert“ (Tschirner 2008, S. 76). Mit der Veröffentlichung der Curricula 2000/2001 wurde die Transformation festgeschrieben und zur bindenden Grundlage für die Lehrer in Hessen für die gymnasiale Oberstufe. Diese Umwandlung war das Ergebnis einer in der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland beschlossenen Änderung. Durch den nicht bindenden Charakter dieser Konferenz und der föderalen Organisation von Bildung in Deutschland, ist das jeweilige tatsächlich realisierte Ergebnis von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ausgefallen.
Kenntnisse über Aufbau und Implementation der KMK als Akteur im Rahmen der demokratischen und föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland werden vorausgesetzt. Für eine Vertiefung sei an dieser Stelle einerseits auf die frei zugängliche Geschäftsordnung im Internet verwiesen (KMK 2005) sowie auf die Einführung von Hesse und Ellwein, die die Strukturen der KMK übersichtlich darstellt und erläutert (Hesse & Ellwein 1997, S. 238).
3.1. Die öffentliche Diskussion im Vorfeld der Umwandlung
Im folgenden Abschnitt werde ich die einzelnen Positionen der wichtigsten Interessengruppen darstellen, die einerseits die Diskussion bezüglich eines Ausbaus ökonomischer Bildung überhaupt erst in Gang gebracht und andererseits auf diese Vorschläge reagiert haben. Ich werde die Stellungsnahmen in chronologischer Reihenfolge behandeln, um so den Diskussionsverlauf in seiner Entwicklung nachzuvollziehen. Neben einer Darstellung der wesentlichsten Inhalte, werde ich die einzelnen Stellungnahmen auch gezielt unter der Fragestellung dieser Arbeit, also unter der Perspektive des Sachzwangs, analysieren. Der Fokus liegt vor diesem Hintergrund also vornehmlich auf den Begründungen und wird inhaltlich nur dort im Detail ergänzt, wo sie entweder Neues zur Diskussion beitragen oder aber einem besseren Verständnis der Argumente und der dahinterliegenden Positionen und Ideen dienlich sind. Die Darstellung der einzelnen Positionen werde ich relativ ausführlich behandeln, da sie in der späteren, und soviel sei hier vorweggenommen, bis heute andauernden Auseinandersetzung so oder in abgewandelter Form wiederkehren, also für das grundlegende Verständnis von Bedeutung sind.
Abschließen werde ich diesen Teil mit einer Zusammenfassung und einer anschließenden Beurteilung der Diskussion im Vorfeld der Transformation des Schulfachs.
3.1.1. Interessenlage auf Unternehmerseite – Memorandum der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Als erstes werde ich ein Papier diskutieren, welches wie in der Einleitung angedeutet, im Rahmen des Transformationsprozesses eine besondere Rolle zu spielen scheint. Steffens und Widmaier stellen den Beitrag „Mehr Ökonomie in der Schule“ in seiner Bedeutung heraus: „Der Ruf nach mehr ökonomischer Bildung ist, seit die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 1998 ein Memorandum ‚Mehr Ökonomie in der Schule’ veröffentlicht hat, stetig lauter geworden“ (Steffens & Widmaier 2008, S. 3). Auch Tschirner dient das besagte Memorandum, um die Initiierung und versuchte Einflussnahme zumindest auf die öffentliche Diskussion, mit dem Ziel einer Neugewichtung der Bedeutung von wirtschaftlichen Inhalten im Schulunterricht, zu veranschaulichen (Tschirner 2008, S. 72-73). Dies mag verwundern, hält man sich jedoch vor Augen, um wen es sich bei dem Bundesverband der Arbeitgeber (BDA) handelt, wird diese Gewichtung plausibel. „Die BDA ist die Spitzenorganisation der Arbeitgeberverbände der Bundesrepublik Deutschland. [Ihr] … gehören 56 nach Wirtschaftszweigen gegliederte Bundesfachverbände und 14 Landesverbände an“ (Schmidt 2011, S. 112).
In der Stellungsnahme macht sich der BDA für den Ausbau der ökonomischen Bildung innerhalb des Schulunterrichts stark.
Als Begründung für die Notwendigkeit des Memorandums führt das Papier eine spürbare Zunahme von Verunsicherung der Bürger hinsichtlich des wirtschaftlichen Wandels an. Die Herausforderungen und Möglichkeiten von wirtschaftlichen Prozessen wird „… oftmals nicht als Chance und Herausforderung, sondern als Bedrohung empfunden“ (BDA 1998, S. 2). Aus diesem Grund sieht die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände eine Handlungsnotwendigkeit.
Die eingangs formulierten Forderungen stellen den Menschen beziehungsweise Schüler als mündigen „Wirtschaftsbürger“ (ebd.) in den Vordergrund. „Oberstes Bildungsziel ist die Befähigung des Einzelnen, in wirtschaftlichen Handlungssituationen sachgerecht, selbstbestimmt und verantwortlich urteilen und entscheiden zu können“ (ebd.). Diese Ziele beinhalten, den Schüler in die Funktionsweise von Wirtschaftssystemen einzuführen, ihm Einblicke in die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu gewähren, ebenso wie ein Verständnis von Zusammenhängen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu vermitteln (vgl. BDA 1998, S. 2). Auch der weitere Inhalt der einleitenden Passage bezieht sich auf ein „ganzheitliches“ Verständnis von Ökonomie. Der sehr inhaltsdichte Forderungskatalog stellt aber auch deutlich heraus, dass wirtschaftliches Handeln immer gleichfalls Wertfragen berührt, die einer normativen Grundlage und Legitimation bedürfen. „Normatives Entscheidungskriterium ist die Verantwortung für sich selbst, für die Gemeinschaft und die Umwelt. Ökonomischer Unterricht muß sich dieser Wertfrage stellen und darauf Antworten geben“ (ebd.).
Als oberste Ziele sind in diesem Memorandum also Entwicklung der Urteils- und Entscheidungsfähigkeit der Schüler formuliert. Primäres Ziel in Bezug auf das Individuum, also den Schüler, wird die sachkundige, eigenverantwortliche und persönlichkeitsbezogene Berufswahl in den Vordergrund gestellt.
Im zweiten Hauptabschnitt „Defizite im Schulalltag“ verweist das Memorandum auf die mangelnden Voraussetzungen, um die im ersten Teil formulierten Vorhaben umzusetzen. Zuallererst fehlt es nach Meinung der Verfasser des Memorandums an einem klaren wirtschaftlichen Profil. Dies führt zu einer nur randständigen Behandlung ökonomischer Sachverhalte innerhalb der Schul-bildung. Darüber hinaus wird auch die methodisch rückständige, abwechslungsarme, meist lehrerzentrierte Ausrichtung des Unterrichts bemängelt und dies, obwohl sich „… Planspiele und Projekte … gerade im Wirtschaftsunterricht anbieten …“ (ebd., S. 3). Verschärft wird dieses Problem durch veraltete und medial zu wenig abwechslungsreiche Ausstattung mit Lehrmitteln. Ein weiterer Kritikpunkt der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände ist die unzureichende Ausbildung der Lehrkräfte in Bezug auf wirtschaftliche Sachverhalte und die mangelnde Gewichtung von ökonomischen Inhalten.
Im dritten und umfangreichsten Abschnitt des Memorandums werden die Konsequenzen behandelt, die sich, nach Ansicht der Arbeitgeberverbände, aus den angemahnten Defiziten ergeben. Zunächst fordert der Arbeitgeberverband weiterreichende Implementierungen von Wirtschaftsunterricht in die Curricula. Die bis dato über die vereinzelten Fächer stattfindende ökonomische Bildung, etwa in den Fächern Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Sozialwissenschaften oder Wirtschafts- und Rechtslehre, muss zu einem „… Gesamt-Curriculum des ökonomischen Unterrichts verdichtet werden“ (ebd., S. 4). Das Memorandum plädiert dafür, ein verbindliches schulinternes Wirtschaftscurriculum festzuschreiben. Dabei kann die wirtschaftliche Erziehung nicht früh genug anfangen. Bereits in der Grundschule „… müssen die Kinder an die Wirtschafts- und Arbeitswelt herangeführt werden“ (BDA 1998, S. 4). Der gymnasiale Bildungszweig soll in der Sekundarstufe massiv ausgebaut werden. „Mindestens notwendig ist dazu ein zweistündiges Leitfach ‚Wirtschaft und Politik‘, das verbindlich für alle Schüler ist. Der Anteil der ökonomischer Inhalte sollte mindestens 50 Prozent betragen“ ebd., S. 5). Die Sekundarstufe II muss nach Meinung der Arbeitgeberverbände zum Zwecke der Studierfähigkeit der Schüler, um eine wissenschaftsorientierte Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Fragen in einem eigenständigen Unterrichtsfach mit klar ökonomischem Schwerpunkt erweitert werden (vgl. ebd.).
Um die eingangs definierten Defizite zu beheben, plädieren die Autoren des Memorandums für einen erweiterten Praxisanteil, sowohl auf Seiten der Schüler als auch der Lehrer. Dies bedeutet, dass die Schüler einerseits durch methodische Abwechslung und angemessene Unterrichtsinhalte in Form von Plan- und Rollenspielen, aber auch in außerschulischen Lernorten wie Betrieben, Organisationen etc. an die praktische Arbeitswelt herangeführt werden sollen. Dieser Praxisbezug soll auch in der Lehrerausbildung ausgebaut werden, durch verpflichtende Betriebspraktika und anderweitige Praxiserfahrungen in der Arbeitswelt, dies jedoch lediglich als Ergänzung zu einer in erheblichem Umfang ausgebauten fachwissenschaftlichen Ausbildung im Bereich Wirtschaft. Diese soll auch nach der eigentlichen Ausbildung konsequent im Rahmen von Weiterbildungen fortgeführt werden.
Das Memorandum endet mit dem Verweis auf die seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule, zumindest nach Meinung der Arbeitgeberverbände. Diese Kooperation findet ihren Ausdruck in verschiedenen Projekten wie zum Beispiel in einer Reihe von Informationsveranstaltungen, Seminaren, aber auch Betriebserkundungen und –praktika sowie zur Verfügung gestelltes Unterrichtsmaterial in allen möglichen Formen. Nach Meinung der Arbeitgeberverbände tragen damit „… Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsorganisationen wesentlich dazu bei, den Schülern aktuelle Informationen und praxisnahe Zugänge zur Wirtschafts-, Arbeits- und Berufswelt zu eröffnen“ (BDA 1998, S. 6).
3.1.2. Schulfach Ökonomie – das Memorandum des Deutschen Aktieninstituts
Das unter Punkt 2.2.2 erörterte Memorandum war nur eine von vielen Veröffentlichungen und Kommuniqués der Wirtschaftsverbände, die im Rahmen einer anvisierten Erweiterung der ökonomischen Bildung in Schulen publiziert wurden. So veröffentlichte beispielsweise der Bundesverband der Deutschen Banken einen Artikel (von Rosen 1999, S. 698-702), der sich inhaltlich sehr nahe an das Memorandum anlehnt und die Forderungen bekräftigt. Verantwortlich für den Artikel zeichnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI). Dessen Ziele sind: „Die Stärkung Deutschlands als Standort für Finanzdienstleistungen durch Verbesserung der Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen im internationalen Vergleich sowie die Förderung der Aktie als attraktives Instrument der Unternehmensfinanzierung und rentable Form der Geldanlage sind Anliegen und Aufgabe des Deutschen Aktieninstituts. Seine Mitglieder sind börsennotierte Gesellschaften sowie andere an der Entwicklung der Kapitalmärkte interessierte Unternehmen und Institutionen“ (DAI 2012). Der von Rüdiger von Rosen, dem geschäftsführenden Vorstand des DAI, verfasste Artikel stellt allerdings einen in der Hauptsache an die Fachpresse gerichteten Beitrag dar. Von Rosen wirbt im Lager des Finanzmarktes um Unterstützung für das Projekt, das er kurze Zeit später in Form eines Memorandums in die öffentliche Diskussion über eine erweiterte ökonomische Bildung an Schulen einbringt.
Dieses sehr detaillierte Memorandum wurde im Oktober 1999 veröffentlicht, also rund ein Jahr nach dem Erscheinen des Memorandums der Deutschen Arbeitgeberverbände. Er hat in Zusammenarbeit mit vornehmlich Wirtschaftspädagogen ein umfangreiches und ausgearbeitetes Positionspapier verfasst, dass für die Einführung eines eigenen Schulfachs Ökonomie plädiert.
Zunächst stellt von Rosen in dem ersten inhaltlichen Teil des Memorandums die Bedeutung von Bildung im Allgemeinen heraus und welchem Zweck sie dienen soll. „Bildung wird in diesem Memorandum als die Ausstattung des Individuums mit jenen Kenntnissen, Fähigkeiten, Einsichten und Werthaltungen verstanden, die es befähigen, seine eigene individuelle und soziale Identität zu entwickeln und jene Situationen erfolgreich zu bewältigen, mit denen es privat, beruflich und öffentlich konfrontiert wird“ (DAI 1999). Im Kontext dieser Arbeit ist von besonderer Bedeutung, der in diesem Zusammenhang erstmals erwähnte Terminus des Sachzwangs. „Da diese Anforderungen und Herausforderungen zu einem hohen Anteil aus ökonomischen Sachzwängen herrühren, hängen die Chancen der persönlichen Entfaltung vornehmlich davon ab, wie man lernt, rational mit diesen umzugehen…“ (DAI 1999). Der Sachzwang wird hier bereits als starkes Argument angeführt, denn offensichtlich gehen einige Aufgaben, vor die die Schüler gestellt werden, auf ihn zurück. Im weiteren Verlauf wird die Befähigung zur Teilnahme am wirtschaftlichen Leben als elementar für die individuelle Selbstverwirklichung hervorgehoben. Darüber hinaus sind allgemeine Grundkenntnisse notwendig, „… um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Existenz überhaupt verstehen zu können“ (ebd.). Dass bedeutet, auch in diesem Memorandum wird zunächst die Fähigkeit der Partizipation an der Gesellschaft in den Vordergrund gestellt. Allerdings wird hier sehr viel fokussierter auf die ökonomische Komponente Bezug genommen.
Im weiteren Verlauf geht das Memorandum zunächst auf die konkrete Situation an den Schulen ein. Es wird ausgeführt, dass zum einen der Anteil an ökonomischer Bildung viel zu niedrig sei und zum anderen in vielen Fällen lediglich als Teilbereich in anderen Fächern (mit)behandelt werde, zum Beispiel in Mathematik oder Geschichte. Das DAI stellt fest, dass ökonomische Sachverhalte in einem solchen Umfeld nicht adäquat behandelt werden könnten. Dies liege nicht nur an der Fragmentierung durch die Aufspaltung auf verschiedene Fächer, sondern in weiten Teilen auch an der mangelnden, da fachfremden Ausbildung der Lehrer. Dadurch ließen sich die besonderen Anforderungen an einen ökonomischen Unterricht nicht bewerkstelligen. Diese Anforderungen sind nach Meinung des DAI ein „… breites Verständnis sozialer, ökonomischer, politischer und technischer Zusammenhänge; … Denken in übergreifenden, komplexen Strukturen; … kognitive Fähigkeiten der Wissensanwendung in unterschiedlichen Kontexten; … metakognitive Fähigkeiten der Selbststeuerung des Lernens und … Kommunikations- und Teamfähigkeiten unter Einschluss von Empathie“ (DAI 1999). Der Ökonomieunterricht eignet sich nach Meinung des DAI dafür besonders gut. Dies setze allerdings voraus, dass adäquate Methoden, die eher im Bereich der komplexen Lehr-Lern-Arrangements anzusiedeln sind, Prozesse der wachsenden Selbststeuerung sowie Selbstorganisation begünstigen, wie z. B. Planspiele, Übungsfirmen oder Verwaltungssimulationen.
Im Hauptteil des Memorandums wird hauptsächlich die Notwendigkeit einer eigenen Fachdidaktik sehr detailliert hergeleitet und begründet. Hierbei folgt das Papier dem Schema des BDA, dass zunächst der Kompetenzerwerb der Schüler im Vordergrund steht, fokussiert auf ökonomische Fragestellungen. Eine Fachdidaktik, mit der sich ein solches Ziel erreichen lässt, „… hat dies in Auseinandersetzung mit den herrschenden Paradigmen der fachwissenschaftlichen Disziplinen zu bewerkstelligen. Sie muss permanent hinterfragen, inwieweit das herrschende fachwissenschaftliche Paradigma eine bestimmte Sichtweise, ein bestimmtes Deutungsmuster von Welt nahelegt und dabei andere behindert, verhindert oder gar unterdrückt“ (DAI 1999). Doch neben einer Fähigkeit zur kritischen Beurteilung des gesellschaftlichen bzw. ökonomischen Systems gibt es auch aus Sicht des DAI ein begründetes Eigeninteresse aus Schülersicht, denn in „… der heutigen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft vollzieht sich die Identitätsbildung des Einzelnen wesentlich über seine Integration in das Wirtschafts- und Beschäftigungssystem“ (ebd.). Das DAI gibt in der Folge eine ziemlich präzise Beschreibung der Themen, die im Rahmen des Schulfachs Ökonomie behandelt werden sollten. Sie umfassen alle Ebenen des wirtschaftlichen Handelns, die Mikro-, Meso- und Makroebene. Darüber hinaus ist für „… das Verständnis dieser Inhaltsfelder und das Verhalten der Akteure im Wirtschaftsgeschehen … die Kenntnis des Regel- und Institutionengefüges einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erforderlich, d. h. derjenigen Regeln und Institutionen (Koordinationsmechanismen, Organisationen, Werte, Normen, Gesetze), die das wirtschaftliche Geschehen einer Volkswirtschaft und das Verhalten der einzelnen Akteure bestimmen“ (ebd.). Folgerichtig umfasst der zu behandelnde Themenkatalog auch den gesamten wirtschaftspolitischen Bereich, inkl. der Behandlung der wirtschaftspolitischen Gesamtkonzeptionen auch auf historischer Ebene, wie z. B. Merkantilismus, klassischer Liberalismus, wissenschaftlicher Sozialismus, Interventionismus, usw. Darüber hinaus werden die internationalen Wirtschaftsbeziehungen behandelt, beispielsweise mit den Themen Leitbilder des internationalen Handels, regionale Ordnungssysteme (EU, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) oder globale Ordnungssysteme (z. B. Währungsordnung im IWF, Handelsordnung in der WTO oder Umweltordnung und internationale Entwicklungszusammenarbeit) (vgl. ebd.). Abschließend bekräftigt der DAI in einer Zusammenfassung die Notwendigkeit eines eigenen Schulfachs Ökonomie sowie die Einführung eines gesonderten Lehramtsstudiengangs für das Fach Ökonomie.
3.1.3. Positionspapier der Deutschen Vereinigung für politische Bildung
In die Diskussion eingeschaltet hat sich im April 2000 der Bundesverband der Deutschen Vereinigung für politische Bildung (e. V.) mit dem Positionspapier „Wirtschaftslehre in der politischen Bildung“ (DVPB 2000). Der Eigendarstellung des Vereins ist zu entnehmen: „Die DVPB vertritt entschieden die Notwendigkeit eines speziellen Unterrichtsfachs für Politische Bildung – es mag „Politik“, „Sozialkunde“ oder anders genannt werden –, dass sich auf sozialwissenschaftliche Disziplinen (Politische Wissenschaft, Ökonomie, Soziologie usw.) als Bezugswissenschaften stützt. Sie versteht sich daher ausdrücklich auch als Fachverband der Fachlehrerinnen und Fachlehrer eines solchen Fachs“ (DVPB 2011). Somit ist die Position der DVPB eindeutig, da ein integrativer Ansatz eines der konstituierenden Elemente des Vereins ist.
In dem von ihr herausgegebenen, sehr kurzen, Positionspapier, wird dies anhand einiger weniger Forderungen deutlich gemacht. „Eine Einführung eines weiteren Schulfaches Wirtschaftslehre darf auf keinen Fall auf Kosten der Kernfächer der Politischen Bildung (je nach landestypischen Bezeichnungen: Politik, Sozialkunde, Sozialwissenschaften usw.) gehen“ (DVPB 2000). Darüber hinaus soll der integrative Ansatz der Politischen Bildung, mit den Teilbereichen Politikwissenschaften, Soziologie und Ökonomie, erhalten werden. Ebenso sollte für die Lehramtsausbildung verfahren werden und die Ökonomie sei als integrativer Bestandteil in die Studiengänge zu implementieren. „Eine Verschärfung der Disziplinarität wäre dagegen kontraproduktiv“ (ebd.). Der integrative Ansatz soll vor einer Dominanz der Wirtschaft schützen und immer auf deren Gestaltbarkeit durch Politik und Gesellschaft verweisen. Ebenso sollen durch ihn eindimensionale Betrachtungsweisen vermieden werden, die z. B. Folgewirkungen von ökonomischem Handeln, wie es der DAI propagiert, außer Acht lassen.
Nur unter diesen Voraussetzungen ist die ausdrücklich von der DVPB begrüßte Verstärkung von ökonomischer Bildung aus ihrer Sicht akzeptabel.
3.1.4. Stellungnahme der Lehrerverbände – das Memorandum „Ökonomische Grundbildung ist Teil der Allgemeinbildung“
Die Forderungen der Wirtschaft fanden aber nicht nur Befürworter in naheliegenden Interessenlagern, sondern auch in Verbänden und Organisationen, die man nicht zwingend einer ähnlichen politischen Ausrichtung zuordnen würde. So hat beispielsweise der Deutsche Lehrerverband (DL) in einer im Mai 2000 veröffentlichten Stellungnahme (DL 2000) ebenfalls einen Ausbau der ökonomischen schulischen Ausbildung gefordert. Die Forderungen des Lehrerverbands wählen eine klar makroökonomische Ausrichtung, zumindest nach eigenen Angaben (vgl. ebd.). Inhaltlich sind die Forderungen mit denen des BDA und des DAI in den meisten Punkten identisch, sowohl in der Wahl der Themen als auch in Bezug auf Methodenvielfalt sowie eine größere Praxisorientierung. Allerdings sind diese bei Weitem nicht so konkret ausgearbeitet wie bei von Rosen, wie auch das ganze Papier nur einen Bruchteil des Umfangs der Stellungnahme des DAI ausmacht. Aufgrund des hohen Anteils der inhaltlichen Übereinstimmung, werde ich lediglich auf die Besonderheiten des Memorandums „Ökonomische Grundbildung ist Teil der Allgemeinbildung“ eingehen. Trotz einer Reihe von Übereinstimmungen in den Forderungen bezüglich der notwendigen praktischen Ausgestaltung eines ökonomischen Unterrichts kommt der Deutsche Lehrerverband (DL) in einem wichtigen Punkt zu einem anderen Ergebnis. Er plädiert dafür, dass die Vermittlung ökonomischer Kenntnisse interdisziplinär, im Falle der allgemeinbildenden Schulen bedeutet dies fächerübergreifend, realisiert werden soll. „Um eine Atomisierung der ökonomischen Grundbildung vorzubeugen, ist die Abstimmung der Curricula über alle Fächer und Jahrgangsstufen hinweg sowie die Abstimmung der Lehrer einer Klasse unverzichtbar. Eine flankierende Aufgabe kommt den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Religion/Ethik sowie Mathematik und den Naturwissenschaften zu“ (DL 2000). Dies soll mit einem Stundenumfang von 200 Unterrichtsstunden realisiert werden, so der Vorschlag des DL. Wie bereits angedeutet, liegen die Forderungen bezogen auf den zu behandelnden Inhalt im Rahmen einer ökonomischen Bildung, deren methodische Umsetzung sowie eine adäquate Anpassung der Lehrmittel, sehr nah beieinander.
Grundlegende Unterschiede gibt es in der Argumentation. Auch der DL stellt eine ökonomische Grundbildung als notwendige Voraussetzung für eine gesellschaft-liche Partizipation, sowie den Mensch als „homo politicus“ (DL 2000), in den Mittelpunkt. Allerdings sind die „… ordnungspolitischen Rahmenbedingungen eines ökonomischen Systems … Ausdruck des jeweils kulturell bestimmten Verständnisses vom Bild des Menschen sowie seiner Gesellschaften und seiner Staatsformen“ (DL 2000). Durch die Definition, dass das Wirtschaftssystem lediglich den gesellschaftlich gewählten und festgelegten Ausgestaltungen folgt, ist dieses unter die Deutungshoheit der Politik subsumiert. Als Argument dafür führt der DL an, dass sich Deutschland „… nach dem Krieg, als vereintes Deutschland ab 1990 für die Soziale Marktwirtschaft entschieden [hat]. Diese Wirtschaftsordnung ist sowohl hinsichtlich des Markt- und Eigentumsgedankens als auch hinsichtlich der Sozialpflichtigkeit des Eigentums grundgesetzlich garantiert. Hinter diesen Gedanken wiederum stehen Prinzipien der Eigenverantwortung, der Subsidiarität und der Solidarität “ (ebd.). Diese Prinzipien sieht der DL als Richtschnur für die ökonomische Bildung, die „… damit zugleich ein Beitrag zur Erziehung zur Demokratie...“ (ebd.) ist.
Direkt im anschließenden Teil ändert sich die Art und Weise der Argumentation. Der bis dahin neutrale Tonfall ändert sich im Fortlauf des Papiers. Der DL stellt deutlich heraus, dass die oben angeführten Prinzipien unserer Gesellschaft zu Problemlagen geführt haben. Zunächst gilt es ihrer Meinung nach „… klarzumachen, dass Staat und Gesellschaft unterschiedliche Sachverhalte sind“ (ebd.). Der DL stellt innerhalb der Gesellschaft Tendenzen fest, die dazu führten, „… dass der Staat an die Grenzen seiner Belastbarkeit gelangt [und nur noch] als allmächtige Sozialagentur… [und] …totaler Versorgungsstaat…“ (ebd.) fungiert. Dies führe zu einer „Vollkaskomentalität“ und daraus resultierend zu einer Entmündigung des Einzelnen sowie einer Unterminierung der Eigenverantwortlichkeit. Insgesamt ist dieser Abschnitt des Memorandums gespickt mit sehr blumigen adjektivischen Beschreibungen, die alle das Abhängigkeitsverhältnis des Bürgers zum Staat thematisieren. Aus diesem Grund sieht der DL die Notwendigkeit gegeben, die ökonomische Grundbildung in erster Linie makroökonomisch auszurichten. Dies soll die Einsichten fördern bezüglich der Notwendigkeit einer leistungsfähigen Marktwirtschaft, dass „ … der Staat keine sozialen Breitband-Therapeutika parat haben kann [und], … dass er … nicht Glückslieferant sein kann, sondern subsidiär nur „Ermöglicher von Glück“ (DL 2000).
Bezüglich des Sachzwangs von Bedeutung ist die als Begründung angeführte „ … vor dem Hintergrund der Globalisierung immer höhere Veränderungsdynamik beruflicher Anforderungen. …Weil zukünftig ein erheblich größerer Anteil der Berufstätigen selbstständig als Unternehmer tätig sein wird, gehört es zur ökonomischen Grundbildung, diese Form der Erwerbstätigkeit bereits schulisch besonders hervorzuheben“ (ebd.). Nur so sieht der DL eine mündige Teilhabe am Wirtschaftssystem gewährleistet.
3.1.5. Erstes Ergebnis der öffentlichen Auseinandersetzung – die gemeinsame Stellungnahme der Interessenverbände
Eine der gewichtigsten Stellungnahmen stellt das Memorandum „Wirtschaft – notwendig für schulische Allgemeinbildung“ (GI/BDA/DGB 2000) dar. Für dieses haben sich gleich eine ganze Reihe von Verbänden gemeinsam verantwortlich gezeichnet. Auf Initiative des BDA und des Deutschen Gewerk-schaftsbundes (DGB) wurde das Grundsatzpapier in Zusammenarbeit mit dem Elternverband und dem Verband deutscher Realschullehrer ausgearbeitet. Damit schließt das Memorandum einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung zu einem Interessenverband zusammen, der dadurch ein ganz erhebliches Gewicht erhält. Bemerkenswert ist, dass sich diesem Papier nicht der gesamte DL angeschlossen hat, der damit zumindest teilweise seine Ansicht untermauert, dass ökonomische Bildung interdisziplinär in den bisher bestehenden Fächern unterrichtet werden sollte.
Auch in dieser öffentlichen Stellungnahme werden die Persönlichkeitsentwicklung und der Erwerb von Kompetenzen in den Mittelpunkt gestellt, die es ermöglichen sollen, im Rahmen eines selbstbestimmten Lebens Entscheidungen für den eigenen Lebensverlauf zu treffen. Allerdings hebt die Stellungnahme den reflexiven Charakter, den ökonomische Bildung haben sollte, besonders deutlich hervor. Dass dies durchaus eine andere Akzentuierung und Gewichtung hat, als zum Beispiel die Stellungnahme des DAI wird deutlich gemacht, durch die konsequente Verwendung des Terminus der sozioökonomischen Bildung anstelle von ökonomischer Bildung. Was darunter genau zu verstehen ist, wird nicht explizit, sondern über deren Aufgaben definiert. Die sozioökonomische Bildung soll ökonomische, soziale, ethische, politische, rechtliche, ökologische und technische Zusammenhänge behandeln und zur Reflexion über eigene Wertvorstellungen und gesellschaftliche Sachverhalte befähigen (vgl. GI/BDA/DGB 2000).
Unter der Perspektive der Sachzwänge ist der Verweis auf sich verändernde Verhältnisse von Bedeutung. So heißt es im Memorandum: „Sozioökonomische Bildung wird umso wichtiger, als die Arbeitsteilung und die damit verbundene Komplexität unseres Wirtschaftslebens ebenso zunehmen wie die Herausforderungen durch ein zusammenwachsendes Europa und die Globalisierung“ (ebd.). Auch hier wird wieder Bezug genommen auf die Notwendigkeit durch äußere Einflüsse. Ein Alleinstellungskriterium dieser Stellungnahme ist die deutliche und vor allem zielgerichtet adressierte Aufforderung zur Umsetzung der Vorschläge. Deutlich im Text hervorgehoben fordern die Verbände ganz gezielt „… die Kultusminister auf, diesen Vorschlag [die Erweiterung der ökonomischen Bildung und die Einführung eines gesonderten Schulfachs Wirtschaft] in ihren Ländern umzusetzen“ (ebd.). In dieser Nachdrücklichkeit und Direktheit wurden Forderungen im Hinblick auf eine stärkere Gewichtung von ökonomischer Bildung in der Schule beziehungsweise bezüglich der Einführung eines gesonderten Schulfachs Ökonomie noch nicht in die öffentliche Diskussion eingebracht.
Darüber hinaus wird die Teilhabe an dem Wirtschaftssystem als grundlegend für das mündige Realisieren eigener Bedürfnisse herausgestellt. Die eigenen „… Persönlichkeitsvorstellungen und seine Individualität wird [der Schüler] … vor allem dann realisieren, wenn er dafür Anerkennung durch andere bzw. durch das gesellschaftliche Werte- und Normensystem erhält. … Zentrales Handlungsfeld für die Persönlichkeitsentwicklung aber ist die Erwerbstätigkeit“ (ebd.). Die zweite tragende Säule sei „… neben der Erwerbsarbeit … auch die identitätsstiftende Funktion des Konsums … In unserer pluralisierten und zugleich individualisierten Lebenswelt dient dieser immer häufiger als Ausdrucksmittel für individuelle Vorstellungen, Lebenshaltungen, Gruppenzugehörigkeit und soziale Position“ (GI/BDA/DGB 2000).
Auch das ambivalente Verhältnis zwischen Unternehmer- und Arbeitnehmerinteressen soll zentraler Gegenstand des sozioökonomischen Unterrichts sein. Denn obwohl dieses in der Marktwirtschaft weder Vollbeschäftigung oder die Garantie auf einen Arbeitsplatz garantiert, der den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht, habe es „… umwälzende persönlichkeitsfördernde gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht. Es kam in einem Umfang zu realen Einkommenssteigerungen, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzungen, Ausweitung der sozialen Sicherung, Ausbau des allgemeinbildenden und beruflichen Bildungssystems sowie des Hochschulsektors, der noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts unvorstellbar war“ (GI/BDA/DGB 2000).
Es wird aber auch deutlich artikuliert, dass die Schüler „… befähigt werden [müssen] zur Reflexion eigener Wertvorstellungen, Interessen und Gesellschaftsbilder und zur rationalen Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Sachverhalten und deren Folgen“ (ebd.). Allerdings macht diese explizite Aussage bezüglich der Konsequenzen wirtschaftlichen Handelns nur einen sehr kleinen Bruchteil des Memorandums aus. Es wird deutlich, dass der Fokus klar auf der Realisierung der Eigeninteressen der Schüler liegt.
Die Begründung eines eigenen Unterrichtsfachs basiert hauptsächlich aus dem Argument des notwendigen kumulativen Erkenntnisgewinns, der bei einer punktuellen fächerübergreifenden Behandlung nicht möglich ist. Auch in puncto Lehrerausbildung wird eine Aneignung der notwendigen Kenntnisse als nicht angemessen realisierbar erachtet. Die Ziele des Unterrichts erinnern stark an die einige Jahre später in Kraft gesetzten fachübergreifenden Kompetenzen: Sachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. Die Sachkompetenz soll die oben skizzierte Teilhabe am Arbeits- und Wirtschaftsgeschehen ermöglichen, mit der Methodenkompetenz soll den Schülern die Fähigkeit zur Analyse von Zusammenhängen ermöglicht werden und die Sozialkompetenz soll dazu befähigen, ökonomische Sachverhalte kontrovers zu beurteilen. Hierbei sollen „… Toleranz für andere Wertorientierungen und Interessen sowie Kompromissfähigkeit gefördert werden“ (GI/BDA/DGB 2000).
Diese Sozialkompetenz muss allerdings vom Lehrer eigenverantwortlich in die jeweiligen inhaltlichen Teilbereiche integriert werden, ein gesonderter Inhaltsbereich, der sich ausschließlich mit Fragen der theoretischen Reflexion oder alternativen Möglichkeiten innerhalb und außerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems beschäftigt, ist nicht vorgesehen. Waren in den bisherigen Entwürfen, z. B. vom DL, noch die vergleichende Beschäftigung mit verschiedenen Modellen ausdrücklich implementiert, ist dies in diesem Memorandum im Rahmen des angestrebten Fachs Ökonomie nicht vorgesehen. Prinzipiell fällt auf, dass politische Sachverhalte nur behandelt werden, wenn sie unmittelbar mit dem Wirtschaftssystem zusammenhängen. Die Trennung zwischen Politik und Wirtschaft wurde hier sorgfältig vorgenommen.
Im Hinblick auf die Unterrichtsmethoden und die Lehrerausbildung folgt man der Linie des DAI und fordert ebenfalls eine Lehrstoffvermittlung anhand von praktischen Projekten sowie einen starken Alltagsbezug und einen gesonderten Studiengang für das Fach Ökonomie.
[...]
[1] „Ein beliebtes Beispiel für den Fall, dass Daten korrelieren, ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen Daten besteht, ist der zu beobachtende gleichzeitige Rückgang der Zahl der Störche und der Geburten.“ (Nissen 2002, S. 26)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783842835115
- Dateigröße
- 546 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main – Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (März)
- Note
- 1,3
- Produktsicherheit
- Diplom.de