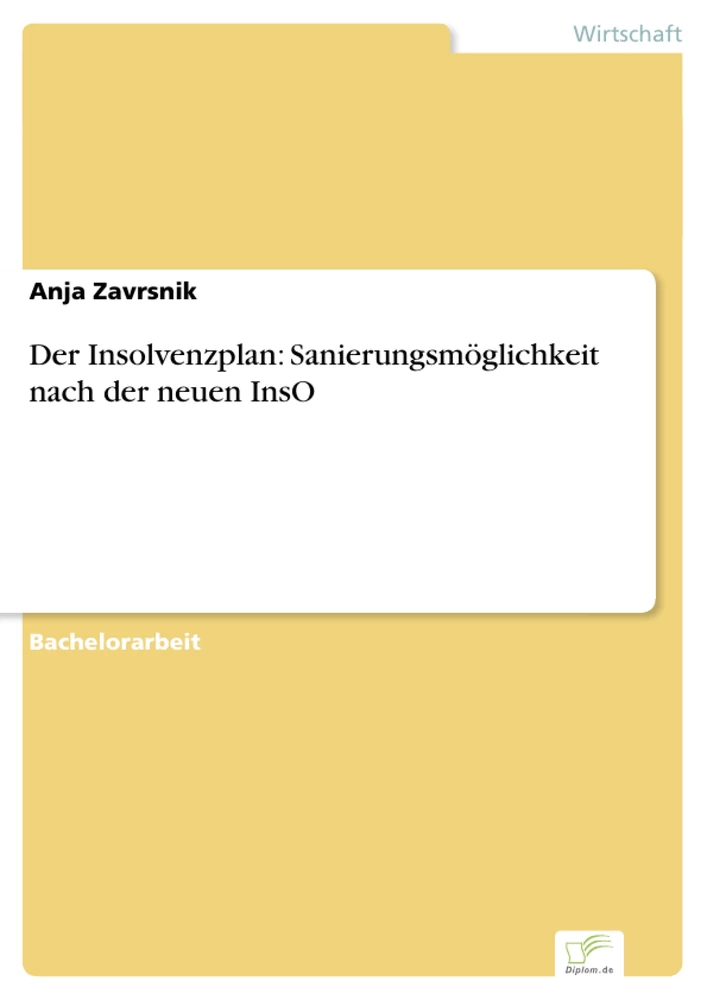Der Insolvenzplan: Sanierungsmöglichkeit nach der neuen InsO
©2011
Bachelorarbeit
77 Seiten
Zusammenfassung
Einleitung:
Krisendefinition und Krisenarten:
Eine allgemeingültige Definition für den Begriff der Unternehmenskrise ist bislang noch nicht gefunden worden. Jedoch gehen fast alle Definitionsversuche von den gleichen Inhalten aus. In seinem altgriechischen Ursprung steht das Wort ‘krisis’ für eine entscheidende Wendung bzw. für eine schwierige Sachlage oder gefährliche Situation. Übertragen auf die betriebswirtschaftliche, bzw. auch juristische Sichtweise bedeutet die Krise für ein Unternehmen einen existenzgefährdenden Zustand. Dieser Zustand entsteht aus einem ‘ungewollten Prozess, in dessen Verlauf sich die Erfolgspotenziale, das Reinvermögen oder die Liquidität so ungünstig entwickelt haben, dass eine akute Bedrohung für das Unternehmen besteht’. Die wesentlichen strategischen und operativen Ziele können nicht mehr wahrgenommen werden und die Interessen der Stakeholder sind gefährdet. Nach dem Insolvenzrecht lässt sich die Krise als Eintritt der Insolvenzantragsvoraussetzungen gem. §§ 17 bis 19 Insolvenzordnung (InsO) definieren.
Nach IDW S 6 können fünf Krisenarten unterschieden werden, die sich im Laufe der Zeit immer weiter zuspitzen.
Die Stakeholderkrise entsteht durch dauerhafte Konflikte zwischen den Mitgliedern der Unternehmensleitung und der Überwachungsorgane, der Gesellschafter, der Arbeitnehmer, der Banken oder anderen Gläubigern. Diese Konflikte beeinflussen das Führungsverhalten und führen zu Reibungsverlusten oder auch zu Blockaden und verhindern dadurch wichtige Entscheidungen.
In der Strategiekrise sind die langfristigen Erfolgspotenziale des Unternehmens aufgebraucht, ohne dass rechtzeitig für Nachfolgeprodukte gesorgt wurde. Gründe können im verpassten technologischen Fortschritt, unklare oder fehlende strategische Ausrichtung des Unternehmens oder in der nachhaltigen Fehleinschätzung der Markt- und Wettbewerbssituation liegen. Die Produkt- und Absatzkrise entsteht als Folge der Strategiekrise und ist durch Nachfragerückgang nach den Hauptumsatz- und Erfolgsträgern gekennzeichnet. Daraus resultieren steigende Vorratsbestände und somit auch eine erhöhte Kapitalbindung. Weitere Gründe können in einer falschen Preispolitik, in Qualitätsschwächen, in unzureichender Liefertreue oder auch in einem nicht ausreichenden Marketing- und Vertriebskonzept liegen.[...]
Krisendefinition und Krisenarten:
Eine allgemeingültige Definition für den Begriff der Unternehmenskrise ist bislang noch nicht gefunden worden. Jedoch gehen fast alle Definitionsversuche von den gleichen Inhalten aus. In seinem altgriechischen Ursprung steht das Wort ‘krisis’ für eine entscheidende Wendung bzw. für eine schwierige Sachlage oder gefährliche Situation. Übertragen auf die betriebswirtschaftliche, bzw. auch juristische Sichtweise bedeutet die Krise für ein Unternehmen einen existenzgefährdenden Zustand. Dieser Zustand entsteht aus einem ‘ungewollten Prozess, in dessen Verlauf sich die Erfolgspotenziale, das Reinvermögen oder die Liquidität so ungünstig entwickelt haben, dass eine akute Bedrohung für das Unternehmen besteht’. Die wesentlichen strategischen und operativen Ziele können nicht mehr wahrgenommen werden und die Interessen der Stakeholder sind gefährdet. Nach dem Insolvenzrecht lässt sich die Krise als Eintritt der Insolvenzantragsvoraussetzungen gem. §§ 17 bis 19 Insolvenzordnung (InsO) definieren.
Nach IDW S 6 können fünf Krisenarten unterschieden werden, die sich im Laufe der Zeit immer weiter zuspitzen.
Die Stakeholderkrise entsteht durch dauerhafte Konflikte zwischen den Mitgliedern der Unternehmensleitung und der Überwachungsorgane, der Gesellschafter, der Arbeitnehmer, der Banken oder anderen Gläubigern. Diese Konflikte beeinflussen das Führungsverhalten und führen zu Reibungsverlusten oder auch zu Blockaden und verhindern dadurch wichtige Entscheidungen.
In der Strategiekrise sind die langfristigen Erfolgspotenziale des Unternehmens aufgebraucht, ohne dass rechtzeitig für Nachfolgeprodukte gesorgt wurde. Gründe können im verpassten technologischen Fortschritt, unklare oder fehlende strategische Ausrichtung des Unternehmens oder in der nachhaltigen Fehleinschätzung der Markt- und Wettbewerbssituation liegen. Die Produkt- und Absatzkrise entsteht als Folge der Strategiekrise und ist durch Nachfragerückgang nach den Hauptumsatz- und Erfolgsträgern gekennzeichnet. Daraus resultieren steigende Vorratsbestände und somit auch eine erhöhte Kapitalbindung. Weitere Gründe können in einer falschen Preispolitik, in Qualitätsschwächen, in unzureichender Liefertreue oder auch in einem nicht ausreichenden Marketing- und Vertriebskonzept liegen.[...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Zavrsnik, Anja: Der Insolvenzplan: Sanierungsmöglichkeit nach der neuen InsO,
Hamburg, Diplomica Verlag GmbH 2014
PDF-eBook-ISBN: 978-3-8428-4042-3
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2014
Zugl. Fachhochschule Augsburg, Augsburg, Deutschland, Bachelorarbeit,
September 2011
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
©
Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2014
Printed in Germany
2
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ... 3
1
DIE UNTERNEHMENSKRISE ... 5
1.1
Krisendefinition und Krisenarten
... 5
2
HISTORISCHE HINTERGRÜNDE ZUM INSOLVENZPLANVERFAHREN . 6
2.1
Vergleich und Zwangsvergleich nach Konkursordnung
... 6
2.2
Begriff und Rechtsnatur des Insolvenzplans
... 10
2.3
Zweck des Insolvenzplanverfahrens
... 11
3
INHALT DES INSOLVENZPLANS ...12
3.1
Arten von Insolvenzplänen
... 12
3.1.1
Sofortige Zerschlagung
... 12
3.1.2
Übertragende Sanierung
... 12
3.1.3
Sanierung des Unternehmesträgers
... 14
3.2
Der darstellende Teil
... 14
3.3
Der gestaltende Teil
... 15
3.4
Plananlagen
... 17
4
ABLAUF DES PLANVERFAHRENS ...18
4.1
Planinitiative
... 18
4.2
Annahme des Plans
... 19
4.2.1
Vorprüfung durch das Insolvenzgericht
... 19
4.2.2
Erörterungs- und Abstimmungsverfahren
... 19
4.2.3
Stimmrechte der Gläubiger
... 20
4.2.4
Erforderliche Mehrheiten
... 21
4.2.5
Obstruktionsverbot und Minderheitenschutz
... 21
4.2.6
Zustimmung des Schuldners
... 22
4.3
Gerichtliche Bestätigung des Plans
... 22
4.4
Rechtswirkungen des bestätigten Plans
... 23
4.4.1
Allgemeine Wirkung nach § 254 InsO
... 23
4.4.2
Wiederauflebensklausel
... 24
4.4.3
Vollstreckung aus dem Plan
... 24
4.4.4
Aufhebung des Verfahrens
... 25
3
4.4.5
Überwachung der Planerfüllung
... 25
5
DAS SANIERUNGSKONZEPT...26
5.1
Sanierungsbegriff
... 26
5.2
Sanierungsfähigkeit
... 27
5.2.1
Die Fortführungsprognose
... 27
5.2.2
Die Unternehmesanalyse
... 28
5.2.2.1
Darstellung der wirtschaftlichen Ausgangslage
... 28
5.2.2.2
Umfeldanalyse
... 28
5.2.2.3
Branchenentwicklung
... 29
5.2.2.4
Analyse der internen Unternehmensverhältnisse
... 32
5.2.2.5
Leitbild und strategische Neuausrichtung
... 36
5.2.2.6
Insolvenzursachenanalyse und Lagebeurteilung
... 37
5.3
Sanierungsmaßnahmen
... 38
5.3.1
Bereits getroffene Maßnahmen
... 38
5.3.2
Noch zu ergreifende Sanierungsmaßnahmen
... 40
5.3.2.1
Finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen
... 40
5.3.2.1.1
Innerbetriebliche Maßnahmen
... 41
5.3.2.1.2
Außerbetriebliche Maßnahmen
... 42
5.3.2.2
Leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen
... 45
5.3.2.2.1
Forschung, Entwicklung und Qualitätsmanagement
... 46
5.3.2.2.2
Beschaffung
... 47
5.3.2.2.3
Produktion und Logistik
... 48
5.3.2.2.4
Vertrieb und Marketing
... 49
5.3.2.2.5
Finanzen und Controlling
... 50
5.3.2.2.6
Personal
... 51
5.3.2.2.7
Informationstechnik
... 53
5.4
Gruppenbildung und Beiträge
... 53
5.4.1
Taktiken der Gruppenbildung
... 53
5.4.2
Sanierungsbeiträge der Gruppen
... 56
5.4.3
Weitere Möglichkeiten der Gläubigerbeiträge
... 58
5.5
Vergleichsrechnung
... 59
6
ZUSAMMENFASSUNG ...61
7
SCHLUSSWORT ...64
ANLAGENVERZEICHNIS ...64
LITERATURVERZEICHNIS ...72
4
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Five Forces nach Porter... S. 29
Abbildung 2 Cash Flow... S. 33
Abbildung 3 Finanzkennzahlen... S.
34
Abbildung 4 Vermögenskennzahlen... S.
35
Abbildung 5 Wertschöpfungskette... S. 45
Abbildung 6 Verteilungsquote... S. 59
5
1 Die
Unternehmenskrise
1.1 Krisendefinition
und
Krisenarten
Eine allgemeingültige Definition für den Begriff der Unternehmenskrise ist bislang
noch nicht gefunden worden. Jedoch gehen fast alle Definitionsversuche von den
gleichen Inhalten aus. In seinem altgriechischen Ursprung steht das Wort ,,krisis"
für eine entscheidende Wendung bzw. für eine schwierige Sachlage oder
gefährliche Situation.
1
Übertragen auf die betriebswirtschaftliche, bzw. auch
juristische Sichtweise bedeutet die Krise für ein Unternehmen einen
existenzgefährdenden Zustand. Dieser Zustand entsteht aus einem ,,ungewollten
Prozess, in dessen Verlauf sich die Erfolgspotenziale, das Reinvermögen oder
die Liquidität so ungünstig entwickelt haben, dass eine akute Bedrohung für das
Unternehmen besteht".
2
Die wesentlichen strategischen und operativen Ziele
können nicht mehr wahrgenommen werden und die Interessen der Stakeholder
sind gefährdet.
3
Nach dem Insolvenzrecht lässt sich die Krise als Eintritt der
Insolvenzantragsvoraussetzungen gem. §§ 17 bis 19 Insolvenzordnung (InsO)
definieren.
Nach IDW S 6
4
können fünf Krisenarten unterschieden werden, die sich im Laufe
der Zeit immer weiter zuspitzen.
x Die
Stakeholderkrise entsteht durch dauerhafte Konflikte zwischen den
Mitgliedern der Unternehmensleitung und der Überwachungsorgane, der
Gesellschafter, der Arbeitnehmer, der Banken oder anderen Gläubigern.
Diese Konflikte beeinflussen das Führungsverhalten und führen zu
Reibungsverlusten oder auch zu Blockaden und verhindern dadurch
wichtige Entscheidungen.
x In der Strategiekrise sind die langfristigen Erfolgspotenziale des
Unternehmens aufgebraucht, ohne dass rechtzeitig für Nachfolgeprodukte
gesorgt wurde. Gründe können im verpassten technologischen Fortschritt,
unklare oder fehlende strategische Ausrichtung des Unternehmens oder
in der nachhaltigen Fehleinschätzung der Markt- und
Wettbewerbssituation liegen.
1 Andreas Crone in Crone 2010; S.2.
2 Andreas Crone in Crone 2010; S.2.
3 Hohberger 2006; S. 7.
4 IDW S 6: Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten
6
x Die
Produkt- und Absatzkrise entsteht als Folge der Strategiekrise und
ist durch Nachfragerückgang nach den Hauptumsatz- und Erfolgsträgern
gekennzeichnet. Daraus resultieren steigende Vorratsbestände und somit
auch eine erhöhte Kapitalbindung. Weitere Gründe können in einer
falschen Preispolitik, in Qualitätsschwächen, in unzureichender
Liefertreue oder auch in einem nicht ausreichenden Marketing- und
Vertriebskonzept liegen.
x Auf die bisher beschriebenen Krisen folgt zwangsläufig die Erfolgskrise.
Aufgrund nachhaltiger Verluste entsteht ein starker Gewinnrückgang bis
hin zum vollständigen Verzehr des Eigenkapitals. Das Unternehmen wird
zunehmend kreditunwürdiger, wobei sich aber eine Sanierung nicht mehr
ohne Zuführung frischen Kapitals erreichen lässt.
x In der Liquiditätskrise können fällige Zahlungsverpflichtungen kaum
mehr bedient werden und Kreditmöglichkeiten sind bereits ausgeschöpft.
Das Unternehmen ist in seiner Existenz gefährdet, wenn nicht
augenblicklich Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
x Bei einer sich zuspitzenden Liquiditätskrise kommt es zur
Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO und somit zur Insolvenzreife.
Unverzüglich, jedoch binnen drei Wochen müssen die Mitglieder des
Vertretungsorgans der juristischen Person einen schriftlichen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Insolvenzgericht
einreichen, § 15a i.V.m. § 13 InsO.
Die Sanierung des Unternehmens während der Insolvenz kann daraufhin im
Rahmen des Insolvenzplanverfahrens erfolgen.
2 Historische Hintergründe zum Insolvenzplanverfahren
2.1
Vergleich und Zwangsvergleich nach Konkursordnung
Das heutige Insolvenzrecht ist die Weiterentwicklung der Konkursordnung (KO)
von 1877. Der genaue Beginn der Entwicklung des Insolvenzrechts kann nicht
datiert werden, ist aber wie der Großteil unseres heutigen nationalen Rechts in
der Gesetzgebung des römischen Reiches zu finden.
5
Die Konkursordnung trat
1877 im deutschen Kaiserreich in Kraft, deren Vorbild die preußische
5 Keller 2006; S.10.
7
Konkursordnung von 1855 war.
6
Diese betrachtete insolvente Schuldner noch als
Straftäter und verhängte Gefängnisstrafen oder Ehrenstrafen.
7
1877 änderte sich
die Sichtweise zugunsten der Konkursschuldner. Jedoch waren
Sanierungsgedanken beinahe ausgeschlossen.
8
Durch den herrschenden
Wirtschaftsliberalismus, wonach nur der freie Markt über Ein- und Austritte der
Wirtschaftsteilnehmer entscheidet, war es dem Staat unmöglich insolvente
Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten.
9
Die Konkursordnung regelte lediglich die sogenannten Zwangsvergleiche
innerhalb des Konkursverfahrens nach §§ 173 ff. KO.
10
Zwangsvergleiche waren
Verträge zwischen Gemeinschuldnern und nicht bevorrechtigten
Konkursgläubigern über eine bestimmte, an Stelle der Konkursverteilung tretende
Befriedigung.
11
Die bevorrechtigten Gläubiger mussten nach § 191 KO im Vorfeld
voll befriedigt werden. Somit konnte sich der Schuldner seine Existenz erhalten
und eine Verschleuderung der Masse verhindern.
12
Da der Konkurs außerdem nach damals herrschendem deutschen Recht in viele
Einzelprozesse unterteilt war, erwies es sich für die Gläubiger als günstiger auf
die außergerichtliche Vereinbarung des Zwangsvergleiches auszuweichen.
Wählten die Beteiligten nicht den Weg des Zwangsvergleiches, mussten die
Konkursforderungen von jedem Gläubiger im Klageweg eingereicht werden.
Aufgrund der daraus resultierenden langen Verfahrensdauer wurde eine rasche
Befriedigung der Gläubiger unterlaufen. Somit wurde das Regelverfahren
künstlich in die Länge gezogen und trug nicht zur raschen Befriedigung der
Gläubigergemeinschaft bei.
13
Ebenso führte die rasche Versteigerung des Unternehmensinventars zu einer
,,nicht wünschenswerten Vernichtung von Werten"
14
, da Zwangsversteigerungen
meist Versteigerungen unter Wert sind und keinen adäquaten Gegenwert in die
zu verteilende Masse bringen.
6 Barre 2007; S. 48.
7 Pape 2010; S. 23.
8 Barre 2007; S. 48.
9 Barre 2007; S. 48.
10 Keller 2006; S. 21.
11 Vgl.: http://www.economia48.com/deu/d/zwangsvergleich/zwangsvergleich.htm, am 06.08.2011 um 13:56 Uhr.
12 Vgl.: http://www.economia48.com/deu/d/zwangsvergleich/zwangsvergleich.htm, am 06.08.2011 um 13:57 Uhr.
13 Absatz sinngemäß aus: Rechberger 2001; S. 1, TZ 2.
14 Hess, KO, 1993; S. 1341.
8
Zudem gingen manche Unternehmen lediglich durch eine allgemeine
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Konkurs, deren Besserung aber
absehbar war
15
und daher ein allgemeines Interesse, sowohl des Schuldners, als
auch der Gläubiger und des Staates darin bestand, dieses Unternehmen im
Wirtschaftskreislauf zu behalten. Zwar beinhaltete der Zwangsvergleich bereits
diesen Gedanken, jedoch hatte er die Konkurseröffnung und somit auch die
Bindung an die Konkursordnung als Voraussetzung.
16
Mit Inkrafttreten der Vergleichordnung (VerglO) am 05.07.1927 und Neufassung
am 26.02.1935 war es nun möglich, zahlungsunfähige Unternehmen
fortbestehen zu lassen.
17
Unter Vorlage eines konkreten Vergleichsvorschlags
konnte der Schuldner einen Antrag beim zuständigen Gericht zur Eröffnung des
Vergleichsverfahrens einreichen, um somit einen Konkurs abzuwenden.
18
Durch
die VerglO wurde vertrauenswürdigen Schuldnern in besonderen Situationen die
Möglichkeit eines Neustarts gewährt oder zumindest der entschuldete Rückzug
aus dem Wirtschaftsleben ermöglicht.
19
Das Regelwerk wurde aufgrund der
andauernden Rezession und Arbeitslosigkeit der 1920er Jahre eingeführt, um
Arbeitsplätze auch insolventer Unternehmen erhalten zu können.
20
Allerdings
beinhaltete die Vergleichsordnung auch große Mängel in betriebswirtschaftlichen
Bereichen.
21
Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 VerglO konnte der Schuldner nur dann
einen Antrag auf ein Vergleichsverfahren stellen, wenn ein Konkursgrund
vorlag.
22
Weiterhin musste der Vergleichsschuldner nach § 5 Abs. 1 VerglO in
einem Vergleichsstatus sämtliche Aktiva und Passiva darstellen und
gegenüberstellen, wobei die Gläubiger bei einem Fortführungsvergleich deutlich
höheres Interesse an einer Finanzplanrechnung gehabt hätten.
23
Außerdem
wurde die geringe Durchführung von Fortführungsvergleichen darin begründet,
dass § 7 VerglO eine Mindestquote von 35% für die Vergleichsgläubiger forderte
und die §§ 17, 18 VerglO strenge Anforderungen an die Vergleichswürdigkeit
eines Schuldners stellten.
24
Ingesamt wurden in Deutschland, zwischen 1935 und
15 Hess, KO, 1993; S. 1341.
16 Schmidt, KO, 1997; S.
577.
17
Keller, 2006; S.
21.
18 Keller, 2006; S. 21.
19
Barre, 2007; S. 49.
20
Barre, 2007; S. 49.
21 Pape 2010; S. 463.
22 Pape 2010; S. 463.
23 Pape 2010; S. 463.
24 Pape 2010; S. 463.
9
1998, gerademal bei 27.828 Unternehmen erfolgreiche Vergleichsverfahren ohne
Anschlusskonkurs durchgeführt.
25
Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck erwähnt in seinen Praxishinweisen zum neuen
Insolvenzrecht 1994 den ,,Konkurs des Konkurses"
26
. Gemeint ist damit, dass
sich der Konkurszweck geändert hat. 1877 diente die KO noch dazu schwache
oder nicht mehr selbständig lebensfähige Unternehmen auszusondern um somit
das Wirtschaftsleben an sich gesund zu erhalten und zu bereinigen. Nach der
großen Inflation und Massenarmut der 20er Jahre steuerte die
Vergleichsordnung dazu bei, dass einige Konkurse abgewendet werden konnten.
Jedoch konnte diese der Konkursflut und den Deckungsquoten von unter 5%
wegen des ,,wirtschaftlichem Null-Wachstums"
27
nach der Öl-Krise 1973/74 nicht
entgegenwirken. Daraufhin traten sozialstaatliche Überlegungen um Erhalt von
Arbeitsplätzen und der Sanierung von Unternehmen in den Vordergrund. Daher
wurde 1978 die Kommision für Insolvenzrecht zusammengerufen und eine
Reform der Konkursordnung diskutiert, bis eine neue Insolvenzordnung am
21.04.1994 vom Bundestag verabschiedet wurde.
28
Die am 01.01.1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung löste die Konkurs- und
Vergleichsordnung der alten Bundesländer und die
Gesamtvollstreckungsordnung
29
der neuen Bundesländer ab. Eine wesentliche
Neuerung des Insolvenzrechts war der Insolvenzplan. Dieser ersetzt die
ehemaligen Regelungen zum Zwangsvergleich nach der Konkursordnung (KO)
und zum Vergleich nach der Vergleichsordnung (VerglO)
30
und ist angelehnt an
das US-amerikanische Reorganisationsverfahren Chapter 11 US-Bankruptcy
Code von 1978
31
.
Chapter 11 dient dem amerikanischen Reorganisationsverfahren als rechtlicher
Rahmen für die Verhandlungen zwischen Schuldner und Gläubiger.
32
Es ist ein
25 Statistisches Bundesamt unter URL:
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Zeitreihen/LangeReihen/Insolvenzen/Conte
nt100/lrins01a,templateId=renderPrint.psml, am 06.08.2011 um 14:29 Uhr
.
26 Uhlenbruck, 1994; S.
19.
27 Uhlenbruck, 1994; S.
19.
28 Vgl.: Uhlenbruck, 1994; S. 19; und Andersch, Gritt in http://www.recht-im-tourismus.de/Ausbild/LektionInsolvenzI.html, 06.08.2011 um
14:42 Uhr.
29 ,,Die GesO löste 1976 die KO in der DDR ab. Sie war einfacher und leichter zu handhaben, hatte aber wegen der herrschenden
Planwirtschaft keine große Bedeutung." (Keller, 2006; S.
22.)
30 Allert 2007; S.
1.
31 Barre, 2007; S.
52.
32 Liebig, 2010; S. 152.
10
verwalterloses Verfahren, das vom Schuldner betrieben wird und, anders als in
der InsO, automatisch bei Antrag ohne erforderliche Eröffnungsgründe eröffnet
wird.
33
Zudem steht das schuldnerische Unternehmen im Vordergrund.
34
,,Gläubigerschutz" nach Chapter 11 bezeichnet den Schutz des Schuldners vor
Zugriffen seiner Gläubiger, wohingegen der Begriff ,,Gläubigerschutz" im
deutschen Recht den Schutz der Interessen der Gläubiger und die
Gläubigergleichbehandlung kennzeichnet. Identisch ist in beiden Verfahren der
Ablauf und die Grobstruktur, wie beispielsweise die Gruppenbildung nach
Gläubigerinteressen und das Obstruktionsverbot.
35
Zwar wurden einige Elemente des Verfahrens nach Chapter 11 in das deutsche
Insolvenzrecht mit einigen Änderungen übernommen, sie sind jedoch aufgrund
ihrer Ausgestaltung und Zielsetzung nicht ausreichend vergleichbar.
2.2
Begriff und Rechtsnatur des Insolvenzplans
Begriff
§ 217 InsO erlaubt die Aufstellung und Verwendung eines Insolvenzplans, der
von den gesetzlichen Regelungen der Insolvenzordnung abweichen darf. Er ist
die schriftliche Festlegung der Anspruchsverwirklichung der Gläubiger gegen den
Schuldner und kann vom Schuldner, vom Verwalter oder von allen Beteiligten
gemeinschaftlich aufgestellt werden.
36
Alle einvernehmlichen Änderungen in der
gewöhnlichen Insolvenzverfahrensdurchführung müssen festgehalten werden.
Somit ermöglicht der Insolvenzplan einen rechtlichen Rahmen zur
Insolvenzabwicklung neben dem gesetzlichen Regelverfahren, das in der Regel
für alle Teilnehmer günstiger ausfällt. Begrifflich kann man zwischen einem
Sanierungsplan, einem Übertragungsplan und einem Liquidationsplan
unterscheiden.
37
Die Beteiligten müssen sich auf die Insolvenzplanart einigen, die
ihnen am sinnvollsten erscheint.
Rechtsnatur
Über die Rechtsnatur des Insolvenzplans herrscht noch Uneinigkeit
38
, wie bereits
die Rechtsnatur der Zwangsvergleichs umstritten war
39
. Vergleich und
33
Liebig, 2010; S. 153.
34
Liebig, 2010; S. 153.
35 Liebig, 2010; S. 153.
36 Pape, 2010; S.
467.
37 Pape, 2010; S.
468.
38 Breuer, 2003; S. 174.
39 Pape, 2010; S.
470.
11
Zwangsvergleich als Sanierungsmittel durch Schuldenregulierung waren im
Grunde Verträge des Schuldners mit seinen Gläubigern zur Abwendung des
Konkurses.
40
Zwar benötigte man die Zustimmung des Gerichts, wobei dieses
aber keine Gestaltungsbefugnis besaß, sondern nur Rechtmäßigkeitskontrollen
vornahm.
41
Da nach Vorstellung des Gesetzgebers der Insolvenzplan das bisherige
Vergleichsverfahren in seiner verfahrensrechtlichen Konzeption ersetzt
42
, ist der
Ansicht vom Prof. Dr. Pape zu folgen, wonach der Insolvenzplan ein
,,mehrseitiger Verwertungsvertrag der zwangsvollstreckungsberechtigten
Gläubiger über die Art und Weise der Haftungsverwirklichung"
43
ist. Andererseits
bedarf der vorgelegte Insolvenzplan einer richterlichen Bestätigung und könnte
dadurch ebenso ein gestaltender Staatsakt sein.
44
Der BGH bezeichnet den
Insolvenzplan als ,,spezifisch insolvenzrechtliches Instrument, mit dem die
Gläubigergesamtheit ihre Befriedigung aus dem Schuldnervermögen
organisiert".
45
Zusammengefasst kann man den Insolvenzplan als vertragsähnliches
Rechtsinstitut bezeichnen, der für seine Wirksamkeit eine gerichtliche
Bestätigung nach § 248 InsO benötigt.
46
2.3
Zweck des Insolvenzplanverfahrens
Zweck des Insolvenzverfahrens ist die Feststellung und der Erhalt der
verbleibenden Schuldnermasse, mit anschließender quotaler Befriedigung der
Gläubiger.
47
Hauptsächlich erhalten die Gläubiger ihre Quote durch Liquidation
des Unternehmensträgers, bzw. Unternehmensteilen oder durch Verkauf des
Unternehmens im Sinne einer übertragenden Sanierung. Mit dem Insolvenzplan,
der auch als Kernstück des neuen Insolvenzrechts bezeichnet wird, ergibt sich
nun die einzige Möglichkeit innerhalb des Insolvenzverfahrens, denselben
Unternehmensträger im Sinne einer Sanierung von seinen Verbindlichkeiten zu
bereinigen.
48
Das heißt unter Fortbestand desselben Unternehmens und
40 Pape, 2010; S.
470.
41 Hess/Weis, 1999; S. 170.
42 Keller, 2006; S. 613.
43 Pape, 2010; S. 470.
44 Pape, 2010; S. 470.
45 Pape, 2010; S. 470.
46 Breuer, 2003; S. 174.
47 Vgl.: http://www.insolvenzrecht.info/insolvenz-lexikon/zweck.html, am 06.08.2011 um 14:57 Uhr.
48 Brei, 2008; S. 334.
12
abweichenden Regelungen zum Insolvenzverfahren werden die Gläubiger aus
dessen zukünftigen Erträgen befriedigt. Anders als nach dem Vergleichsrecht
muss der Insolvenzplan den Gläubigern keine Mindestquote bieten, sondern
überlässt den Gläubigern und dem Schuldner sämtliche Gestaltungsfreiheit und
stärkt somit auch die Gläubigerautonomie.
49
Ziel und Zweck des Insolvenzplans ist somit die Sanierung, bzw. der Erhalt von
wettbewerbsfähigen Unternehmen, die sich als sanierungsfähig und würdig
erwiesen haben. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Insolvenzpläne
auch die übertragende Sanierung oder die Liquidation als Ziel beinhalten können.
3 Inhalt
des
Insolvenzplans
3.1 Arten
von
Insolvenzplänen
3.1.1 Sofortige
Zerschlagung
Wie bereits erwähnt ist der Zweck des Insolvenzverfahrens die gemeinschaftliche
Befriedigung der Gläubiger durch die Verwertung des Schuldnervermögens. Wird
ein Insolvenzplan als Liquidationsplan aufgestellt, kommt es auch in diesem
besonderen Verfahren zur Zerschlagung der Unternehmenswerte und zur
Verteilung an die Gläubigergemeinschaft, wie es auch das Regelinsolvenzver-
fahren vorsieht. Allerdings können hierbei mit Hilfe des Insolvenzplans, vom
Gesetz abweichende Regelungen getroffen werden. Zum Beispiel kann von den
Regelungen der §§ 165 ff. InsO, die die Verwertung absonderungsberechtigter
Gegenstände betreffen, abgewichen werden,
50
um weiter in die Rechte der
absonderungsberechtigten Gläubiger einzugreifen.
51
Auch kann beispielsweise
eine vorerst zeitlich unbegrenzte Fortführung des Unternehmens entgegen § 159
InsO beschlossen werden.
52
3.1.2 Übertragende
Sanierung
Die übertragende Sanierung wird in der Praxis deutlich häufiger gewählt als die
ihr gleichwertigen Verwertungsmöglichkeiten der Liquidation oder Sanierung.
53
Sie wird in der Literatur auch häufig als ,,sanierende Liquidation" bezeichnet, da
49 Hess/Weis, 2002; S. 233.
50 Keller, 2006; S. 616.
51 Smid, 2007; S. 481.
52 Pape 2010; S. 467.
53 Bork 2009; S. 208.
13
das zu sanierende Unternehmen vom zu liquidierenden Unternehmensträger
getrennt wird.
54
Für sich betrachtet ist dieser Übertragungsplan letzendlich ein
Liquidationsplan, da er auf den Verkauf des Unternehmens abzielt.
55
Kennzeichnend für die übertragende Sanierung ist der Übergang des
Unternehmens, oder Teile des Unternehmens, auf einen neuen Rechtsträger,
unter Liquidierung
56
des bisherigen Unternehmensträgers.
57
Als Käufer kommen
speziell für diesen Zweck gegründete Zweckgesellschaft in Betracht, aber auch
Konkurrenten oder branchenfremde Unternehmer.
58
Der Kaufpreis wird dann zur
Befriedigung der Gläubigerforderungen verwendet.
59
Dieser muss zumindest dem
Zerschlagungswert des Unternehmens entsprechen, wobei die
Insolvenzverwaltung einen Kaufpreis in Höhe des Fortführungswertes anstreben
wird.
60
Die §§ 160 ff. InsO enthalten zudem einige Vorschriften zur Preisfindung.
Zum Beispiel die Mitwirkung des Gläubigerausschusses in § 160 Abs. 2 Nr. 1
InsO, die Zustimmung der Gläubigerversammlung wenn ein Verdacht auf
Veräußerung unter Wert besteht in § 163 Abs. 1 InsO, sowie die Zustimmung der
Gläubigerversammlung bei Erwerb an besonders Interessierte in § 162 Abs. 1
InsO.
Die übertragende Sanierung innerhalb eines Insolvenzplans durchzuführen bietet
sich aus dem Grund an, da der Übertragung regelmäßig eine Sanierung
vorangeht, weil der Fortführungswert als Kaufpreis nur für sanierte,
überlebensfähige Unternehmen gezahlt wird.
61
Der Vorteil ist der Erhalt des Betriebes und der Arbeitsverhältnissen, wenn auch
nur in Teilen.
Zudem ist zu bedenken, dass nach § 613a BGB eine übertragende Sanierung als
Betriebsübergang zu sehen ist und somit Bestandsschutz für die
Arbeitsverhältnisse gilt.
62
Der Insolvenzverwalter hat also im Vorfeld zu
54 Bork 2009; S. 209.
55 Pape 2010; S. 469.
56 Liquidierung ist die Auflösung eines Unternehmens; Liquidation ist der Verkauf aller Vermögensgegenstände eines Unternehmens.
57 Bork 2009; S. 208.
58 Bork 2009; S. 208.
59
Keller 2006; S. 616.
60 Bork 2009; S. 209.
61 Bork 2009; S. 211.
62 Bork 2009; S. 211.
14
versuchen, durch Umstrukturierungen und Kündigungen nach § 113 ff. InsO das
Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver zu gestalten.
63
Desweiteren sind die §§ 25 Abs. 1 HGB und 75 Abs. 1 AO, die die Haftung des
Erwerbers für Firmenverbindlichkeiten und ausstehende Steuern regeln, nach §
25 Abs. 3 HGB und § 75 Abs. 2 AO nicht anzuwenden.
3.1.3 Sanierung
des
Unternehmesträgers
Der Zweck der Sanierung des Unternehmens und des Unternehmensträgers ist
die Beseitigung des Insolvenzantragsgrundes,
64
damit, anders als bei der
übertragenden Sanierung, derselbe Unternehmensträger das Unternehmen
fortführen kann. Die Gläubiger werden aus den fließenden Erträgen der
Geschäftstätigkeit befriedigt und erhalten meist eine höhere Quote als bei
Zerschlagung der einzelnen Vermögenswerte. Zudem kann zumindest ein Teil
der Arbeitsplätze gerettet werden und der Wirtschaft bleibt ein gesunder
Wettbewerber erhalten.
65
Der Begriff Sanierung bzw. Reorganisation nach
Chapter 11 umfasst alle Maßnahmen, die nötig sind, um das Unternehmen
wieder wettbewerbsfähig zu machen.
66
Eine Sanierung kann daher nicht ohne
wesentliche Beiträge der Gläubiger, darunter auch Arbeitnehmer und der Fiskus,
erfolgen.
67
Zum Einen ist es erforderlich, dass die Gläubiger solange stillhalten,
bis die Sanierungsmöglichkeiten geprüft werden können und zum Anderen
werden von allen Beteiligten, insbesondere von Großgläubigern und
Arbeitnehmern, große Opfer abverlangt, damit ein Unternehmen erfolgreich
saniert werden kann.
68
Hierbei kann der Insolvenzplan als Sanierungsplan einen
geeigneten rechtlichen Rahmen bieten, um die Interessen der Beteiligten in
einen angemessenen Ausgleich zu bringen und das erforderliche
Zusammenwirken festzuhalten.
69
3.2 Der
darstellende
Teil
Laut § 219 S.1 InsO ist es zwingend, dass der jeweilige Plan aus einem
darstellenden und einem gestaltenden Teil besteht. Der darstellende Teil ist in §
220 InsO definiert. Er dient als Informationsbasis für die Gläubiger und das
63
Keller 2006; S. 618.
64 Keller 2006; S. 618.
65 Bork 2009; S. 200.
66 Bork 2009; S. 200.
67 Keller 2006; S. 618.
68 Bork 2009; S. 204.
69 Bork 2009; S. 204.
15
Insolvenzgericht und soll Ziel und Vorgehensweise des Plans erläutern.
70
Er zielt
insbesondere auf die Darstellung der Sanierungsfähigkeit ab und muss
Aussagen über die Art der Verwertung (Liquidation, übertragende Sanierung
oder Sanierung), bzw. über die Mittelzufuhr treffen, die als Quote verteilt werden
soll.
71
Es sind alle Maßnahmen aufzuführen, die seit Eröffnung des
Insolvenzverfahrens getroffen worden sind und noch getroffen werden sollen, um
die Grundlage für die geplante Gestaltung der Rechte der Beteiligten zu
schaffen. Der Plan muss aufzeigen, ob und wie von den gesetzlichen
Vorschriften abgewichen werden soll.
72
Zudem müssen alle erforderlichen
Angaben beigefügt werden, die für eine Entscheidung über den Plan hinsichtlich
seiner Grundlagen und Auswirkungen entscheidend sind.
73
Die Vermögens-,
Ertrags- und Finanzlage ist nach § 229 InsO zu erläutern. Um eine Zustimmung
der Gläubiger zum Plan herbeizuführen, sollte der darstellende Teil außerdem
aufzeigen, inwieweit die Gläubiger durch den Plan besser gestellt werden als
durch das Regelinsolvenzverfahren.
74
Bei Durchführung eines Insolvenzplans als Sanierungsplan ist dem darstellenden
Teil das Sanierungskonzept hinzuzufügen.
75
Im Abschnitt 5 wird genauer auf die
Inhalte des darstellenden Teils eingegangen.
3.3 Der
gestaltende
Teil
Der gestaltende Teil des Plans legt nach Maßgabe der §§ 221 ff. InsO fest, wie
die Rechtsstellung der Beteiligten geändert werden soll. Zu den Beteiligten nach
§ 222 InsO gehören die absonderungsberechtigten Gläubiger, die
Insolvenzgläubiger und die nachrangigen Insolvenzgläubiger. Die Rechtsstellung
der Gesellschafter des schuldnerischen Unternehmens, bzw. des Schuldner kann
durch den Plan nicht geändert werden, da sie keine Beteiligten i.S.d. § 221 InsO
sind.
76
Ihnen kann lediglich durch den Insolvenzplan aufgrund des § 227 Abs. 1
InsO die Befreiung der restlichen Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gläubigern
versagt werden.
77
70 Pape 2010; S. 471.
71 Pape 2010; S. 472.
72 Hess 1998; S. 168.
73 Breuer 2003; S. 176.
74 Breuer 2003; S.
177.
75 Hess 1998; S. 169.
76 Hess 1998; S. 169.
77 Pape 2010; S. 473.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842840423
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2014 (März)
- Note
- 1,0
- Produktsicherheit
- Diplom.de