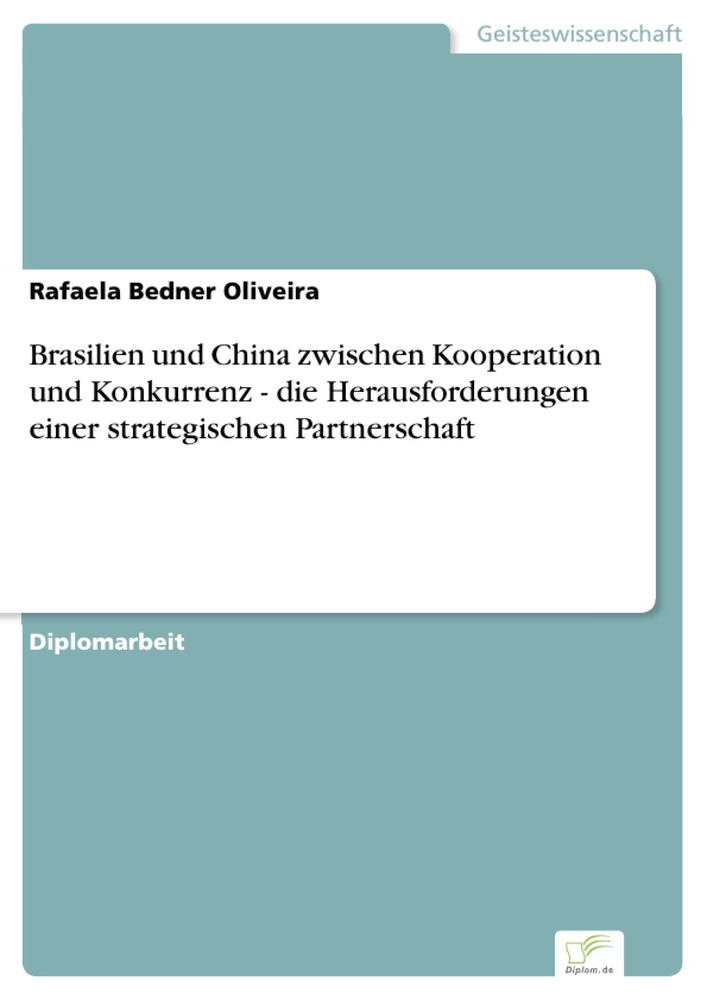Brasilien und China zwischen Kooperation und Konkurrenz - die Herausforderungen einer strategischen Partnerschaft
©2013
Diplomarbeit
97 Seiten
Zusammenfassung
Einleitung:
‘Was die Amerikaner an China so beunruhigt,
ist nicht sein Kommunismus, es ist sein Kapitalismus.’
Thomas Friedman (BBC 2011).
Als Teil der sogenannten BRICS-Staaten haben sowohl Brasilien als auch China eine führende Rolle in der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik eingenommen, insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund, dass die bilateralen Beziehungen nicht nur wirtschaftlich als auch politisch von beiden Seiten außergewöhnlich stark ausgebaut werden. China ist heute Brasiliens größter Handelspartner, zudem gewinnt die Partnerschaft nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Bühne wachsend an Bedeutung, da beide wirtschaftlich gesehen zu den stärksten wachsenden Schwellenländern gehören (Spanakos 2010: 86).
Bei den BRICS- Staaten handelt es sich um die vier aufstrebenden Wirtschaftsnationen Brasilien, Russland, Indien, China und seit 2010 auch Südafrika. Was sie miteinander verbindet, ist nicht zuletzt ein starker Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, enorme Rohstoffvorkommen und ein rasanter jährlicher Aufschwung des Wirtschaftswachstums. So stellten sie im Jahre 2008 beispielsweise 42 % der Weltbevölkerung und machten 14,6 % des Bruttoinlandsproduktes und 12,8 % des globalen Handels aus. Aller Voraussicht nach werden sie sehr bald zu den weltweit führenden Industrienationen aufschließen.
Die große Finanzkrise nach 2008 hat zudem dazu geführt, dass die globale politische und ökonomische Verschiebung der Kräfteverhältnisse sich noch weiter zugespitzt hat: mit den BRICS- Staaten entwickeln sich mehr und mehr neue kapitalistische Zentren. Vor allem die Länder Brasilien, Indien und China haben aufgrund spezifischer Bedingungen, wie beispielsweise die schärfere Banken- und Finanzregulierung, die weltweite Finanzkrise weit schneller überwunden als die Industrieländer und verzeichneten bereits ein Jahr später ein Rekordwachstum. Zudem wiesen beide Länder im Inland ein deutliches Wachstum des Binnenkonsums auf, was zusammenführend nach Schmalz für eine ‘graduelle Reorientierung auf endogene Entwicklungspotentiale und den Aufbau von sogenannten Mittelklassen bei starker Integration in den Weltmarkt’ spricht (Schmalz et al. 2011: 9).
[...]
‘Was die Amerikaner an China so beunruhigt,
ist nicht sein Kommunismus, es ist sein Kapitalismus.’
Thomas Friedman (BBC 2011).
Als Teil der sogenannten BRICS-Staaten haben sowohl Brasilien als auch China eine führende Rolle in der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik eingenommen, insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund, dass die bilateralen Beziehungen nicht nur wirtschaftlich als auch politisch von beiden Seiten außergewöhnlich stark ausgebaut werden. China ist heute Brasiliens größter Handelspartner, zudem gewinnt die Partnerschaft nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Bühne wachsend an Bedeutung, da beide wirtschaftlich gesehen zu den stärksten wachsenden Schwellenländern gehören (Spanakos 2010: 86).
Bei den BRICS- Staaten handelt es sich um die vier aufstrebenden Wirtschaftsnationen Brasilien, Russland, Indien, China und seit 2010 auch Südafrika. Was sie miteinander verbindet, ist nicht zuletzt ein starker Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, enorme Rohstoffvorkommen und ein rasanter jährlicher Aufschwung des Wirtschaftswachstums. So stellten sie im Jahre 2008 beispielsweise 42 % der Weltbevölkerung und machten 14,6 % des Bruttoinlandsproduktes und 12,8 % des globalen Handels aus. Aller Voraussicht nach werden sie sehr bald zu den weltweit führenden Industrienationen aufschließen.
Die große Finanzkrise nach 2008 hat zudem dazu geführt, dass die globale politische und ökonomische Verschiebung der Kräfteverhältnisse sich noch weiter zugespitzt hat: mit den BRICS- Staaten entwickeln sich mehr und mehr neue kapitalistische Zentren. Vor allem die Länder Brasilien, Indien und China haben aufgrund spezifischer Bedingungen, wie beispielsweise die schärfere Banken- und Finanzregulierung, die weltweite Finanzkrise weit schneller überwunden als die Industrieländer und verzeichneten bereits ein Jahr später ein Rekordwachstum. Zudem wiesen beide Länder im Inland ein deutliches Wachstum des Binnenkonsums auf, was zusammenführend nach Schmalz für eine ‘graduelle Reorientierung auf endogene Entwicklungspotentiale und den Aufbau von sogenannten Mittelklassen bei starker Integration in den Weltmarkt’ spricht (Schmalz et al. 2011: 9).
[...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Bedner Oliveira, Rafaela: Brasilien und China zwischen Kooperation und Konkurrenz -
die Herausforderungen einer strategischen Partnerschaft, Hamburg, Diplomica Verlag
GmbH 2014
PDF-eBook-ISBN: 978-3-8428-4225-0
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2014
Zugl. Universität zu Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, September 2013
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2014
Printed in Germany
i
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ... iii
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ... iv
I EINLEITUNG ... 1
II METHODIK UND ERKENNTNISINTERESSE... 4
III POLITISCHER KOOPERATIONSBEGRIFF UND HINTERGRÜNDE DER
INTERNATIONALEN HANDELSPOLITIK ... 5
1 Was ist eine Kooperation? Kooperationstheoretische Ansätze ... 5
1.2
Neo-Realismus versus Liberalismus: wissenschaftlicher Diskurs zur Erklärung von
Kooperationen ... 5
1.3
Definition des Kooperationsbegriffes ... 7
1.4
Regimetheorie ... 9
2 Die Internationale Handelspolitik ... 11
2.1
Die Akteure der internationalen Beziehungen ... 14
IV MULTILATERALISMUS DES SÜDENS UND DIE BILATERALE BEZIEHUNG AUF
INTERNATIONALER EBENE ... 15
1 Der Begriff des Multilateralismus ... 15
1.2
Der sino-brasilianische Multilateralismus ... 17
2 Die WTO und ihre Rolle in den bilateralen Beziehungen beider Länder ... 19
V POLITISCH-STRATEGISCHE BEZIEHUNGEN: ZWEI AUFSTEIGENDE MÄCHTE
MIT UNTERSCHIEDLICHEN INTERESSEN ... 22
1 Brasiliens wachsendes Interesse an China ab 1990 ... 22
2 Joint Action Plan 2010- 2014 ... 29
2.1
Technische Zusammenarbeit im Bereich der Umweltpolitik ... 31
2.2
Technische Kooperation: Earth Resource Satellite (CBERS) ... 33
VI HANDEL UND WIRTSCHAFT: EXPANSION DES BILATERALEN HANDELS ... 36
1 Handel und wirtschaftliche Beziehungen beider Länder seit 2000 ... 36
ii
1.2
Beide Volkswirtschaften im Vergleich ... 40
1.3
Brasiliens Exportzusammensetzung nach China ... 43
1.4
Chinas Exportzusammensetzung nach Brasilien ... 45
2 Direkte und Indirekte Einwirkungen auf den Handel mit China: Marktverluste in anderen
Regionen ... 47
3 Vertiefung der Handelsbeziehungen: Aussicht auf den Handelsaustausch in lokalen
Währungen ... 52
4 Ausländische Direktinvestitionen ... 53
4.1
China als Empfänger und Quelle von ausländischen Direktinvestitionen... 55
4.2
Brasilien und China im Vergleich als Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen ... 56
5 Probleme des bilateralen Handels für Brasilien: Der Effekt der ,,Deindustrialisierung" ... 60
VII FAZIT ... 66
ANHANG ... 70
LITERATUR ... 78
iii
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ALADI Asociación
Latinoamericana
de
Integración
AVIC
China Aviation Industry Corporation
BIT
Bilateral
Investment
Treaties
CAST
Chinese Academy of Space Technology
CBERS
China Brazil Earth Resources Satellite
CBHCCC China-Brazil
High-level
Coordination and Cooperation Committee
CEBC
Conselho Empresarial Brasil-China
COPPE
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
CVRD
Companhia do Vale Rio Doce
DDA
Doha Development Agenda
EALACF
Fórum de Cooperação Ásia do Leste-América Latina
FDI
Foreign
Direct
Investment
FIESP
Federation of Industries in the State of São Paulo
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
INPE
National Institute for Space Research
ISS
International
Space
Station
IWF
Internationaler
Währungsfond
MoU
Memorandum of Understanding
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
WTO
World Trade Organisation
iv
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Brasiliens Export an USA und China von 2005 bis 2009
38
Abbildung 2: Brasiliens Export- und Importquoten und die Handelsbilanz zwischen
1990-2012
39
Abbildung 3: Brasiliens größte Exportpartner (in %) von 2001 bis 2009
42
Abbildung 4: bilateraler Handelsaustausch von 2002 bis 2010 (in Millionen US Dollar) 44
Abbildung 5: Beteiligung Chinas an den brasilianischen Importen von 2005 bis 2010
(in
%)
46
Abbildung 6: Chinas direkte und indirekte Effekte auf den Handel und die
Auslandsinvestitionen
in
Brasilien
48
Abbildung 7: Abb. 6: Import Chinas von brasilianischem Eisenerz zwischen
2002
und
2011 51
Abbildung 8: Brasilianischer Export von Agrikulturprodukten nach China zwischen 2000
und
2011
62
1
I EINLEITUNG
,,Was die Amerikaner an China so beunruhigt,
ist nicht sein Kommunismus, es ist sein Kapitalismus."
Thomas Friedman (BBC 2011)
Als Teil der sogenannten BRICS-Staaten haben sowohl Brasilien als auch China eine
führende Rolle in der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik eingenommen,
insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund, dass die bilateralen Beziehungen nicht nur
wirtschaftlich als auch politisch von beiden Seiten außergewöhnlich stark ausgebaut werden.
China ist heute Brasiliens größter Handelspartner, zudem gewinnt die Partnerschaft nicht nur
auf nationaler, sondern auch auf internationaler Bühne wachsend an Bedeutung, da beide
wirtschaftlich gesehen zu den stärksten wachsenden Schwellenländern gehören (Spanakos
2010: 86).
Bei den BRICS- Staaten handelt es sich um die vier aufstrebenden Wirtschaftsnationen
Brasilien, Russland, Indien, China und seit 2010 auch Südafrika. Was sie miteinander
verbindet, ist nicht zuletzt ein starker Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, enorme
Rohstoffvorkommen und ein rasanter jährlicher Aufschwung des Wirtschaftswachstums. So
stellten sie im Jahre 2008 beispielsweise 42 % der Weltbevölkerung und machten 14,6 % des
Bruttoinlandsproduktes und 12,8 % des globalen Handels aus. Aller Voraussicht nach werden
sie sehr bald zu den weltweit führenden Industrienationen aufschließen
1
.
Die große Finanzkrise nach 2008 hat zudem dazu geführt, dass die globale politische und
ökonomische Verschiebung der Kräfteverhältnisse sich noch weiter zugespitzt hat: mit den
BRICS- Staaten entwickeln sich mehr und mehr neue kapitalistische Zentren. Vor allem die
Länder Brasilien, Indien und China haben aufgrund spezifischer Bedingungen, wie
beispielsweise die schärfere Banken- und Finanzregulierung, die weltweite Finanzkrise weit
schneller überwunden als die Industrieländer und verzeichneten bereits ein Jahr später ein
Rekordwachstum. Zudem wiesen beide Länder im Inland ein deutliches Wachstum des
Binnenkonsums auf, was zusammenführend nach Schmalz für eine ,,graduelle Reorientierung
auf endogene Entwicklungspotentiale und den Aufbau von sogenannten Mittelklassen bei
starker Integration in den Weltmarkt" spricht (Schmalz et al. 2011: 9). Mit der Öffnung beider
1
Die Definition der BRIC Staaten ist im cecu Wirtschaftslexikon zu finden
(www.cecu.de/lexikon/wirtschaft/1914-bric.htm).
2
Länder für den Weltmarkt und der damit einhergehenden florierenden Wirtschaft ging die
graduelle Intensivierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern einher. Für Brasilien
hat sich der Handel mit China zwischen 2006 und 2010 beispielsweise verdreifacht und die
wirtschaftlichen Verflechtungen nehmen mehr und mehr zu (Salama 2012: 224).
Mit der Einführung des demokratischen Systems Mitte der 80er sowie der Öffnung Brasiliens
für den internationalen Markt ging die Diversifizierung der bilateralen Beziehungen einher, da
Brasilien sich global nun sehr offen für neue internationale Partnerschaften zeigte. Zeitgleich
begannen nach Ende des Kalten Krieges auch Chinas Wachstum und die breite Öffnung
seiner nationalen Märkte, so dass eine Annäherung beider Länder bereits vorauszusehen war
(Oliveira 2012: 1). Zudem ist der Außenhandel Brasiliens in den letzten Jahren von einer
wachsenden Teilnahme an den sogenannten ,,Neuen Märkten" gekennzeichnet, das heißt
außerhalb der traditionellen Märkte wie der EU, der NAFTA, Lateinamerikas und Japans.
Unter diesen spielt China mit wachsendem Gewicht die größte Rolle (Meier 2005). Brasilien
und China stellen hiermit eine Herausforderung für die bestehende globale Ordnung und
damit vor allem für die einzige bis dato bestehende wirtschaftliche Supermacht USA dar.
Ziel dieser deskriptiv-analytischen Arbeit ist es, die Entwicklung der bilateralen Beziehungen
zwischen der Volksrepublik China und der República Federativa do Brasil seit etwa Anfang
2000 kontrovers zu diskutieren. Die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern sind vor
allem in den letzten fünf Jahren soweit ausgebaut worden, dass 2009 China den Platz der
USA als wichtigsten Handelspartner Brasiliens eingeholt hat - zum ersten Mal nach etwa
sieben Jahrzehnten- und bis dato noch ist (Tavener 2010). Die strategische Partnerschaft muss
sich jedoch immer mehr sowohl nationalen als auch globalen Herausforderungen stellen, da
beide Länder nicht nur in einem Kooperations- sondern auch in einem Konkurrenzverhältnis
stehen. Immerhin handelt es sich hier um die zwei am stärksten wachsenden Entwicklungs-
und Schwellenländer, die um Drittmärkte und internationalen politischen Einfluss
wettstreiten. Zudem hat der Handel mit China bereits starke Negativeffekte in Brasiliens
industrieller Landschaft hinterlassen, hier kam es beispielsweise zu einer Konzentration der
brasilianischen Wirtschaft auf den Sektor der Rohstoffproduktion. So warnt man in der
brasilianischen Politik bereits vor der wachsenden Gefahr der ,,Deindustrialisierung"
(Barbosa/Mendes 2006: 4). Daher stellt sich die Frage: inwieweit kann das Verhältnis der
beiden Länder als kooperativ definiert werden? Zur Beantwortung dieser Fragestellung
präzisiert die Arbeit zunächst den Begriff der Kooperation mit Hilfe der Kooperationstheorie.
Was bedeutet eine Kooperation im politikwissenschaftlichen Sinne? Dazu wird der Diskurs
3
zwischen dem Neo-Realismus und dem Institutionalismus zur Kooperationstheorie kurz
dargestellt. Ausgehend von den hier erlangten Erkenntnissen wird vertiefend die
Regimetheorie herangezogen. Zur Erklärung des internationalen Kontextes, in dem die beiden
Länder miteinander interagieren, ist sie durchaus dienlich, da die Kooperation sich schon seit
Jahren auch im internationalen Kontext abspielt. Eine kurze Einführung in die internationale
Handelspolitik und die Darstellung der relevanten internationalen Akteure geben einen
Einblick in die Wirtschaftspolitik, die im Kapitel VI auf beide Länder später übertragen wird.
Daran anschließend werden die Erwartungen an die strategische Partnerschaft sowie die
zentralen Forschungsthesen dargestellt.
Um die bilateralen Beziehungen umfassend zu verstehen, ist es zudem notwendig, den
internationalen Kontext, in dem sie gebettet sind, zu untersuchen, denn beide Länder ordnen
ihre Partnerschaft einer strategischen Ebene unter. Kapitel IV definiert daher den Begriff des
Multilateralismus und beschreibt, was unter einem Multilateralismus des Südens in Bezug auf
beide Länder zu verstehen ist. Daran anschließend wird kurz der Einfluss der WTO als eine
der wichtigsten internationalen Wirtschaftsorganisation auf die Partnerschaft dargestellt.
Was die politischen, strategischen und institutionellen Unterschiede für einen Einfluss auf die
bilateralen Beziehungen haben, soll hier in Kapitel V dargestellt werden. Dafür wird zunächst
eine kurze historische Abhandlung mit den wichtigsten Eckdaten und zentralen Abkommen
gegeben, um dann als bedeutsames politisch-strategisches Abkommen zwischen Brasilien und
China, den Joint Action Plan, genauer zu untersuchen. Als Beispiel gelungener technischer
Zusammenarbeit wird im Anschluss das Earth-Resource Satellite- Projekt (CBERS) als
wichtigste technisch-wissenschaftliche Kooperation behandelt. Kapitel VI bildet schließlich
den Hauptteil und Schwerpunkt dieser Arbeit, welches sich dem Ausbau des Handels und der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit widmet. Zuerst werden die wirtschaftlichen
Handelsbeziehungen beider Länder seit etwa 2000 kurz skizziert, um dann einen Vergleich
beider Volkswirtschaften zu ermöglichen. Nach einem kurzen Ausblick auf die Möglichkeit,
den zukünftigen Handelsaustausches in den jeweiligen lokalen Währungen durchzuführen,
geht die Arbeit etwas näher auf die Zusammensetzung der Exporte Brasiliens nach China ein.
Hier wurde bewusst der Schwerpunkt auf die Ausfuhr Brasiliens nach China gelegt, da dieser
gerade in den letzten Jahren einen wahren Aufschwung erlebt hat, was sowohl positive als
auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft Brasiliens nach sich ziehen. Im Anschluss
werden die ausländischen Direktinvestitionen, die einen starken Effekt der
Institutionalisierung und Legalisierung haben und somit auch die Wirkung von Kooperationen
4
verstärken und somit eine wichtige Funktion in der bilateralen Partnerschaft erfüllen,
analysiert. Dazu erfolgt ein Vergleich beider Länder als Empfänger von ausländischen
Direktinvestitionen. Abschließend zum Kapitel VI werden als Ergebnis der aktuellen
wirtschaftlichen Entwicklungen die zum Teil schädlichen Einflüsse genauer erläutert und
kontrovers dargelegt.
Zusammenfassend wird eine Prognose über die Entwicklung der strategischen Partnerschaft
zwischen Brasilien und China und ihre Auswirkung sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene gewagt.
II METHODIK UND ERKENNTNISINTERESSE
Nach der Festlegung des theoretische Rahmen der vorliegenden Arbeit nähert sie sich
methodisch gesehen von außen nach innen der Fragestellung, inwieweit die strategische
Partnerschaft beider Länder in einem Konkurrenz- oder Kooperationsverhältnis stehen. So
werden in einem ersten Schritt die Internationalen Restriktionen, denen beide Länder in ihren
außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten unterworfen sind, beschrieben. Dabei stellt sich
die Frage: wie sind die institutionellen Vorgaben? Bei welchen internationalen
Organisationen handelt es sich um zentrale Determinanten und wie war der politische Auftritt
beider Länder in diesen internationalen Foren bis derzeit? Kann ihre Vorgehensweise
Aussage treffen über die Idee einer neuen internationalen Matrix unter dem Begriff des
Multilateralismus? Über die Darstellung des institutionellen und gesetzlichen Rahmens im
nationalen Umfeld durch die politischen Abkommen erfolgt die eigentliche Analyse des
zentralen Kerns der Kooperation: die wirtschaftspolitischen Handelsbeziehungen, worüber
sich die strategische Partnerschaft ja hauptsächlich definiert. Vornehmliches
Erkenntnisinteresse ist dabei, inwieweit sie einen Gewinn oder Gefahr für beide Seiten, hier
insbesondere für Brasilien bedeuten. Was sind dabei die zentralen Interessen Chinas, welche
Strategie verfolgt es mit Brasilien?
So lautet die Annahme dieser Arbeit, dass die Partnerschaft zwischen Brasilien und China in
einem starken Ambivalenzverhältnis zwischen Fluch und Segen für Brasilien steht, da hinter
dem Tauziehen der Länder auch die Rivalität der beiden Schwergewichte ihrer jeweiligen
Kontinente existiert. Die Arbeitshypothese geht von der Annahme aus, dass, wenn Brasilien
es nicht schafft, strukturelle Veränderungen der politischen Vorgaben in der eigenen
5
Wirtschaft durchzuführen, es letztendlich in Zukunft aufgrund von Deindustrialisierung und
Marktverlusten in Drittländern stark unter dem chinesischen Einfluss leiden wird.
Es kann zudem die Hypothese aufgestellt werden, dass die erste Motivation für die
Kooperation wirtschaftlich geprägt ist, jedoch mittlerweile ein wachsendes politisches
Interesse zur internationalen Durchsetzung von regionalem Ausdruck und die Möglichkeit
zum gemeinsamen Handeln, um Interessen auch global, vor allem gegen die Industrieländer
durchzusetzen, besteht. Das gemeinsame Vorgehen der führenden Mächte des Südens hat das
Potenzial, eine neue "Geographie des internationalen Handels" zu erschaffen. Der
Schlüsselpartner dazu ist derzeit China (Barbosa 2006: 1, da Silva/Visentini 2010: 55).
Die vorliegende Arbeit wurde somit bewusst größtenteils aus der brasilianischen Perspektive
verfasst, denn Ziel ist es, die Chancen und Risiken darzustellen, die China für Brasilien
bedeuten.
III POLITISCHER KOOPERATIONSBEGRIFF UND HINTERGRÜNDE DER
INTERNATIONALEN HANDELSPOLITIK
1 Was ist eine Kooperation? Kooperationstheoretische Ansätze
Um die aktuellen Kooperationsbeziehungen und -geflechte der beiden Länder im
internationalen Kontext verstehen zu können, bieten vor allem die Theorien der
internationalen Kooperation und Verflechtung einen umfassenden Rahmen zur Analyse und
Auswertung der sino-brasilianischen Partnerschaft.
1.2 Neo-Realismus versus Liberalismus: wissenschaftlicher Diskurs zur Erklärung von
Kooperationen
Die Kooperationstheorien in den internationalen Beziehungen sind das Ergebnis einer
kritischen Auseinandersetzung mit dem Realismus und dem Neo-Realismus, da dieser davon
ausgeht, dass das von Natur aus anarchische Staatensystem dem Strukturprinzip des
6
Sicherheitsdilemmas unterliegt und Prozessen der nullsummenspielartigen Konkurrenz um
Macht, Einfluss und Ressourcen ausgeliefert ist (Kabus 2012: 13). Dementsprechend ist der
Selbstschutz und das Überlebensinteresse des Nationalstaates zentrales Motiv staatlichen
Handelns und die nationale Sicherheit steht über der ökonomischen Wohlfahrt. Der
strukturelle Realismus bietet nur geringe Anreize für das Zustandekommen von
zwischenstaatlichen Kooperationen, denn er betont die Schwäche von internationalen
Institutionen und die Zerbrechlichkeit von Kooperationen (Kabus 2012: 14). Diese
Grundbedingungen führen dazu, dass internationale Kooperationen schwierig herzustellen
und zu erhalten sind (Meyers 2004: 503).
Der Neo-Realismus sieht zudem in der zwischenstaatlichen Machtverteilung die zentrale
Zusammensetzung des internationalen Systems und darin auch die hohe Wahrscheinlichkeit
für Konflikte. Staaten sind nach neo-realistischem Ansatz grundsätzlich an relativen
Gewinnen interessiert, daraus resultiert ja das relative Gewinndilemma, siehe dazu vor allem
Kenneth Waltz als zentraler Vertreter des strukturellen Realismus: "The first concern of states
is not to maximize power but to maintain their position in the system" (Waltz 1979: 126).
Dieser Ansatz machte es der politischen Forschung zu der damaligen Zeit kaum möglich,
neuere globale Entwicklungen der internationalen Beziehungen zu interpretieren.
Zudem erfolgte mit dem Ende des Kalten Krieges die Neuordnung und Entspannung der
globalen Ordnung, was zu einem Wiederaufleben der liberalen Ansätze führte, da der
neorealistische Ansatz starke Erklärungsschwächen bei dem Diskurs über zwischenstaatliche
Kooperationen vor allem auf dem, für die vorliegende Arbeit wichtigen, wirtschaftlichen
Gebiet zeigte (Schweller/Pu 2011: 1).
Der Liberalismus bietet mit ,,seinem subsystemischen Analyseansatz und pluralistischen
Politikverständnis (...) eine gewichtige paradigmatische Alternative zur Erklärung
internationaler Kooperations- und Konfliktphänomene. Staatliches Außenverhalten ist nach
liberaler Lesart nicht als Substrat struktureller Zwänge, sondern als konstitutives Element des
internationalen Systems aufzufassen" (Kabus 2012: 16). Die Chancen auf eine Kooperation
sind demnach höher, wenn sie als bilaterale Zusammenarbeit höhere Gewinne versprechen als
das unilaterale Vorgehen und sind damit abhängig von der Zusammensetzung der
interdependenten Staatspräferenzen.
Empirisch gesehen wurde mit dem Sturz des kommunistischen Herrschaftssystems der mittel-
und osteuropäischen Staaten Ende der 1980er Jahre und dem beginnenden Machtverfall der
USA der Forschung der internationalen Politik die Relevanz von gesellschaftlichen
Gruppierungen und die Gültigkeit der liberalen Analyse besonders deutlich (Schieder 2010:
7
187). Rittberger bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass die ,,Vergesellschaftung" die
zunehmende Partizipation gesellschaftlicher Interessengruppen am außenpolitischen
Entscheidungsprozess bedeute und damit ein grundlegendes Subjekt der internationalen
Politik, nämlich die Gesellschaft ins Zentrum rückt (Schieder 2010: 188)
2
. Mit Blick auf die
globalen Entwicklungen und hier speziell auf die sino-brasilianischen Beziehungen kann nicht
bestritten werden, dass sich staatliches Handeln wachsend und in großen Teilen aus
gesellschaftlichen Strukturen und Interessen ableitet. Genau diese Tatsache findet sich in der
politischen Forschung zu den Theorien über Kooperation und Verflechtung, die eher der
Schule des liberalen Internationalismus und dem liberalen Institutionalismus zuzuordnen sind,
wieder.
Die zentrale Gemeinsamkeit des Neorealismus mit dem neoliberalen Institutionalismus
besteht darin, dass Staaten primär aus reinem Selbstinteresse handeln und damit die
strukturelle Analyse der systematischen Ebene wichtig ist, um Machtkonstellationen zu
interpretieren (Kabus 2012).
1.3 Definition
des
Kooperationsbegriffes
Um das Entstehen und die Aufrechterhaltung von Kooperationen zwischen zwei Akteuren, in
diesem Fall zweier Staaten zu analysieren, muss zuallererst definiert werden, was eine
Kooperation im politischen Sinne eigentlich ist. Dabei geht die Politikwissenschaft davon aus,
dass die Akteure in einem Konflikt- und Konkurrenzverhältnis stehen, und macht sich zum
Ziel zu erklären, wie diese mit Hilfe von Kooperationsvereinbarungen überwunden werden.
Nach Müller (1993: 4) setzt man bei der Entstehung einer Kooperation voraus, dass- ,,bei aller
ursprünglichen Interessendivergenz der Akteure - eine Schnittmenge gemeinsamer
Interessen" besteht:
,,Ihr typisches Bezugsfeld sind Nicht-Nullsummenspiele, in denen die Akteure auf der
Basis eines Grundbestands gemeinsamer Interessen - etwa der Systemerhaltung, des
Schutzes ihrer Unabhängigkeit oder Souveränität und/ oder der Garantie eines
zumindest negativen, durch die Abwesenheit organisierter militärischer
Gewaltanwendung zwischen gesellschaftlichen Großgruppen charakterisierten
2
Der Autor verweist hier auch nochmal auf weitere wichtige Vertreter des Liberalismus und dem Thema
Vergesellschaftung wie Bruce Russett, Michael Doyle, Robert D. Putnam, Thomas Risse und Andrew
Moravcsik.
8
Friedens - um die Verteilung von Werten konkurrieren. In Situationen die eine
Mischung konfligierender und komplementärer Interessen der Akteure enthalten,
entsteht Kooperation, wenn die Akteure ihr Verhalten an die tatsächlichen oder
antizipierten Präferenzen anderer Akteure anpassen." (Meyers 2004: 483)
Rittberger definiert Kooperation als auf ,,freiwilliger Basis eingegangene Beziehung von
Akteuren im Kontext internationaler Organisationen oder Institutionen als Antwort auf
wachsende Interdependenz im globalen Umfeld, die durch Institutionalisierung gelöst werden
kann" (Rittberger 1994: 77). Schaut man sich die zentralen Autoren wie Keohane (1994), Oye
(1986) und Krasner (1983) zur Kooperationstheorie an, so besteht Einigkeit darüber, dass
Kooperationen aufgrund einer fehlenden übergeordneten Kontrollinstanz entstehen, da sie in
einem dezentralisierten internationalen Milieu stattfinden, eine Annahme, die auch im Neo-
Realismus wiederzufinden ist (Oye 1986, zit. nach Meyers 2004). Diese Annahme ist auf das
zu untersuchende Thema der sino-brasilianischen Beziehung übertragbar und spielt eine
zentrale Rolle, da sie die Rahmenbedingung für das Verhältnis beider Länder bildet und prägt.
Eine der wichtigsten Fragen, die sich die Kooperationstheorie stellt ist, aus welchem Grund
Akteure bereit sind, sich auf eine Kooperation überhaupt einzulassen. Sie findet dafür zwei
mögliche Antworten: entweder aus altruistischem Grund, der nicht auf unmittelbaren
Gegenwert, sondern auf den auf lange Sicht bestehende Vorteil des Handelnden basiert und
weswegen Akteure aus rationalen Gründen der allgemeinen Wohlfahrt darauf eingehen. Die
zweite Möglichkeit ist, dass Akteure aus rational kalkuliertem Eigeninteresse kooperieren
(Meyers 2004: 485). Kooperation setzt demnach zwei prinzipielle Bedingungen voraus,
nämlich, dass das Akteursverhalten rational und zielgerichtet ist und dass die Übereinkunft
einen größeren Gewinn einbringt, als den ohne das Eingehen der Kooperation. Dabei
verpflichtet sich jeder Akteur, durch die eigene Verhaltensänderung dem anderen Akteur
durch das Erreichen der eigenen Ziele zu fördern und wird so im Gegenzug ein solches
Verhalten der Gegenseite antizipieren.
Die beiden zentralen Vertreter des liberalen Institutionalismus Axelrod und Keohane stellen
sich in ihrem Diskurs die Frage, unter welchen Bedingungen zum Beispiel Kooperation in
einer Welt aus Egoisten ohne zentrale Autorität und internationaler Anarchie entsteht
(Axelrod/Keohane 1985). Für Akteure ergibt sich hieraus eine Gratwanderung zwischen der
Erfüllung von Kooperationserwartungen und dem Risiko von Betrugsversuchen, die mit Hilfe
von Sanktionen eingedämmt werden können, die jedoch geringer ausfallen müssen als der
9
kooperative Gewinn. In diesem Zusammenhang können Institutionen eine feste Struktur
sowie Regeln und Normen eine Erwartungssicherheit schaffen, Kooperationen über die Zeit
stabilisieren, die Verhaltensstruktur der beteiligten Akteure aneinander anpassen und somit
die Kooperation im Wesentlichen erleichtern. Damit spielt auch der Faktor Zeit eine wichtige
Rolle: ,,je öfter also Akteure in strukturell vergleichbaren Situationen miteinander
kooperieren, desto mehr werden sich nicht nur ihre Verhaltenserwartungen und -strategien
aneinander anpassen." (Meyers 2004: 486). Die herausragende Rolle vom Prozess der
Institutionenbildung stellt Keohane in seinem Werk International Institutions And State
Power dar:
"the ability of states to communicate and cooperate depends on human-constructed institutions (...).
States are at the center of our interpretation of world politics...but formal and informal rules play a
much larger role..." (Keohane 1989: 2).
So weist Keohane hier auf die zentrale Funktion von Institutionen hin und ist damit
wegführend für den in diesem Zusammenhang entstehenden liberalen Institutionalismus, der
sich die in den späten 70er Jahren in den USA unter der noch damaligen Dominanz des
Neorealismus herausgebildet hat. Als einen zentralen Kritikpunkt der Politikwissenschaft am
Liberalismus ist der Vollständigkeit halber zu ergänzen, dass er zwar durch seine Begründung
von Wirtschaftskooperationen überzeugt, aber in weiten Teilen das staatliche außenpolitische
Verhalten auf eine utilitaristische und auf rein wirtschaftlichen Interessen geleitete Handlung
reduziert.
Vertiefend dazu dient die sogenannte Regimetheorie, die dem Neoinstitutionalismus
zuzuordnen ist, da sie ganz dezidiert internationale Regime in den internationalen
Beziehungen ins Zentrum der Untersuchung rückt und das Ziel hat, ein besseres Verständnis
für Kooperationen in den Weltwirtschaftsbeziehungen zu schaffen. Damit hat sie für diese
Forschungsdiskussion, nämlich inwieweit Kooperationen und Institutionen Einfluss auf das
staatliche Verhalten Brasiliens und China haben, eine hohe Relevanz.
1.4 Regimetheorie
Als der wichtigste Vertreter der Regimetheorie ist auch hier Keohane mit seinem Werk After
Hegemony (1984) und schließlich Power and Interdependence (1977) zu nennen. Definiert
werden nach Keohane Regime als
10
,,problemfeldspezifische inhaltliche wie prozedurale Prinzipien, Normen und Regeln, die von Staaten
vereinbart und als gültig betrachtet werden. Dabei gelten als Prinzipien allgemeine Verhaltensstandards;
Normen dagegen sind konkrete Verhaltensvorschriften und in Regeln drücken sich überprüfbare
Verhaltensvorschriften aus, die von den Regeladressaten ein spezifisches Verhalten verlangen bzw. ein
spezifisches Verhalten verbieten." (Zangl 2010: 133).
Wichtig ist bei der Definition von Regimen, zwischen Internationalen Regimen und
internationalen Organisationen (wie beispielsweise der UNO) zu unterscheiden: erstere
besitzen keinerlei Akteursqualität. Zudem sind sie, wie die oben genannte Definition schon
ausdrücklich beschreibt, auf ganz spezifische Problemfelder der Internationalen Beziehungen,
hauptsächlich aus der Wirtschaftspolitik, bezogen.
Auch die damalige amerikanische Regimeforschung hatte wie die Theorien zu Kooperation
und Verflechtung zum Ziel, ein besseres Verständnis der Kooperationen in den
Weltwirtschaftsbeziehungen zu schaffen (Zangl 2010: 134). Da Regime nun keine
Akteursfunktion haben, greifen sie somit nicht in Interessen der beteiligten Staaten selbst ein,
sondern bieten lediglich eine Art Plattform, ihre Interessen zu vertreten und somit zur
Kooperation zur verhelfen. Zudem haben internationale Regime den großen Vorteil, dass sie
die relativen Transaktionskosten senken (Keohane 1984: 89-92). So skizziert Zangl (2010:
139 -140) in seinem Aufsatz zur Regimetheorie vier Wirkungspfade, die zur Bildung von
Regimen führen:
1. sie senken Kosten, da sie einen genauen Verhandlungsrahmen mit den festen
Verhandlungspartnern und zielen bieten, so dass zeitraubende Vorverhandlungen
wegfallen.
2. Dadurch entsteht eine Erwartungsverlässlichkeit, insbesondere, da die verhandelten
Vereinbarungen auch eine höhere Chance haben, eingehalten zu werden, was mit den
Kontrollmechanismen von Regimen sicherlich zu tun hat: ,,What these arrangements
have in common is that they are designed not to implement centralized enforcement of
agreements, but rather to establish stable mutual expectations about others´ patterns of
behavior and to develop working relationships that will allow the parties to adapt their
practices to new situations." (Keohane 1984: 89)
3. internationale Regime verbinden in diesem Zusammenhang oft verschiedene
spezifische Kooperationsvereinbarungen innerhalb eines Problemfelds miteinander, so
dass die Durchsetzung von einer Kooperationsvereinbarung als Anregung zu weiteren
Kooperationen dienen kann. Das führt wiederum zu einer Vertiefung und weiteren
11
Vereinfachung von Kooperationen sowie einer Reduzierung von Unsicherheit über die
Kooperationstreue, da an die Kooperation mehrere Übereinkünfte gebunden sind.
4. Regime binden Staaten an ihre Kooperationsvereinbarungen, und ein Verstoß gegen
die Vorgaben kann kostspielig sein. Dieser Staat verliert zudem seinen Ruf als
vertrauenswürdiger Partner und würde es in Zukunft weit schwerer haben, auf
internationaler Ebene Kooperationspartner zu finden. So sind Staaten oft bereit, auch
Kooperationsverpflichtungen einzugehen, die nicht in ihrem eigentlichen Interesse
stehen (Zangl 2010: 140).
Im Falle der sino-brasilianischen Kooperationen kann man davon ausgehen, dass aufgrund der
geringen Anzahl der Partner, -nämlich nur zwei Staaten- die gegenseitige Kontrolle relativ
einfach durchzuführen ist bzw. gar kaum einer Überprüfung bedarf. Das spart sowohl
Transaktionskosten und erhöht das gegenseitige Vertrauen in die Beziehungen. In dem
Kapitel VI zu den wirtschaftlichen Kooperationen wird das über die Jahre zwischen den
beiden Staaten wachsende Vertrauensverhältnis noch deutlicher und bestätigt hiermit diese
theoretische Annahme.
2 Die Internationale Handelspolitik
Die internationale Handelspolitik dient grundsätzlich der Koordinierung der nationalen
Handelspolitiken einzelner Staaten und setzt einen Eingriff der Nationalstaaten in die
Wirtschaft voraus. Sie hat das Ziel, eine ,,höhere Wohlfahrt der Weltbevölkerung durch die
Optimierung des Tauschs von Waren und Dienstleistungen über Staatsgrenzen hinweg" zu
ermöglichen (Häckel 2004: 186).
Im Idealfall führt sie zu einem effizienten Ausbau der Absatzmärkte und damit letztendlich zu
Einkommenssteigerungen der Nationalstaaten. Zudem wird die Versorgung der
Weltbevölkerung vor allem durch die Lieferung von Rohstoffen weltweit ausgebaut und
somit verbessert. Dazu bietet sie durch die gemeinsame Abstimmung einen gewissen Schutz
für einheimische Unternehmen gegen ausländische Konkurrenz (beispielsweise in Form von
Protektionismus). Hauptinstrumente des Protektionismus sind nach Schmidt (2004) Zölle,
Quoten, Maßnahmen zur Devisenbewirtschaftung und Handelshemmnisse unterhalb der
Schwelle von Zöllen, wie nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Mit Hilfe des Modells der
strategischen Handelspolitik nach Krugman (2003) können sogenannte Spill-over-Effekte
12
(Übertragungseffekte) ausgemacht werden. Dieser geht von Marktstrukturen mit einer kleinen
Anzahl von Konkurrenten auf dem Weltmarkt aus, in denen Staaten einheimischen
Unternehmen durch meist finanzielle Hilfen Wettbewerbsvorteile verschaffen, in der
Hoffnung, erhöhte Marktanteile im globalen Markt und nationalen Wachstum oder
technischen Fortschritt, der auch andere Branchen mit beeinflusst, zu erzielen.
Diese von Regierungen zum Beispiel in Form von Importzuschlägen, Exportsubventionen
oder Forschungs- und Entwicklungszuschläge verbilligten Produkte, verdrängen teurere
Handelsgüter der ausländischen Konkurrenz, werden in der Konsequenz häufiger gekauft und
können daher zu immer billigeren Herstellungskosten in Masse gefertigt werden, womit sie
im Endeffekt die Verbraucher im Inland stark belasten. Die nationalen Unternehmen
profitieren zwar hochgradig vom Exportboom, aber im Gegenzug dazu müssen die Bürger der
Nationalstaaten die Staatshilfen über höhere Preise oder Steuern hauptsächlich mitfinanzieren
(Häckel 2004).
Handelspolitik kann letztendlich auch dem sogenannten aktuell viel beobachtbaren Neo-
Kolonialismus dienlich sein: mit diesem Begriff wird versucht, ein altbekanntes Phänomen in
neuem Gewand zu beschreiben, nämlich andere Länder in ökonomischer und politischer
Abhängigkeit zu halten und sie in ihren Ressourcen so weit wie möglich auszuschöpfen.
Eine andere Frage, die sich die Handelspolitik stellt, ist, warum ein Staat in den Freihandel
eingreift, wo doch der Markt über Wettbewerb sehr klar und effizient die Nachfrage und
Produktion regelt? Diese Frage lässt sich schnell beantworten: aus rationalem Eigeninteresse.
Die staatliche Regulierung schafft eine Stärkung des eigenen Marktes und damit des
inländischen Wohlstandes und erweitert die globalen Marktanteile, da hohe Exporte das
Wirtschaftswachstum sichern. So greifen Staaten mit einer aggressiven strategischen
Handelspolitik oder Billiglohnländer- als gutes Fallbeispiel hier China, was dem Land auch
gerne mal eine hohe Medienpräsenz sichert, häufig zu unfairem Wettbewerb. Sie schaffen
sich Vorteile auf Kosten der anderen Staaten, greifen schnell zu Vergeltungsmaßnahmen oder
bremsen Importwellen (Häckel 2004: 188).
Zu den klassischen Instrumenten der Außenwirtschaftspolitik zählen beispielsweise
Handelsverträge sowie Handelsabkommen, die Wechselkurspolitik, Zölle und
außenhandelsbezogen die direkte oder indirekte Förderung durch Ausgleichsabgaben oder
Subventionen und nichttarifäre Handelshemmnisse (Schmidt 2004: 62). Handelsverträge sind
im Gegensatz zu Handelsabkommen langfristige Vereinbarungen über die zuvor genannten
Instrumente und sind meist multilateral. Bilaterale Vereinbarungen betreffen eher
13
Handelsabkommen, die kurzfristiger Natur sind und detailliertere Bestimmungen über
beispielsweise Zolltarife beinhalten. (Häckel: 2004: 190)
Die Kooperation spielt dabei eine wichtige Rolle und beinhaltet die Zusammenarbeit
hauptsächlich in Einzelvorhaben, so wie die Partnerschaft zwischen Brasilien und China in
größten Teilen auch charakterisiert und gesteuert ist.
Die Struktur der internationalen Handelsbeziehungen hat in den letzten Jahrzehnten eine
tiefgreifende Transformation durchlebt, was letztendlich einen immensen Einfluss auf die
Entwicklung der Partnerschaft zwischen Brasilien und China hatte.
So haben die GATT- und später WTO-Runden beispielsweise Handelshemmnisse abgebaut,
die Verschiebung der Wirtschaftszonen lösten zudem Integrationsschübe aus und mit Ende
des Kalten Krieges und des Zusammenbruchs des Ostblocks kam es zu einer Aufhebung der
Planwirtschaft (Häckel 2004: 191). Mit wachsender Globalisierung trat ein Prozess der
weltweiten Arbeitsteilung in Kraft, die politisch gesetzte Handelsgrenzen zwischen Staaten
zunehmend abbaute und somit den Wettbewerbsdruck zwischen den Unternehmen erheblich
steigerte.
Andererseits hat sie zu verbesserten Kommunikations- und Transportmöglichkeiten geführt,
die eine weltumspannende Arbeitsteilung ermöglicht, bei der immer kleinere Produktionsteile
in den Ländern verarbeitet werden, die die höchsten Kostenvorteile bieten. Eine solche
Verlagerung ist größtenteils in die asiatischen Ländern zu beobachten, wo auf eine hohe
Anzahl an günstigen Arbeitskräften zuzugreifen ist.
Im Ganzen ist eine Produktivitäts- und Effizienzsteigerung zu beobachten, die zum Beispiel
das Auftauchen von Doppelentwicklungen verhindert, da der globale Markt hier schnell
reguliert. Somit werden gleichzeitig Ressourcen und Kosten eingespart und eine höhere
Leistungsbreite und tiefe erreicht.
Schaut man sich sehr große Projekte an, so sind diese heutzutage nur noch im weltweiten
Umfang durchführbar aufgrund des hohen Investitionsausmaßes und der technischen
Komplexität. Als ideales Beispiel für gelungene Zusammenarbeit soll an dieser Stelle
nochmal das Satellitenprojekt CBERS zwischen Brasilien und China genannt werden, auf das
im vorherigen Kapitel näher eingegangen worden ist.
Häckel bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt, dass ,,die Globalisierung den Trend zur
Ökonomisierung der Politik" verstärkt. Nationalstaaten werden ihm nach von Unternehmen
immer mehr zu ,,Wirten" gemacht, da Unternehmen (meist multinationale Konzerne)
bestimmte Funktionen ins Ausland verlagern- mit im Vergleich niedrigerem Lohnniveau und
14
dies oft als Reaktion auf die Anwerbung der Regierungen durch günstigere
Produktionsbedingungen. In der Wirtschaft ist dieses heute so gängige Phänomen auch als
offshoring bekannt. (Häckel 2004: 193).
Nationalstaaten und Regime versuchen sich davor zu schützen, indem sie
Regulierungsmaßnahmen schaffen, die private Akteure dazu bringt, im eigenen Land zu
produzieren. Oft werden mit Hilfe von Direktinvestitionen in Form von Tochterfirmen nur
noch beispielsweise die Montage von einzelnen Bauteilen ins Ausland verlagert, da dort die
Arbeitskräfte sehr viel günstiger sind. Unter Kapitel VI über Direktinvestitionen wird auch
darauf näher eingegangen.
2.1
Die Akteure der internationalen Beziehungen
In der Forschung zu den internationalen Beziehungen gibt es mehrere relevante
Akteursklassen, die meist autorenübergreifend sehr ähnlich zusammengefasst werden
(Luckenbach 2010, Schieder/Spindler (Hrsg.) 2010, Woyke 2011) und hier, wenn auch sehr
grob umrissen, dargestellt werden sollen:
1. International anerkannte Staaten
2. Internationale Regime und Organisationen wie beispielsweise die UNO
3. Transnationale Unternehmen (abgekürzt oft als BINGO: Business International Non-
Governmental Organisation) wie multinationale Konzerne, die auch unter dem gängigen
Begriff Global Player in der Literatur wiederzufinden sind und
4. Gesellschaftliche transnationale Akteure und Netzwerke wie
Nichtregierungsorganisationen (NRO) beziehungsweise Non-Governmental Organisations
(NGO) wie zum Beispiel Amnesty International oder Greenpeace.
Schaut man sich die internationale Wirtschaftspolitik an, so stellt sich die Frage: wer ist an
den Kooperationen beteiligt, wer ist bei globalen Beziehungen zu beachten und zu
berücksichtigen?
In der internationalen Wirtschaftspolitik wird zwischen Akteuren unilateraler (autonomer)
und multilateraler (kooperativer) internationaler Wirtschaftspolitik unterschieden
(Luckenbach 2010: 3). Demnach sind Akteure der unilateralen internationalen Handelspolitik
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2013
- ISBN (eBook)
- 9783842842250
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Philosophosche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2014 (März)
- Note
- 1,0
- Produktsicherheit
- Diplom.de