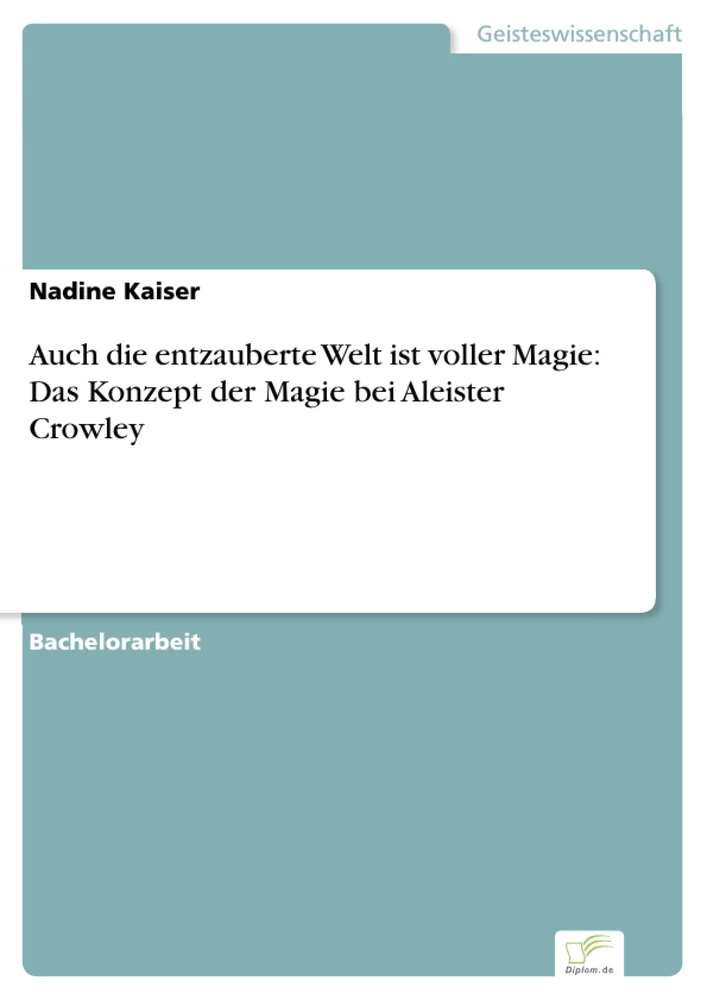Auch die entzauberte Welt ist voller Magie: Das Konzept der Magie bei Aleister Crowley
Zusammenfassung
Beschäftigt man sich mit der Magie, kann man dies auf sehr unterschiedliche Art und Weise verrichten. Betrachtet man auch nur oberflächlich all Jenes, was als ‚magisch‘ bezeichnet wird, eröffnen sich weite Welten der Interpretations- und Anwendungsmöglichkeiten der Magie als solche. Doch welcher Nutzen kann aus einem Begriff hervorgehen, der in der heutigen Zeit so vage einzugrenzen scheint und von welchem in einer einheitlichen, allgemeingültigen Bedeutung nicht zu sprechen sein kann?
Gerade dieser Versuch einer Eingrenzung der Magie zu ihrem ‚ursprünglichen‘ Sinn hin verbleibt bis heute ein umfangreiches Forschungsfeld in vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Soziologie, der Religionswissenschaft, der Ethnologie oder der Kulturwissenschaft.
Max Weber, deutscher Soziologe, beschäftigte sich beispielsweise in seinem Buch Wirtschaft und Gesellschaft mit der Entzauberung der Welt, mit der er die Entwicklung und Veränderung des Weltbildes vom magischen bis hin zum rationalen Weltbild beschreibt. Hans Kippenberg, deutscher Religionswissenschaftler, versucht im Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe eine Annäherung bzw. Neuinterpretation und Begriffserklärung des Wortes Magie zu finden und zieht dazu die Forschungen von u.a. dem Ethnologen Sir James Frazer und den Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski und Edward E. Evans-Pritchard zur Hilfe heran, da bisher keine eindeutige und anerkannte Definition des Wortes Magie existierte und er nach eingehender Betrachtung zu dem Schluss kommt, dass angemessene ‘Definitionen von Magie zu unsicher sind‘.
[...]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die Weite des Magie-Begriffes
2. Definition von Magie
2.1. Sir James Frazer
2.1.1. Sympathetische Magie
2.1.2. Zusammenhänge von Magie, Wissenschaft und Religion
2.1.3. Beispiele für das Wirken von Magie innerhalb einer Gesellschaft
2.2. Bronislaw Malinowski
2.2.1. Magie und ihre Beziehung zu Religion und Wissenschaft
2.2.2. Eigenschaften der Magie
2.2.3. Beispiele für die Anwendung der Magie
2.3. Edward E. Evans-Pritchard und die Magie bei den Zande
2.4. Zur weiteren Verwendung des Magie-Begriffes
3. Aleister Crowleys Magick
3.1. Diary of a Drug Friend - Das Leben Aleister Crowleys
3.2. Magie in Theorie und Praxis
3.2.1. Magie, Religion und Wissenschaft
3.2.2. Yoga und Kabbala als Basis der Magick
3.2.3. Inhalte von Crowleys Magick
4. Magie ist nicht gleich Magie
Schluss
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Anhang
Erklärung.
Einleitung
Beschäftigt man sich mit der Magie, kann man dies auf sehr unterschiedliche Art und Weise verrichten. Betrachtet man auch nur oberflächlich all Jenes, was als ‚magisch‘ bezeichnet wird, eröffnen sich weite Welten der Interpretations- und Anwendungsmöglichkeiten der Magie als solche. Doch welcher Nutzen kann aus einem Begriff hervorgehen, der in der heutigen Zeit so vage einzugrenzen scheint und von welchem in einer einheitlichen, allgemeingültigen Bedeutung nicht zu sprechen sein kann?
Gerade dieser Versuch einer Eingrenzung der Magie zu ihrem ‚ursprünglichen‘ Sinn hin verbleibt bis heute ein umfangreiches Forschungsfeld in vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Soziologie, der Religionswissenschaft, der Ethnologie oder der Kulturwissenschaft.
Max Weber, deutscher Soziologe, beschäftigte sich beispielsweise in seinem BuchWirtschaft und Gesellschaftmit der Entzauberung der Welt[1], mit der er die Entwicklung und Veränderung des Weltbildes vom magischen bis hin zum rationalen Weltbild beschreibt. Hans Kippenberg, deutscher Religionswissenschaftler, versucht imHandbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe[2]eine Annäherung bzw. Neuinterpretation und Begriffserklärung des Wortes Magie zu finden und zieht dazu die Forschungen von u.a. dem Ethnologen Sir James Frazer und den Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski und Edward E. Evans-Pritchard zur Hilfe heran, da bisher keine eindeutige und anerkannte Definition des Wortes Magie existierte und er nach eingehender Betrachtung zu dem Schluss kommt, dass angemessene „Definitionen von Magie zu unsicher sind[3]“.
Ausgehend von Kippenbergs Betrachtung der Magie durch das Heranziehen ethnologischer Forschungen, soll in dieser Arbeit auf Basis der Forschungsergebnisse und Erkenntnisse von Frazer, Malinowski und Evans-Pritchard ein Ansatz erarbeitet werden, wie der Begriff Magie angemessen definiert werden könnte, ohne dabei einen Absolutheitsanspruch zu erheben. Die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Forschungen im Bereich der Magie befassen sich mit der Magie der sogenannten ‚primitiven Völker‘, welche noch in einer ursprünglichen, nicht von der Globalisierung betroffenen eigenen Welt und Umwelt leben. Jene Studien über die Praxis der Magie der indigenen Völker erscheinen im heutigen Verständnis durchaus als Modell einer reinen und natürlichen Magie, wie sie seit Jahrhunderten praktiziert worden sein könnte, gewissermaßen gleichsetzbar mit einer ‚klassischen‘ Form der Magie.
In etwa zur gleichen Zeit, als sich Frazer, Malinowski und Evans-Pritchard mit den zuvor erwähnten Studien befassten, entstand durch den Engländer Aleister Crowley eine neue und moderne Form der Magie:Magick. Während seines Studiums an der Universität Cambridge entdeckte Crowley früh sein Interesse an der Magie und nahm schließlich Kontakt zu einem Geistwesen auf, welches ihm das BuchLiber AL vel Legisdiktiert habe, welches später zur Grundlage von Crowleys magischen Lehren wurde. Sein System der Magick wird u.a. durch kabbalistische Lehren weiter ergänzt und mit von Crowley entwickelten Praktiken und Ritualen vervollständigt.
Crowley, der in einigen seiner Ansichten mit den Erkenntnissen von Frazer übereinstimmt und Bezüge zu dessen Arbeit aufweist, bezeichnet seine Art der Magie bewusst als Magick, um sich von einer allgemeinen Magie abzugrenzen. Nach Crowleys Auffassung versucht Magie mit Riten die Realität zu verändern, was jedoch kein Merkmal der Magick darstellt.
Hieraus ergibt sich die Fragestellung, welche Gemeinsamkeiten Aleister Crowleys Magick mit einer ursprünglichen Form der Magie aufzuweisen hat. Zwar formuliert Meister Therion[4], wie Crowley sich selbst bezeichnete, deutlich eine Abgrenzung von Magick zur Magie, doch ist eine ähnliche Grundstruktur dennoch nicht von der Hand zu weisen.
Hierbei soll jedoch nicht die Tatsache vernachlässigt werden, dass es sich bei der Ethnologie um eine anerkannte Wissenschaft handelt, welche hierzu Beobachtungen bei indigenen Völkern betreibt und bis heute überlieferte und praktizierte Formen der Magie festhält. Dem gegenüber steht Crowley, der als ein nicht wissenschaftlicher Vertreter des Bereiches des Okkultismus[5]auftritt, da seine Lehren sich mit Erscheinungen von übersinnlichen, nach den Naturgesetzen nicht oder nur schwer erklärbaren Kräften des Natur- und Seelenlebens beschäftigen. Mit seinem Konzept der Magick begründet er eine neuzeitliche Magie-Bewegung, die ebenso als neue magische Weltanschauung bezeichnet werden kann und somit differierende Präferenzen der Anwendung der Magie im Vergleich zu den ethnologischen Beobachtungen bedingen kann.
So wird sich diese Arbeit zuerst mit einer Definition der Magie befassen, von der Crowley sich zu distanzieren wünscht. Dies wird unter Zuhilfenahme der Forschungen von Frazer, Malinowski und Evans-Pritchard geschehen, ehe näher auf Crowleys Konzept der Magick eingegangen wird. Nachdem diese Betrachtungen abgeschlossen sind und ein Versuch einer Definition zur weiteren Verwendung des Magie-Begriffes gegeben wurde, soll gezeigt werden, ob und inwieweit Crowleys eklektizistisch anmutender neuzeitlicher Magie-Begriff das ethnologische Magie-Konzept aufgreift, adaptiert, verändert oder auslässt, um sein Verständnis von Magick darzulegen sowie auszuleben.
1.Die Weite des Magie-Begriffes
Der Begriff der Magie ist ein vielfältiger und oft unterschiedlich interpretierbarer, doch bedarf es zum weiteren Verständnis und zur Betrachtung einer Definition des hier verwendeten Begriffes der Magie, da diese die zentrale Fragestellung entscheidend trägt. Gerade in der heutigen Zeit ist das WortMagie, wie auch das Wortmagisch, zum universellen Etikettieren von Ereignissen, Produkten und Erlebnissen avanciert. Als „magische Klänge“ werden oftmals Musikstücke umschrieben, die den Rezensenten besonders berühren;It´s Magicbetitelt eine Fernsehsendung, in der ein ‚Magier‘ Löffel verbiegt und auch das wiederholte Erblühen einer Rose von Jericho wird gemeinhin als ‚Magie‘ bezeichnet. Dem gegenüber steht das Verständnis von Magie als Wissensgegenstand in der Ethnologie, das beispielsweise vom Sozialanthropologen Evans-Pritchard als kollektives Konzept beschrieben wird, das „die Einheimischen in gleicher Weise akzeptieren wie wir unsere wissenschaftlichen[6].“
Die vielfältigen Anwendungen des Begriffes lassen vermuten, dass Magie auch als Metapher Anwendung finden kann und – je nach Gebrauch – bestimmte Eigenschaften besonders hervorheben soll. „Die Metapher weckt einen Erwartungshorizont, dem der Kontext widerspricht; sie erhält durch den (sprachlichen) Kontext (Ko-Text) eine ‚Meinung‘, die ihre lexikalisch festgelegte ‚Bedeutung“ übersteigt[7].“ Weinrichs Metapherntheorie legt die Vermutung nahe, dass nicht nur bestimmte Merkmale durch die Nutzung hervorgehoben werden sollen, sondern dass auch ‚unbrauchbare‘ Eigenschaften des Wortes in seinem speziellen Kontext ausgeblendet und ‚neutralisiert‘ werden. Verdeutlicht wird dies ebenso durch die Suche nach Synonymen: „dämonisch, okkult, okkultistisch, spiritistisch, übernatürlich, übersinnlich, geheimnisvoll, mystisch, rätselhaft, unerklärlich; (gehoben) zauberisch[8].“ Hier zeigt sich, dass durch das Ersetzen des Wortesmagischmit einem beliebigen o.g. Synonym eine bestimmte Eigenschaft des Grundwortes hervorgehoben wird und nicht die umfassende Gänze des Ausdruckes widerspiegelnsoll. So scheint das Erblühen der Rose von Jericho auf den ersten Blick eher durch rätselhaft beschrieben oder das Verbiegen eines Löffels durch Gedankenkraft eines Magiers als übernatürlich oder unerklärlich, während der Einsatz der Wörter dämonisch wie auch mystisch, und die damit verbundenen Spezifika, in diesem Zusammenhang unzutreffend erscheinen und ausgeblendet werden.
Etymologisch betrachtet, entstammt das Wort Magie aus dem griechischenμαγεία(mageía),welches sich ursprünglich des persischen Wortesmágosbedient[9]. Bei jenen mágos handelt es sich um ein persisches Volk, welches bereits durch Herodot in seinen Historien beschrieben wird. Dieser Stamm derMagerversteht sich in besonderer Weise auf Grabriten[10]sowie auf die Traumdeutung[11], welche unter anderem auch von Königen wie Astyages in Anspruch genommen wurde, um die Zukunft und den weiteren Verlauf zu deuten. Weitere griechische Schriftsteller, wie u.a. Platon, berichteten über die speziellen Künste des Mager-Volkes, die angehenden Königen gelehrt wurden. Dennoch verbleibt mágos nicht in aller Gänze positiv behaftet, da der „falsche Smerdis[12]“ vom Stamm der Mager eben auch mit jenem Wort Abwertung erfährt. Weitere Ergänzungen und Umdeutungen des Begriffes vollziehen sich im Laufe der griechischen Geschichte, auf welche hier nur kurz eingegangen werden soll. Beispielsweise beschreibt Sophokles, dass ein Seher als mágos verunglimpft wird, der keinerlei Rücksicht auf die Kunst nimmt und nur den Gewinn vor Augen hat. Weiter berichtet Platon von der Magie als schwarze Magie, die den Menschen vorrangig Schaden zufügen soll und eher in Verbindung mit Sehern als mit dem Stamm der Mager steht[13].
Geläufiger erscheint uns der Begriff der schwarzen Magie im Zusammenhang mit dem mittelalterlichen Phänomen der Hexe und deren Verfolgung, wie es im bekanntesten Werk jener Zeit, demMalleus Maleficarum, dargelegt ist. Hexerei wird oftmals gleichgesetzt mit Zauberei und Magie, die erst nach einem erfolgreichen Pakt mit dem Teufel ihre volle Wirkung ausschöpfen kann, da sie erst dann über die Zauberkraft für die Schadenszauberei verfügt. Ihre Wirkungsbereiche waren mannigfaltig: Unter anderem wurde ihnen eine schädigende, aber auch eine heilende Wirkung auf die Gesundheit des Menschen, Vernichtung und Schaden an Ernte, Nutzvieh und Haustieren, Wetterzauber, Kindstötung, Unfruchtbarkeitszauber, Verzauberung der ehelichen Gliedmaßen, Ritualmorde zur Erzeugung von Zaubermitteln und Verwandlung in Tiergestalten vorgeworfen[14].
Auch innerhalb der Alt- und Neuphilologien, die sich heute oft unter dem Begriff einer kulturwissenschaftlich vernetzten Literaturwissenschaft einordnen, spielen differente (Sprach-) Magiekonzepte eine wichtige Rolle. Eines dieser Modelle stellt etwa einen speziellen Bezug zwischen Magie, Poetik und Roman her. Dabei zielt es nicht mehr auf den schriftstellerischen Sonderfall der Lyrik ab, die mit dem Wort gleichsam das Ding, das Gemeinte im Sprachspiel selbst schöpft, sondern auf den Prosaausdruck. Wilhelm Scherer, österreichischer Germanist, ist hier als ein früher Vertreter zu nennen. Er verortet den Ursprung der Poetik im Hang zum Ästhetischen, was er wiederum an Beobachtungen von ‚Naturvölkern‘ und ihren Beschwörungsriten festmacht. So erscheint es, dass die Poesie nicht bloß Ergötzlichkeit oder Trösterin, daß sie auch ein Mittel ist, um auf den Willen zu wirken, eine Erregerin, eine Zaubermacht, mit welcher der, der sie übt, die Menschen zum Guten und zum Bösen lenken und durch ihr Phantasie auf ihre Leidenschaften und Thaten wirken kann[15].
Die Magie der Sprache ist innerhalb literaturwissenschaftlicher Kontexte Teil einer evokativen Kraft, die das Wort und das Bild eng aneinander binden. Je nach zugrunde liegendem Konzept, wird diese Kraft beispielsweise als Ausnutzung rhetorischer und grammatischer Potenzen eingeschätzt, etwa bei dem Dadaisten Hugo Ball, während Paul Célan diese Kraft als nicht begründbare, sprachmagische bzw. poetische Kraft der Sprache definiert[16]. Diesen Konzepten nachfolgend, etwa zur Wende des 20. Jahrhunderts, etablierte sich die Form des ‚magischen Romans‘, wie beispielsweise die ErzählungenMario und der ZaubereroderDer Zauberbergvon Thomas Mann zeigen. Der sogenannte magische Roman transportiert dabei mitunter fiktives, aber auch spezielles Ritualwissen: So kann das Handeln eines Magiers im Roman ähnlich dem eines wirklichen Magiers sein[17].
Bereits diese Übersicht über die verschiedenen Anwendungs- und Interpretationsbereiche macht deutlich, welche weiteren Bedeutungen der Magie-Begriff inne haben kann, und wie unsicher eine einheitliche Magiedefinition ohne nähere Betrachtung und ohne bestimmten Fokus formuliert werden kann.
2.Definition von Magie
Eine Annäherung an das ethnographische Verständnis von Magie soll im Folgenden an Beobachtungen festgemacht werden, die in historischer Reihenfolge vorgestellt, von Sir James Frazer, Bronislaw Malinowski und Edward E. Evans-Pritchard getroffen wurden. Dabei bleibt zu beachten, dass eine eindeutige Begriffsbestimmung nur schwer möglich ist, da Magie ebenso oft in Beziehung zu Religion und Wissenschaft gesetzt wird, jedoch nur schwer klare und definitorische Trennungen vollzogen werden können.
2.1. Sir James Frazer
Sir James Frazer (1854 – 1941), 1914 zum Ritter geschlagen, ist einer der bekanntesten Ethnologen unserer Zeit, obwohl er selbst keine Feldforschung betrieb und als „classic Oxbridge gnome[18]“ bekannt war, da er jeglichen sozialen Kontakt zu vermeiden suchte. In seinem HauptwerkThe golden Boughbetrachtet er umfassend das religiöse Verhalten von ‚primitiven Völkern‘ und das Zusammenspiel dessen mit der umliegenden Natur. Bei diesen Beobachtungen kommt Frazer u.a. zu dem Schluss, dass Magie evolutionistisch betrachtet die Vorstufe der Religion und diese wiederum die Vorstufe der Wissenschaft darstellt[19].
2.1.1. Sympathetische Magie
Frazer stellt zuerst zwei Grundsätze der Magie auf, die jedes magische Handeln kategorisieren. Zum einen existiert das Gesetz der Ähnlichkeit, dass durch Nachahmung jede gewünschte Wirkung des ausführenden Magiers herbeiführen kann. Sie wirdhomöopathischeoderimitative Magiegenannt. Der zweite Grundsatz ist der vom Gesetz der Berührung oder auch der direkten Übertragung. Alles stofflich existierende Material, welches einmal in Berührung mit der entsprechenden Person kam, kann durch Magie auf sie einwirken, weshalb sieÜbertragungsmagiegenannt wird. Für praktizierende Magier sind diese von Frazer benannten Gesetze von allgemeiner Gültigkeit.
Die homöopathische wie auch die Übertragungsmagie werden unter dem Begriff derSympathetischen Magie, demGesetz der Magie, kategorisiert. Sympathetisch steht in diesem Zusammenhang dafür, dass beide Arten der Magie annehmen, dass durch eine geheime Sympathie „der Impuls von einem auf den anderen übergeht durch etwas, das wir uns als eine Art unsichtbaren Äthers denken können[20]“.
Aus diesen Grundstrukturen der Magie leitet Frazer ab, dass die Magie […] ein unechtes System von Naturgesetzen [ist] und zugleich eine trügerische Verhaltensregel, sie ist eine falsche Wissenschaft und zugleich eine unfruchtbare Kunst. […] Für [den Magier] ist die Magie immer eine Kunst, niemals eine Wissenschaft; die bloße Idee der Wissenschaft ist in seinem unentwickelten Geist nicht vorhanden[21].
So zeigt sich, dass der praktizierende Magier ausschließlich von der praktischen Seite der Magie Gebrauch macht und nicht von der theoretischen Seite, von den Regeln, die die Welt bestimmen.
Das Prinzip der Homöopathie findet sich in vielen Bereichen wieder: So fällt der Voodoo-Zauber, also das Formen eines Gegenstandes der symbolisch für die zu verzaubernde Person steht, ebenso in diese Art der Magie wie auch der positive Gebrauch, um Krankheiten zu heilen, Frauen die Geburt zu erleichtern oder deren Kinderwunsch zu bekräftigen. „Manchmal wird die […] imitative Magie zu Hilfe gerufen, um ein böses Omen wirkungslos zu machen, indem man es mit Hilfe der Mimikri sich bewahrheiten läßt. Mit dem Ergebnis will man das Schicksal umgehen, indem man eine eingebildete Not für eine wirkliche einsetzt[22].“ Durch Nachahmung einer Geburt will der Magier positiven Einfluss auf das Wohl von Mutter und Kind nehmen und so die erfolgreiche nachgeahmte Geburt auf die Frau übertragen. Ebenso ist die Heilung von Krankheiten durch homöopathische Magie möglich; leidet eine Person beispielsweise an Gelbsucht, kann ihr Leiden auf gelbe Vögel, die an das Fußende des Bettes gebunden werden, übertragen werden[23]. Krankheiten lassen sich auch am Magier selbst heilen, indem er sich Leid zufügt und es vor dem Patienten heilt, der sofort eine Verbesserung seiner Krankheit verspürt. Ebenso findet das System Anwendung bei der Jagd, bzw. zur Nahrungssicherung. Durch „magische Telepathie[24]“ können Menschen und Dinge auch aus weiter Ferne beeinflusst werden. Führen daheim verbliebene Mitglieder gewisse Verhaltensregeln aus, überträgt sich dies auf das Jagdglück und beeinflusst es positiv.
Weitere Anwendungsbereiche der homöopathischen Magie finden sich in einer Gartenmagie, oder besser gesagt Anwendung an Bäumen und Pflanzen, um das Wachstum und den Ertrag zu verbessern, indem um fruchtbaren Boden, wenig Appetit oder ähnliches gebeten wird. Gebeine von toten Menschen haben ebenfalls eine imitative Macht; sie übertragen Eigenschaften des Todes wie Blindheit oder Taubheit auf eine ausgewählte Person. Einbrecher bemächtigen sich diesen Zaubers, indem sie einen Knochen über das Haus werfen, damit während ihrer Arbeit niemand aufwacht, da auch Knochen nicht aufwachen können[25]. Der Glaube an wohlwollend zu stimmende Geister allerdings ist weniger Gegenstand der Magie, sondern eher im Bereich der Religion zu suchen, da Geister keinen magischen Einfluss ausüben können.
Die Übertragungsmagie scheint der imitativen Magie recht ähnlich. Oft wird über eine zu überbrückende Entfernung hin auf eine Person eingewirkt. Hierbei ist es von Nöten, dass eine Beziehung zwischen dem zur Zauberei benutzten Gegenstand und der zu verzaubernden Person besteht. Hier liegt die Idee zugrunde, dass Dinge, „die einmal verbunden waren, für alle Zeiten, selbst wenn sie völlig voneinander getrennt sind, in einer solchen sympathetischen Beziehung zueinander bleiben müssen, daß, was auch immer dem anderen Teil geschieht, den anderen beeinflussen muß[26].“ Ein solches Ding können Haare, Speichel oder Zähne sein, auch die Nabelschnur und der Mutterkuchen spielen eine wichtige Rolle und bedürfen spezieller Riten, damit sie dem Kind ein Leben lang positives Schicksal bescheren. Doch eine Verbindung besteht auch zwischen hinterlassenen Fußspuren in der Erde, die durch Hinzufügen von Glassplittern dem Menschen schaden kann.
2.1.2. Zusammenhänge von Magie, Wissenschaft und Religion
Um Magie weiter zu definieren, ist es zwingend nötig, Frazers Verständnis von Religion und Wissenschaft zu betrachten, da Magie, Wissenschaft und Religion in Beziehung zueinander stehen. Für ihn ist Religion eine „Versöhnung oder Beschwichtigung von Mächten, die dem Menschen übergeordnet sind und von denen er glaubt, daß sie den Lauf der Natur und das menschliche Leben lenken[27].“ Weiter besteht Religion – wie auch Magie – aus einem theoretischen und einem praktischen Element: Man glaubt an dem Menschen höher gestellte Wesen und versucht, jene Mächte wohlwollend zu stimmen.
Magie setzt eine natürliche Kausalkette von Ereignissen voraus, die ohne jegliche Einmischung immer gleichbleibend stattfinden. Diese Auffassung stimmt mit der der modernen Wissenschaft überein. Wendet ein Zauberer einen bestimmten Ritus an, wird bei korrekter Ausführung und ohne die Behinderung durch einen Gegenzauber stets das gewünschte Ergebnis erzielt werden. Dabei sucht er niemals „die Gunst irgendeines wankelmütigen und launischen Wesens zu gewinnen. Er erniedrigt sich vor keiner furchtbaren Gottheit[28].“ Der Magier ist so lange erfolgreich, wie er sich innerhalb den Regeln seiner Kunst, oder vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet den Naturgesetzen, bewegt. Für Frazer ergibt sich hier der Grund, warum er Magie als Pseudowissenschaft deklariert: Missverstandene Assoziationen schaffen den Irrglauben an die Beherrschung der Natur und sind demnach falsch angewandt: Die „richtige Anwendung“ wäre schließlich in der Wissenschaft zu finden[29]. So ist die Grundannahme beider Disziplinen zwar gleich – die Annahme von regelmäßigen Ereignissen, deren Folgen sich voraussehen lassen, sowie die Abstinenz von Glück und Zufall – dennoch gehen die magischen und wissenschaftlichen Weltanschauungen auseinander.
Aus diesen Sichtweisen geht hervor, dass das Schicksal des Menschen in der Religion durch eine dem Gott gefällige Handlung positiv beeinflusst werden kann, jedoch in der Magie und Wissenschaft von einer Starrheit der Natur und somit vom Schicksal des Menschen ausgegangen wird. In der Religion ist das höhere Wesen persönlich und bewusst, der Mensch kann ‚die Meinung des höheren Wesens ändern‘. In der Magie und Wissenschaft ist – durch die Starrheit der Naturgesetze – alles unpersönlich und unbewusst, daher nicht veränderbar[30]. So scheint es für Frazer sinnvoll, Magie als evolutionistischen Vorläufer der Religion und selbige als Vorläufer der Wissenschaft zu betrachten. Durch ein Bewusstwerden, dass Zauberei und Magie den Willen der Natur nicht verändern können, wurde der Übergang zur Religion geebnet, die durch Besänftigung eines höheren Wesens persönlich und bewusst Begebenheiten verändern kann. Erst mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass alles nicht Beeinflussbare und unveränderliche Naturgesetzen zugrunde liegt, erreicht der Mensch nach Frazer die höchste Entwicklungsstufe um das Verständnis der Welt[31].
2.1.3. Beispiele für das Wirken von Magie innerhalb einer Gesellschaft
In seinem WerkDer goldene Zweigbeschreibt Frazer über die Norm begabte Magier als „Gottmensch des magischen Typus[32]“, da er im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der Gesellschaft nicht nur in der Lage ist, auf eigene umliegende Bereiche magisch einzuwirken, sondern auch meist öffentliche Rituale und Zeremonien leitet und durchführt. Sie fungieren als eine Art Berufsmagier, die dem Gemeinwohl mit ihrem Wissen dienlich sind. Durch die Macht der Beeinflussung der Natur ist vielen Magiern auch gleichsam eine höhere Stellung in der Gesellschaft zu Teil geworden. Von Kulturstufe zu Kulturstufe erfahren sie aber eine unterschiedliche Wertschätzung innerhalb ihrer Gesellschaft. Je höher die primitive Kultur ist, desto eher ist ein Magier an der Macht[33]. „Der Glaube, daß Könige magische oder übernatürliche Kräfte besitzen, kraft deren sie die Erde befruchten und ihren Untertanen noch andere Segnungen zuteil werden lassen können[34]“, ist nicht nur bei primitiven Völkern zu finden.
Unter all den bisher genannten Bereichen, in denen Magie wirkt, nimmt die zauberische Beherrschung des Wetters eine besonders wichtige Stellung ein, da auch nicht jeder Magier zu dieser Art von Magie fähig ist. Die Beschwörung von Regen ist meist eine imitative Magie; beispielsweise versucht der Magier durch Verspritzen von Wasser über den Felder Regen zu beschwören oder er imitiert eine Regenwolke[35]. Eine Sonnenfinsternis stellt ein besonders gefürchtetes Ereignis dar. In einer rituellen Zeremonie wird versucht, indem mit brennenden Pfeilen in Richtung der Sonne geschossen wird, die Sonne neu zu entfachen und das weitere Leben zu sichern[36]. „Oft wird [auch] der Sturm als böses Wesen gesehen, das eingeschüchtert, vertrieben oder getötet werden kann[37]“, indem bestimmte Rituale abgehalten werden. Diese Rituale können sich u.a. auf Baumgeister beziehen, da jene anthropomorphen Wesen die Fähigkeit besitzen, das Wetter zu beeinflussen[38].
Zur Stärkung des Selbst praktizieren viele Primitive ein symbolisches Essen oder Trinken von Tieren, um dadurch ihre Kraft zu erneuern oder auch, um die Eigenschaften dieser Tiere auf sich zu übertragen. Auch der Verzehr von Blut und Fleisch der Menschen wirkt sich positiv auf den Menschen aus, da seine guten Eigenschaften während des Essens übertragen werden und somit weiterhin im Dienste der Gemeinschaft stehen können[39].
Auch auf die Seele des Menschen wird mit Magie Einfluss ausgeübt. Die von Frazer beschriebenen primitiven Völker stellen sich die Seele als eine Art kleiner Mensch im Mensch vor, der das Innere bewegt. So erscheint die Vorstellung von der Abwesenheit der Seele im Schlaf oder im bewusstlosen Zustand als plausibel, da der „kleine Mensch“ sich außerhalb des Körpers bewegt. Allgemein, und auch besonders für die Zeit der Seelenwanderung, werden bestimmte Riten in Form von Tabus und Verboten praktiziert, um die Seele vor Gefahren zu beschützen[40]. Die Seele entkommt dem Körper durch seine natürlichen Öffnungen, weswegen bei Kranken, die nicht mehr im Stande sind ihre Seele zu schützen, die Körperöffnungen mit Widerhaken versehen werden, um die Seele im Körper festzuhalten[41].
2.2. Bronislaw Malinowski
Bronislaw Malinowski (1884 – 1942) war ein aus Polen stammender Anthropologe, der die Langzeit-Feldstudie durch seine Feldforschungen auf den Trobriand-Inseln, einer Inselgruppe in Papua-Neuguinea, etablierte, bei denen er seinen Schwerpunkt u.a. auf materielle und psychologische Bereiche der dort lebenden Bevölkerung richtete. Zwar stimmt er überwiegend mit den meisten Ansichten von Frazer bezüglich Magie überein, lehnt jedoch die Evolutionismus-Theorie ab[42].
2.2.1. Magie und ihre Beziehung zu Religion und Wissenschaft
Malinowski stellt in seinem WerkMagie, Religion und Wissenschaftseine verallgemeinernde These vor, dass es keine Völker ohne Religion und Magie gebe. Ebenso sei jedem noch so primitiven Volk eine Vorstellung von Wissenschaft bekannt, was Malinowski zu der Unterscheidung zweier Hauptbereiche im Leben der primitiveren Kulturen führt: Man unterscheidet in dasSakraleund dasProfane, also in die Bereiche Religion und Magie, sowie den der Wissenschaft[43]. Demnach ergibt sich im Alltagsleben ein gewisses Zusammenspiel von Ritualen - also Magie - und Religion, da sie stets mit einem „Glauben an übernatürliche Kräfte verbunden[44]“ sind und dadurch eine Hilfestellung in Situationen von emotionaler Spannung bieten und einen Ausweg aus solchen Bereichen bereithalten. Innerhalb der Religion wird diese Rolle von Geistern getragen, in der Magie durch die Kraft und Wirksamkeit des Zaubers. Magie wird auch hier als praktische Kunst definiert, die innerhalb des sakralen Bereiches fungiert, da sie Handlungen als Mittel für ein festgelegtes Ziel benutzt, während Religion eine in sich abgeschlossene Handlung darstellt, die zeitgleich die Erfüllung des angestrebten Zweckes ist[45].
Besonders aber die Magie steht dem Begriff der Wissenschaft konträr gegenüber:
Wissenschaft entsteht aus Erfahrung, Magie erwächst aus Tradition. Wissenschaft wird durch den Verstand geleitet und durch Beobachtung korrigiert, Magie existiert, beidem unzugänglich, in einer mystischen Atmosphäre. Wissenschaft ist allem offen, ein gemeinsamer Besitz der ganzen Gemeinschaft; Magie ist okkult und wird durch geheimnisvolle Initiationen gelehrt und durch die erbliche oder zumindest durch eine auf sorgfältiger Auswahl beruhende Nachfolge weitergegeben. Während Wissenschaft auf dem Begreifen der Naturkraft basiert, entsteht Magie aus der Vorstellung von einer bestimmten mystischen, unpersönlichen Macht, an die die meisten primitiven Völker glauben. [Man wird] bei den primitivsten Völkern den Glauben an eine übernatürliche, unpersönliche Macht finden, die alle Tätigkeiten in Gang bringt, die für den Primitiven relevant sind, und die alle wirklich wichtigen Vorgänge im sakralen Bereich verursacht[46]. […] Magie beruht auf der spezifischen Erfahrung von Gefühlszuständen, bei der der Mensch nicht die Natur, sondern sich selbst beobachtet, bei der die Wahrheit nicht mit Hilfe des Verstandes gefunden wird, sondern sich durch die unmittelbare Wirkung der Emotionen auf den menschlichen Organismus enthüllt. Wissenschaft beruht auf der Überzeugung, daß Erfahrung, Anstrengung und Vernunft Gültigkeit haben; Magie auf dem Glauben, daß Hoffnung nicht fehlschlagen und der Wunsch nicht trügen kann. Die Theorien der Wissenschaft sind durch Logik bestimmt, die der Magie durch Assoziation von Ideen, die durch Wünsche beeinflußt sind[47].
Dennoch spricht Malinowski Magie und Wissenschaft gemeinsame grundlegende Fähigkeiten zu. Sie verfolgen u. a. gleiche Ziele, die mit menschlichen Trieben, Bedürfnissen und Tätigkeiten zusammenhängen. Beiden liegt, wie Frazer schon erkannte, ein unveränderliches Naturgesetz zu Grunde, dass die Art einer Handlung bzw. der Zauberei vorschreibt und bedingt. Wirkung und Gegenwirkung, oder auch Zauber und Gegenzauber, sind präzise Handlungsweisen, die Einfluss auf die Umwelt vornehmen, weswegen auch Malinowski Magie als Pseudowissenschaft bezeichnet[48].
Sowohl Religion als auch Wissenschaft erfüllen innerhalb der primitiven Gesellschaft eine kulturelle Funktion. Während die Wissenschaft eine Erkenntnis und einen biologischen Vorteil schafft, bringt der religiöse Glaube Hoffnung, Wahrheit und Sinn in die hauptsächlich durch Magie geprägte Kultur. Malinowski beschreibt die primäre Funktion der Magie als eine dem Menschen eine Anzahl fixierter ritueller Akte und Glaubensvorschriften [bietend], eine bestimmte geistige und praktische Methode, die dazu dient, gefährliche Situationen in jeder wichtigen Beschäftigung und kritischen Lage zu überwinden, […] den Optimismus des Menschen zu ritualisieren, seinen Glauben an den Sieg der Hoffnung über Angst zu stärken. Die Magie drückt aus, daß Vertrauen für den Menschen einen größeren Wert hat als Zweifel, Standhaftigkeit größeren Wert als Unbeständigkeit und Optimismus größeren Wert als Pessimismus[49].
Magie wirkt demnach als eine Art Kompromiss aus Wissenschaft und Religion, wobei sich die sakrale Kunst der Magie durch Tradition und Mythen heraus legitimiert[50]und aus rein praktischen Gründen ausgeübt wird[51]. Malinowski sieht den Ursprung der Magie in ausweglosen Situationen begründet, als „ewig unvollkommenen Wall der Kultur[52]“, den es zu überwinden gilt, während seine Feldforschungen zeigen, dass primitive Völker die Magie als schon immer in der Natur vorhandene Kraft ansehen, die nicht entstanden sein kann, aber vom Anbeginn im Besitz der Menschen gewesen ist. Das Wissen um Magie wird tradiert – dies kann durch familiär verpflichtende Bande aber auch durch den Kauf von Wissen geschehen[53]– dabei liegt stets ein Mythos zu Grunde, der die Magie in die kulturellen, alltäglichen Tätigkeiten fest einbindet und ihre Herkunft erklärt.
[...]
[1]Vgl. Weber, Max (1980): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. 5. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck. Seite 308: „Je mehr der Intellektualismus den Glauben an die Magie zurückdrängt, und so die Vorgänge der Welt ‚entzaubert‘ werden, ihren magischen Sinngehalt verlieren, nur noch ‚sind‘ und ‚geschehen‘, aber nichts mehr ‚bedeuten‘, desto dringlicher erwächst die Forderung an die Welt und ‚Lebensführung‘ je als Ganzes, daß sie bedeutungshaft und ‚sinnvoll‘ geordnet seien.“
[2]Kippenberg, Hans G. (1994): Magie. In: Cancik, Hubert (Hg.): Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Band IV, Stuttgart: Kohlhammer, Seite 85 bis 98
[3]Ebd., Seite 85
[4]Name Crowleys, der sich auf 666 – Das große Tier (griechisch:to mega therion) bezieht. Die Zahl 666 spielte eine wesentliche Rolle bei der Kommunikation mitAiwass, siehe3.1. Diary of a Drug Friend - Das Leben Aleister Crowleys
[5]Nähere Ausführungen zur Deklarierung von Crowley als Okkultist siehe Abschnitt3. Aleister Crowleys Magick.
[6]Kippenberg, Hans G. (1994): Magie. Seite 88
[7]Peil, Dietmar (2008): Metapherntheorien. In: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze, Personen, Grundbegriffe. Hrsg. von Ansgar Nünning. Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler. Seite 493
[8]Duden-Eintrag zum Begriff ‚magisch‘: http://www.duden.de/rechtschreibung/magisch. (Stand: 18.07.2012)
[9]Vgl. Graf, Fritz (1996): Gottesnähe und Schadenzauber. Die Magie in der griechisch-römischen Antike. München: C.H. Beck. Seite 24
[10]Haussig, H.W. (Hrsg.) (1971): Herodot. Historien. Deutsche Gesamtausgabe. Übersetzt von A. Horneffer. Neu herausgegeben und erläutert von H. W. Haussig. Mit einer Einleitung von W.F. Otto. Mit 3 Karten. 4. Auflage. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. Vers 1,132
[11]Ebd., Vers 1,107f.
[12]Vgl. ebd. Vers 3,65 - 80. Kambyses II tötete seinen Bruder Smerdis, da er durch einen Traum eine Machtübernahme befürchtet. Später wurde ein „falscher Smerdis“ an seiner statt eingesetzt und regierte das persische Reich bis hin zu seiner Ermordung.
[13]Vgl. Graf, Fritz (1996): Gottesnähe und Schadenzauber. Seite 24ff.
[14]Vgl.: Hansen, Joseph (1983): Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entstehung der großen Hexenverfolgung. 2. Auflage. Aalen: Scientia Verlag. Seite 7 / 15. Weber, Kristin (2010): Die Konstruktion eines Übeltäters: Der Hexenmeister. In: Karfunkel – Kraut und Hexe, 03/2010, Seite 24 bis 27, hier: Seite 27. Behringer, Wolfgang (2009): Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung. 5. Auflage. München: Verlag C.H.Beck, Seite 36
[15]Scherer, Wilhelm (1888): Poetik. Hildesheim: Georg Olms Verlag, Seite 113
[16]Vgl. Stockhammer, Robert (2000): Zaubertexte. Seite 29
[17]Vgl. ebd., Seite 39
[18]Barfield, Thomas (Hg.) (2008): The Dictionary of Anthropology. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.. Seite 207
[19]Vgl. Ebd., Seite 206ff.
[20]Frazer, James George (1994): Der goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Völker. Köln: Kiepenheuer & Witsch. Seite 17
[21]Ebd., Seite 16
[22]Ebd., Seite 52
[23]Ebd., Seite 22f.
[24]Ebd., Seite 23
[25]Ebd., Seite 42f.
[26]Ebd., Seite 54
[27]Ebd., Seite 72
[28]Ebd., Seite 70
[29]Ebd., Seite 71
[30]Ebd., Seite 74
[31]Ebd., Seite 79
[32]Ebd., Seite 87
[33]Vgl. ebd., Seite 122
[34]Ebd., Seite 129
[35]Vgl. ebd., Seite 91
[36]Vgl. ebd., Seite 112
[37]Ebd., Seite 118
[38]Vgl. ebd., Seite 172
[39]Vgl. ebd., Seite 718ff.
[40]Vgl. ebd., Seite 261
[41]Vgl. ebd., Seite 263
[42]Vgl. Barfield, Thomas (Hg.) (2008): The Dictionary of Anthropology. Seite 300ff.
[43]Malinowski, Bronislaw (1973): Magie, Wissenschaft und Religion. Und andere Schriften. Frankfurt / Main: Fischer Verlag. Seite 3
[44]Vgl. ebd., Seite 3
[45]Vgl. ebd., Seite 71f.
[46]Ebd., Seite 5
[47]Ebd., Seite 70f.
[48]Vgl. ebd., Seite 70
[49]Ebd., Seite 73f.
[50]Vgl. ebd., Seite 59
[51]Vgl. Ebd., Seite 54
[52]Ebd., Seite 65
[53]Vgl. Malinowski, Bronislaw (1979): Argonauten des westlichen Pazifik. Ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea. Frankfurt / Main: Syndikat Autoren- und Verlagsgesellschaft. Seite 104
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783842841376
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Koblenz-Landau – Kulturwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (März)
- Note
- 1,3
- Produktsicherheit
- Diplom.de