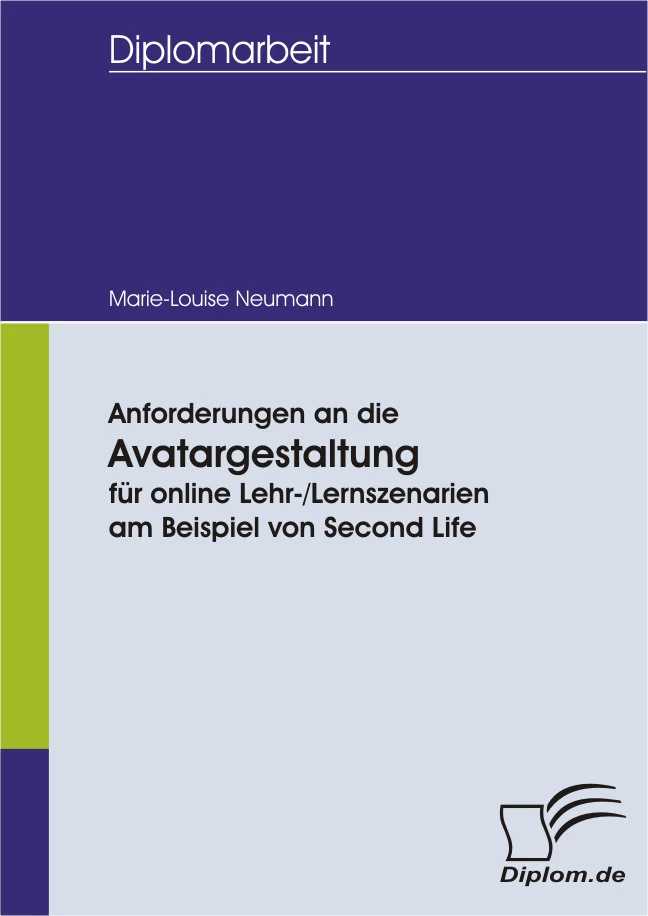Anforderungen an die Avatargestaltung für online Lehr-/Lernszenarien am Beispiel von Second Life
©2012
Diplomarbeit
96 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Fittkau und Maaß (2008) führten im Jahr 2007 eine schriftliche Internet-Umfrage (25. WWW-Benutzer-Analyse (W3B)) zu den Personen, die Second Life aktiv nutzen, durch. Die Stichprobe umfasste 100.272 deutschsprachige Personen (vgl. Fittkau und Maaß 2008b, Übersicht zum Report, www). 71,4% der gesamten Internet-Nutzer (m/w) war die virtuelle Welt Second Life ein Begriff. Junge Menschen unter 20 Jahren waren mit 83,7% der größte Teil der befragten Personen. Knapp darauf folgten junge Erwachsene im Alter von 20-29 Jahren mit 82,0%. Insgesamt war Second Life zu der Zeit mit 75,3% Männern bekannter als Frauen (67,2%).
Second Life ist heutzutage nicht nur sehr bekannt, sondern hat auch den Einstieg in den Sektor Bildung geschafft. Die Universität Duisburg-Essen führte beispielsweise im Sommersemester 2009 erneut ein Seminar in Second Life durch, in der sie auch mit entsprechendem Land und Universitätsgebäuden vertreten ist. Um teilnehmen zu können, haben sich die Teilnehmer auf dieser Plattform angemeldet und einen sogenannten 'Avatar' mit Phantasienamen kreiert. Mit diesen virtuellen Stellvertretern sind die Studenten (m/w) der Dozentin in Second Life gegenüber getreten. Die Kommunikation hat via Ton und Schrift stattgefunden, während je nach Anforderung zusätzlich die Avatare gesteuert wurden. Die Teilnehmer (m/w) hatten bei der Wahl und Gestaltung ihrer Avatare vielfältige Möglichkeiten und konnten sie an persönliche Präferenzen anpassen.
Die Avatargestaltung erhebt jedoch keinen Anspruch auf reale Übereinstimmung mit dem Menschen, der den Avatar nutzt. Daraus resultiert das Problem, dass die jeweilige Lehrperson auf Basis ihres individuellen Avatars wahrgenommen wird. So kann der erste Eindruck von dem Avatar, ob bewusst oder unbewusst, darüber entscheiden, ob die Teilnehmer (m/w) den Seminarleiter (m/w) als kompetent einschätzen, innerhalb der Veranstaltung mitarbeiten und von den Erfahrungen und Inhalten profitieren oder nicht.
Bisherige Avatarstudien befassten sich beispielsweise mit der Identitätsbildung und der Ähnlichkeit zwischen Nutzer (m/w) und Avatar. Bisher blieb jedoch offen, welche Avatare sich als Stellvertreter (m/w) für Lehrpersonen in virtuellen Welten wie Second Life eignen. Unter Eignung wird hierbei verstanden, dass die Avatare als positiv, genauer kompetent, eingeschätzt werden, damit die Lernenden den Lehrpersonen, die durch die Avatare wirken, Respekt entgegenbringen und damit sowohl die Mitarbeit […]
Fittkau und Maaß (2008) führten im Jahr 2007 eine schriftliche Internet-Umfrage (25. WWW-Benutzer-Analyse (W3B)) zu den Personen, die Second Life aktiv nutzen, durch. Die Stichprobe umfasste 100.272 deutschsprachige Personen (vgl. Fittkau und Maaß 2008b, Übersicht zum Report, www). 71,4% der gesamten Internet-Nutzer (m/w) war die virtuelle Welt Second Life ein Begriff. Junge Menschen unter 20 Jahren waren mit 83,7% der größte Teil der befragten Personen. Knapp darauf folgten junge Erwachsene im Alter von 20-29 Jahren mit 82,0%. Insgesamt war Second Life zu der Zeit mit 75,3% Männern bekannter als Frauen (67,2%).
Second Life ist heutzutage nicht nur sehr bekannt, sondern hat auch den Einstieg in den Sektor Bildung geschafft. Die Universität Duisburg-Essen führte beispielsweise im Sommersemester 2009 erneut ein Seminar in Second Life durch, in der sie auch mit entsprechendem Land und Universitätsgebäuden vertreten ist. Um teilnehmen zu können, haben sich die Teilnehmer auf dieser Plattform angemeldet und einen sogenannten 'Avatar' mit Phantasienamen kreiert. Mit diesen virtuellen Stellvertretern sind die Studenten (m/w) der Dozentin in Second Life gegenüber getreten. Die Kommunikation hat via Ton und Schrift stattgefunden, während je nach Anforderung zusätzlich die Avatare gesteuert wurden. Die Teilnehmer (m/w) hatten bei der Wahl und Gestaltung ihrer Avatare vielfältige Möglichkeiten und konnten sie an persönliche Präferenzen anpassen.
Die Avatargestaltung erhebt jedoch keinen Anspruch auf reale Übereinstimmung mit dem Menschen, der den Avatar nutzt. Daraus resultiert das Problem, dass die jeweilige Lehrperson auf Basis ihres individuellen Avatars wahrgenommen wird. So kann der erste Eindruck von dem Avatar, ob bewusst oder unbewusst, darüber entscheiden, ob die Teilnehmer (m/w) den Seminarleiter (m/w) als kompetent einschätzen, innerhalb der Veranstaltung mitarbeiten und von den Erfahrungen und Inhalten profitieren oder nicht.
Bisherige Avatarstudien befassten sich beispielsweise mit der Identitätsbildung und der Ähnlichkeit zwischen Nutzer (m/w) und Avatar. Bisher blieb jedoch offen, welche Avatare sich als Stellvertreter (m/w) für Lehrpersonen in virtuellen Welten wie Second Life eignen. Unter Eignung wird hierbei verstanden, dass die Avatare als positiv, genauer kompetent, eingeschätzt werden, damit die Lernenden den Lehrpersonen, die durch die Avatare wirken, Respekt entgegenbringen und damit sowohl die Mitarbeit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Marie-Louise Neumann
Anforderungen an die Avatargestaltung für online Lehr-/Lernszenarien am Beispiel von
Second Life
ISBN: 978-3-8428-4446-9
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2013
Zugl. Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Deutschland, Diplomarbeit, 2012
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2013
Abstract
Das Thema dieser Arbeit ist die Gestaltung von Avataren, die dabei hilfreich
sein kann, wenn Avatare innerhalb beruflicher Kontexte online eingesetzt
werden sollen. Als theoretische Fundierung wird die Theorie der
symbolischen Selbstergänzung nach Wicklund und Gollwitzer gewählt.
Innerhalb der Theorie streben Personen mit Selbstzielen nach bestimmten
Symbolen, um ihre Bestrebung anderen Menschen zu signalisieren. Die
Prämisse dieser Arbeit besteht darin, dass eine Lehrperson sich bei Online-
Seminaren durch die Gestaltung ihres Avatars selbst ergänzt, um auf ihr Ziel
,,kompetente Lehrperson" in virtuellen Szenarien hinzudeuten. Die
Fragestellungen sind daher, ob menschliche Avatare positiver eingeschätzt
werden als nicht-menschliche Avatare, welchen Einfluss die private oder
berufliche Nutzung sowie die zeitliche Nutzung von Second Life auf die
Avatarbewertung haben und ob Unterschiede zwischen den Geschlechtern,
Altersgruppen und Bildungsabschlüssen erkennbar sind. Als Methode wird
ein Online-Fragebogen verwendet, um die Personen, die Second Life nutzen,
zu erreichen und verschiedene Avatare bewerten zu lassen. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Zusammenhänge insgesamt schwach ausgeprägt und die
Werte nur in Teilbereichen aussagekräftig sind.
III
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
V
TABELLENVERZEICHNIS
VI
1. EINLEITUNG
1
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
3
2.1 Theorie der symbolischen Selbstergänzung
3
2.1.1 Grundlegende Begriffe
4
2.1.1.1 Symbole der Vollständigkeit
5
2.1.1.2 Verbindliche Zielsetzung
6
2.1.1.3 Soziale Realität
7
2.1.2 Die zentralen Hypothesen
7
2.1.2.1 Studien zur Kompensationshypothese
8
2.1.2.2 Studien zur sozialen Realisierungshypothese
10
2.1.2.3 Studien zur sozialen Insensibilitätshypothese
13
2.1.3 Aktuelle Forschung: Symbolische Selbstergänzung im Hochschulbereich
15
2.2 Avatare im Fokus der Forschung
17
2.2.1 Avatarkategorien in Spielen
18
2.2.2 Die Wirkung von Avatareigenschaften und -gestaltungen
19
2.2.3 Avatare in Second Life
21
2.3 Transfer der theoretischen Modelle
22
2.4 Die Kompetenzen einer Lehrperson
22
2.5 Forschungsfragen
24
3. METHODE
24
3.1 Wahl der Methode
25
3.2 Operationalisierung
26
3.3 Aufbau des Fragebogens
28
3.3.1 Frage-Typen
29
3.3.2 Die Wahl der Avatare
30
3.4 Ziehung der Stichprobe
31
3.5 Pretest
32
3.6 Auswahl der Online-Foren
32
3.7 Durchführung der Online-Umfrage
33
IV
3.8 Hypothesenbildung
34
4. ERGEBNISSE
40
5. DISKUSSION
60
6. AUSBLICK
65
LITERATURVERZEICHNIS
VII
ANHANG
IX
Anlage A: Foreneinträge
IX
Anlage B: Screenshots des Online-Fragebogens
XI
Anlage C: Häufigkeitstabellen zu den Hypothesen 1 und 2
XVI
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Items zur Avatareinschätzung (Eigene Darstellung)
27
Abbildung 2: Geschlecht der befragten Personen (Eigene Darstellung)
40
Abbildung 3: Alter der befragten Personen (Eigene Darstellung)
41
Abbildung 4: Foreneintrag 1 (Eigene Darstellung)
IX
Abbildung 5: Foreneintrag 2 (Eigene Darstellung)
IX
Abbildung 6: Foreneintrag 3 (Eigene Darstellung)
X
Abbildung 7: Fragebogen Willkommen zur Umfrage (Eigene Darstellung)
XI
Abbildung 8: Fragebogen Szenario der Befragung (Eigene Darstellung) XI
Abbildung 9: Fragebogen Weiblicher Avatar (Eigene Darstellung)
XII
Abbildung 10: Fragebogen Dinosaurier-Avatar (Eigene Darstellung)
XII
Abbildung 11: Fragebogen Baumstamm-Avatar (Eigene Darstellung) XIII
Abbildung 12: Fragebogen Männlicher Avatar (Eigene Darstellung)
XIII
Abbildung 13: Fragebogen Weiblicher Furry-Avatar (Eigene Darstellung)
XIV
Abbildung 14: Fragebogen Nutzung Kontext (Eigene Darstellung)
XIV
Abbildung 15: Fragebogen Nutzung Tage (Eigene Darstellung)
XIV
Abbildung 16: Fragebogen Geschlecht (Eigene Darstellung)
XV
Abbildung 17: Fragebogen Alter (Eigene Darstellung)
XV
Abbildung 18: Fragebogen Höchster Bildungsabschluss (Eigene
Darstellung)
XV
Abbildung 19: Fragebogen Danksagung (Eigene Darstellung)
XV
VI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Höchster Bildungsabschluss (Eigene Darstellung)
42
Tabelle 2: Nutzung Tage (Eigene Darstellung)
42
Tabelle 3: Übersicht über die p-Werte nach dem exakten Fisher-Test für
nicht-menschliche Avatare (Eigene Darstellung)
46
Tabelle 4: Avatarbewertung Dinosaurier Item ,,unseriös-seriös" mit
Nutzungsart (Eigene Darstellung)
47
Tabelle 5: Avatarbewertung Dinosaurier Item ,,inkompetent-kompetent"
mit Nutzungsart (Eigene Darstellung)
48
Tabelle 6: Übersicht über die r-Werte nach Spearmans Rangkorrelationstest
für nicht-menschliche Avatare (Eigene Darstellung)
49
Tabelle 7: Übersicht über die p-Werte nach Fisher für den Furry-Avatar
(Eigene Darstellung)
51
Tabelle 8: Übersicht über die p-Werte nach Fisher für den weiblichen
Avatar (Eigene Darstellung)
52
Tabelle 9: Kreuztabelle zum weiblichen Avatar Item ,,unattraktiv-
attraktiv" (Eigene Darstellung)
53
Tabelle 10: Kreuztabelle zum weiblichen Avatar Item ,,unseriös-seriös"
(Eigene Darstellung)
54
Tabelle 11: Kreuztabelle zum weiblichen Avatar Item ,,unterwürfig-
durchsetzungsfähig" (Eigene Darstellung)
55
Tabelle 12: Übersicht über die Werte von Kendalls Tau-b für die
menschlichen Avatare (Eigene Darstellung)
56
Tabelle 13: Kreuztabelle Altersangaben für weiblichen Avatar Item
,,unattraktiv-attraktiv" (Eigene Darstellung)
58
Tabelle 14: Übersicht über die Werte von Kendalls Tau-b für die nicht-
menschlichen Avatare (Eigene Darstellung)
59
1
1. Einleitung
Fittkau und Maaß (2008) führten im Jahr 2007 eine schriftliche Internet-
Umfrage (25. WWW-Benutzer-Analyse (W3B)) zu den Personen, die
Second Life aktiv nutzen, durch. Die Stichprobe umfasste 100.272
deutschsprachige Personen (vgl. Fittkau und Maaß 2008b, Übersicht zum
Report, www). 71,4% der gesamten Internet-Nutzer (m/w) war die virtuelle
Welt Second Life ein Begriff. Junge Menschen unter 20 Jahren waren mit
83,7% der größte Teil der befragten Personen. Knapp darauf folgten junge
Erwachsene im Alter von 20-29 Jahren mit 82,0%. Insgesamt war Second
Life zu der Zeit mit 75,3% Männern bekannter als Frauen (67,2%).
Second Life ist heutzutage nicht nur sehr bekannt, sondern hat auch den
Einstieg in den Sektor Bildung geschafft. Die Universität Duisburg-Essen
führte beispielsweise im Sommersemester 2009 erneut ein Seminar in
Second Life durch, in der sie auch mit entsprechendem Land und
Universitätsgebäuden vertreten ist. Um teilnehmen zu können, haben sich
die Teilnehmer auf dieser Plattform angemeldet und einen sogenannten
,,Avatar" mit Phantasienamen kreiert. Mit diesen virtuellen Stellvertretern
sind die Studenten (m/w) der Dozentin in Second Life gegenüber getreten.
Die Kommunikation hat via Ton und Schrift stattgefunden, während je nach
Anforderung zusätzlich die Avatare gesteuert wurden. Die Teilnehmer
(m/w) hatten bei der Wahl und Gestaltung ihrer Avatare vielfältige
Möglichkeiten und konnten sie an persönliche Präferenzen anpassen.
Die Avatargestaltung erhebt jedoch keinen Anspruch auf reale
Übereinstimmung mit dem Menschen, der den Avatar nutzt. Daraus
resultiert das Problem, dass die jeweilige Lehrperson auf Basis ihres
individuellen Avatars wahrgenommen wird. So kann der erste Eindruck von
dem Avatar, ob bewusst oder unbewusst, darüber entscheiden, ob die
Teilnehmer (m/w) den Seminarleiter (m/w) als kompetent einschätzen,
2
innerhalb der Veranstaltung mitarbeiten und von den Erfahrungen und
Inhalten profitieren oder nicht.
Bisherige Avatarstudien befassten sich beispielsweise mit der
Identitätsbildung und der Ähnlichkeit zwischen Nutzer (m/w) und Avatar.
Bisher blieb jedoch offen, welche Avatare sich als Stellvertreter (m/w) für
Lehrpersonen in virtuellen Welten wie Second Life eignen. Unter Eignung
wird hierbei verstanden, dass die Avatare als positiv, genauer kompetent,
eingeschätzt werden, damit die Lernenden den Lehrpersonen, die durch die
Avatare wirken, Respekt entgegenbringen und damit sowohl die Mitarbeit
als auch der Lernerfolg begünstigt werden können.
Im Rahmen dieser Arbeit werden Avatare als virtuelle Stellvertreter (m/w)
für Online-Lehrende betrachtet. Ziel dieser Diplomarbeit ist es festzustellen,
welche Avatargestaltungen positiv, das heißt kompetent, auf Second-Life-
Nutzer (m/w) wirken. Dabei liegt der Fokus ausschließlich auf
avatarbasierten Online-Lernumgebungen. Die Avatargestaltung wird am
Beispiel von Second Life thematisiert. Programmierte, softwaregesteuerte
Avatare werden nicht behandelt.
Diese Arbeit beinhaltet folgende Forschungsfragen:
1. Werden menschliche Avatare positiver eingeschätzt als tierische
oder sachliche?
2. Welchen Einfluss hat die Art der Nutzung (beruflich/privat) sowie
die Vielnutzung von Second Life, das heißt fünf bis sieben Tage
wöchentlich, auf die Avatareinschätzung?
3. Gibt es geschlechts-, alters- und bildungsabhängige Unterschiede in
der Avatareinschätzung?
Das theoretische Kapitel stellt die Theorie der symbolischen
Selbstergänzung nach Wicklund und Gollwitzer im Hinblick auf die
grundlegenden Termini und bisherigen Forschungsergebnisse vor. Daraufhin
wird die gegenwärtige Avatarforschung skizziert. Die theoretischen
Hintergründe werden verwendet, um auf das Thema dieser Arbeit
3
überzuleiten. Es werden zusätzlich die verschiedenen Kompetenzen von
Lehrpersonen behandelt, um eine Definitionsgrundlage zu schaffen. Der
Methodenteil stellt einen Online-Fragebogen in Verbindung mit dem
semantischen Differential als Methode für die Datengewinnung vor. Das
Fragebogendesign, die Avatar- und Forenselektion, die Strichprobenziehung
sowie die Durchführung von Pretest und Umfrage werden thematisiert. Das
Methodenkapitel schließt mit den einzeln formulierten Hypothesen, die im
Ergebnisteil auf auffällige Ergebnisse und Signifikanz geprüft werden.
Zuletzt werden die Resultate diskutiert und ein Ausblick auf zukünftige
Forschungsansätze gegeben. Das Ergebnis soll Lehrpersonen, die bereits in
virtuellen Szenarien auftreten oder es vorhaben, Hinweise für ihre
Avatargestaltung liefern.
2. Theoretische Grundlagen
Im Folgenden werden die Theorie der symbolischen Selbstergänzung nach
Wicklund und Gollwitzer (1980, 1981, 1982, 1983, 1985; Gollwitzer,
Wicklund & Hilton 1982; Gollwitzer, Bayer & Wicklund 2002) und aktuelle
Avatarforschungen thematisiert.
Die behandelten Theorien werden im Anschluss auf das Thema dieser
Arbeit übertragen. Da die Kompetenzen, die eine Lehrperson besitzen sollte,
dabei eine wichtige Rolle spielen, runden sie das theoretische Kapitel ab
und leiten zu den Forschungsfragen über.
2.1 Theorie der symbolischen Selbstergänzung
Die Theorie der symbolischen Selbstergänzung nach Wicklund und
Gollwitzer thematisiert das Streben einer Person nach Selbstzielen, das heißt
nach dem Status, den sie zu erreichen wünscht (vgl. Gollwitzer et al. 2002,
S. 193).
4
Eine Person verfolgt beispielsweise das Selbstziel ,,Lehrender (m/w)". Es
mangelt ihr jedoch an Erfahrung, die als Indikator für diesen Status dienen
kann. Sie unternimmt daher selbstsymbolisierende Anstrengungen (vgl.
Wicklund und Gollwitzer 1981, S. 90), indem sie sich durch fallbezogene
Fachliteratur weiterbildet, Schulungen besucht und selbstorganisierte
Seminare durchführt. Dieses Beispiel veranschaulicht, dass sich Personen
bei einem Gefühl von Unvollständigkeit alternativer Symbole bedienen. Bei
bereits vorhandenen Erfahrungen sind Statussymbole dagegen überflüssig
(vgl. Wicklund und Gollwitzer 1980, S. 56).
Die Kernhypothese der Selbstergänzungstheorie besagt, dass die Indikatoren
beziehungsweise Symbole der Vollständigkeit gegeneinander austauschbar
sind (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1983, S. 67). Wenn ein selbstbezogenes
Ziel vorhanden ist, kann ein notwendiges Symbol möglicherweise
unerreichbar sein. In dem Fall können alternative Symbole als Ersatz
dienen, es gilt das Substitutionsprinzip. (vgl. Gollwitzer et al. 2002, S. 194)
Unter bestimmten Umständen kann die Person ihre Identitätsziele auch
aufgeben: Sie erfüllt die Voraussetzungen nicht, ein neues Ziel kollidiert mit
dem alten oder ihre Selbstsymbolisierungen werden wiederholt nicht
wahrgenommen oder falsch interpretiert (vgl. Gollwitzer et al. 2002, S.
206).
2.1.1 Grundlegende Begriffe
Die Theorie der symbolischen Selbstergänzung beinhaltet die
grundlegenden Begriffe ,,Symbole der Vollständigkeit", ,,verbindliche
Zielsetzung" und ,,soziale Realität" (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1980, S.
59), die nachfolgend behandelt werden.
5
2.1.1.1 Symbole der Vollständigkeit
Um sich selbstbezogenen Zielen anzunähern, ist es notwendig, sozial
festgelegte Zielindikatoren zu erwerben. Nach der Theorie der symbolischen
Selbstergänzung sind die Zielindikatoren sogenannte Symbole einer
Selbstdefinition, die das Identitätsziel darstellt. Die Selbstdefinition nimmt
durch den ,,Gebrauch und Besitz" der Symbole, die ihre Einzelteile sind,
ihre Form an. Zu den Symbolvarianten zählen Körpersprache, materielle
Zielindikatoren und verbale Ausdrücke, zum Beispiel Selbstbeschreibungen.
(vgl. Gollwitzer et al. 2002, S. 193)
Die Symbole heben sich darin voneinander ab, wie zugänglich und
dauerhaft sie sind. Wer sich unvollständig fühlt, sucht nach schnell
erreichbaren Symbolen, beispielsweise materiellen Gegenständen oder neigt
zur Prahlerei. Da die Symbole jedoch nicht beständig sind, erfährt die
Person wiederum symbolische Unvollständigkeit. Sogenannte
höherwertigere ,,unvergängliche" Symbole, wie eine Berufsausbildung, sind
langfristig angelegt, erfordern allerdings mehr Zeit und Anstrengung als ein
schnell vollzogener Kauf. (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1980, S. 63)
Welche Symbole hilfreich sind, um die Selbstdefinition zu unterstreichen,
spiegeln die Gesellschaft und die jeweilige Gruppenzugehörigkeit wider, da
sich Mitglieder jeweils an bestimmte Regeln zu halten haben, um anerkannt
zu werden. Der Zugang zu den Symbolen muss möglich sein, da die
Selbstdefinition sonst nicht ausgestaltet werden kann. Der Erwerb von
Symbolen zeigt, dass eine Person eine bestimmte Selbstdefinition anstrebt.
Die Person muss davon überzeugt sein, dass die Symbole zur Kenntnis
genommen werden. In dem Fall ist die ,,soziale Realisierung des
erworbenen Symbols vollzogen". (vgl. Gollwitzer et al. 2002, S. 194)
Die Verwendung und Darstellung von Symbolen zeigt anderen Menschen,
dass die potentiell von der Selbstdefinition abhängigen Leistungen
vorhanden sind (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1983, S. 69) und ob die
Person ihr Selbstziel erreicht hat. Sie besitzen implizit ,,soziale Realität"
6
(vgl. Kapitel 2.1.1.3), beispielsweise in Form von Titeln, und werden
dadurch für andere Menschen sichtbar. Ein Symbol, das eine hohe soziale
Realität erreicht, eignet sich besser dafür, die Vollständigkeit eines
Selbstziels darzustellen, als ein Symbol mit geringerer sozialer Realität.
Wenn eine Person sich selbst anderen Menschen gegenüber positiv
beschreibt, formt sich bei ihr ein Gefühl der Vollständigkeit. (vgl. Wicklund
und Gollwitzer 1980, S. 59)
In dem Fall, wenn sich eine Person mit einem Identifikationsbegriff, wie
Dozent (m/w), vorstellt, wird angenommen, dass ihre Qualifikation an
ihrem Verhalten ablesbar ist. Ohne Beweise dafür zu haben, werden der
Person Kompetenzen und Fähigkeiten zugewiesen, wenn sie positiv von
ihren Eigenschaften spricht. Von den zur Schau gestellten Statussymbolen
werden Qualifikationen abgeleitet, obwohl sich dabei nicht automatisch und
korrekt darauf schließen lässt, dass eine Person auch hält, was sie verspricht.
(vgl. Wicklund und Gollwitzer 1980, S. 56)
2.1.1.2 Verbindliche Zielsetzung
Eine Person setzt sich ein Ziel, das ihr wichtig ist, und verpflichtet sich
diesem Ziel (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1980, S. 59). Dadurch entsteht
nach Lewin (1926) ein ,,Quasibedürfnis", das als Druck oder innerer
Spannungszustand verstanden werden kann. Diese Spannung nimmt das
Individuum wahr, wenn es beispielsweise bei einer Handlung unterbrochen
wird (vgl. Lewin 1926, S. 348). Ihre Dauer ist davon abhängig, wie lange
sich das Individuum seinem Ziel verpflichtet fühlt (vgl. Wicklund und
Gollwitzer 1980, S. 63). Sobald die Handlung ausgeführt und das Ziel
erreicht wurde, wird das Quasibedürfnis befriedigt, sodass die Spannungen
verschwinden (vgl. Lewin 1926, S. 384).
Die Verpflichtung zu einer Selbstdefinition, auch ,,Commitment" (vgl.
Wicklund und Gollwitzer 1981, S. 92) genannt, kann als Ziel ausgelegt
werden und signalisiert das Streben der Person, diese ,,ideale" Bedingung zu
7
erreichen, die alle für die Selbstdefinition angemessenen Qualitäten
beinhaltet. Diese Aktivitäten müssen nicht tatsächlich ausgeführt werden.
Die Person mit der Selbstdefinition behauptet lediglich, dass sie das
Potential zur Ausführung hat. (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1983, S. 69)
Ob sich eine Person einer Selbstdefinition verpflichtet hat, lässt sich durch
verschiedene Methoden feststellen. Die Person kann nach wichtigen
Aspekten des Selbst gefragt werden. Das offenkundige Verhalten der Person
kann beobachtet werden, um ihre Bestrebungen hinsichtlich der
Selbstdefinition abzulesen. Es können auch die Ergebnisse des bisherigen
Engagements der Person untersucht werden, die sich auf relevante
selbstdefinierende Aktivitäten beziehen. Indem die Person bei diesen
Aktivitäten unterbrochen wird, kann überprüft werden, ob die Person einer
Selbstdefinition verpflichtet ist und Ersatzsymbole weiterverfolgt. (vgl.
Wicklund und Gollwitzer 1982, S. 3839)
2.1.1.3 Soziale Realität
Eine Person bietet Symbole dar, um anderen Menschen zu signalisieren,
dass die für ihr Selbstziel notwendigen Eigenschaften vorhanden sind.
Sobald eine Person über ein Symbol verfügt, sollte sie das Gefühl haben,
dass sie sich ihrer Vollständigkeit annähert. Es ist jedoch wichtig, dass
andere Personen die Vollständigkeit der Selbstdefinition potentiell
anerkennen. Dazu sollten die Symbole für möglichst viele Menschen
sichtbar sein. (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1983, S. 70)
2.1.2 Die zentralen Hypothesen
Wicklund und Gollwitzer formulierten die folgenden drei Hypothesen, um
die Theorie der symbolischen Selbstergänzung zu prüfen (vgl. Gollwitzer et
al. 2002, S. 195200):
1.
,,Personen, die sich ein selbstbezogenes Ziel gesetzt haben,
versuchen, den Mangel an relevanten Symbolen durch das
8
Zurschaustellen alternativer Symbole auszugleichen. Derartige
Anstrengungen einer Person heißen ,selbstsymbolisierende
Handlungen'." (Die Kompensationshypothese)
2. ,,Die Effektivität selbstsymbolisierender Handlungen im Sinne der
Ausgestaltung einer Selbstdefinition ist an die soziale
Kenntnisnahme erworbener Symbole gebunden." (Die soziale
Realisierungshypothese)
3. ,,Die Person, die eine selbstsymbolisierende Handlung ausübt,
vernachlässigt die psychische Befindlichkeit (Gedanken, Motive,
Einstellungen, usw.) der sie umgebenden Personen und ist allein
darauf fixiert, dass andere die selbstsymbolisierende Handlung zur
Kenntnis nehmen." (Die soziale Insensibilitätshypothese)
Zu jeder Hypothese sind empirische Arbeiten vorhanden. In den
Untersuchungen wurde die symbolische Unvollständigkeit entweder durch
die Unterbrechung der Aktivität manipuliert, die das Selbst symbolisierte,
oder durch das Hervorheben eines Symbols (vgl. Wicklund und Gollwitzer
1980, S. 61).
Die Studien waren so aufgebaut, dass zuerst ein bestimmter symbolischer
Mangel festgestellt werden musste, über den die Versuchspersonen keine
Kontrolle hatten. Daraufhin benötigten die Versuchspersonen Zugang zu
Mitteln der Selbstsymbolisierung. Zur Wahl standen die Möglichkeiten, sich
neue symbolische Indikatoren, wie Statussymbole, anzueignen oder durch
die Ausbreitung unmittelbarer sozialer Realität, wie durch
Selbstbeschreibungen oder sozialen Einfluss, die angestrebte
Selbstdefinition zu bewerben. (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1981, S. 93)
2.1.2.1 Studien zur Kompensationshypothese
Die Studien waren so konstruiert, dass die Versuchsteilnehmer ein
bestimmtes Selbstziel hatten. Von den Versuchspersonen wurde die Hälfte
darüber informiert, dass ein für ihr Selbstziel relevantes Symbol fehlte. Die
zweite Hälfte erhielt keine Information darüber. In einem weiteren Versuch,
der vom ersten unabhängig erschien, hatten die Versuchspersonen die
9
Gelegenheit, sich ein alternatives Symbol anzueignen oder ihr soziales
Umfeld darüber in Kenntnis zu setzen, dass es bereits vorhanden sei. Es
wurde daraufhin beobachtet, ob die Versuchspersonen mit ,,Mangelerleben",
das heißt mit dem fehlenden Symbol, sich im Vergleich zu den nicht
informierten Versuchspersonen mehr anstrengten, um das kompensierende
Symbol zu erwerben. (vgl. Gollwitzer et al. 2002, S. 195)
Wicklund und Gollwitzer (1981) zeigten in zwei korrelierenden Studien,
dass je weniger Bildung oder Berufserfahrung die Versuchspersonen hatten,
desto mehr wünschten sie, andere Menschen zu beeinflussen. Die
Versuchspersonen, die in einer Studie während des Schreibens eines
positiven selbstbeschreibenden Textes unterbrochen wurden, zeigten
deutlichere Versuche, andere Personen zu beeinflussen als
Versuchspersonen, denen es erlaubt war, den Text zu vollenden. Eine
weitere Studie untersuchte Selbstbeschreibungen als selbstsymbolisierende
Bestrebung. Die Unvollständigkeit wurde variiert, indem frühere auffällige
Lehrer abgefragt wurden, die entweder positive oder negative Wirkung auf
die Versuchspersonen hatten. Wenn daraufhin Druck auf die
Versuchspersonen ausgeübt wurde, sich selbst innerhalb ihrer einzelnen
Bereiche negativ zu charakterisieren, waren die Personen, die sich an einen
positiven Lehrer (m/w) erinnerten, am ehesten gewillt, sich negativ zu
darzustellen. (vgl. Wicklund und Gollwitzer 1981, S. 89)
Gollwitzer, Wicklund und Hilton (1982) untersuchten die Anerkennung von
Misserfolg in Verbindung mit der symbolischen Selbstergänzung, indem die
Relation zwischen einer selbstunterstützenden und einer
selbsterniedrigenden Aktion betrachtet wurde. Die Versuchspersonen
führten die selbstrelevanten Handlungen im Kontext ihrer
Selbstdefinitionen, zum Beispiel Journalist (m/w), durch, zu denen die
Personen aktiv verpflichtet wurden. Die Versuchspersonen hatten im
Rahmen des ersten Experiments die Aufgabe, einen unterstützenden
selbstbeschreibenden Aufsatz zu verfassen, der später von anderen Personen
gelesen werden sollte. Die Hälfte beendete den Aufsatz, während die andere
Hälfte der Versuchspersonen unterbrochen wurde. Im Anschluss wurden
10
alle Versuchspersonen in einem anderen Kontext gebeten, die Fehler, die sie
zuvor im Bereich ihrer jeweiligen Selbstdefinitionen gemacht hatten,
aufzulisten. Das Ergebnis zeigte, dass die Versuchspersonen, die keiner
Unterbrechung ausgesetzt waren, bereitwilliger ihre Fehler zugaben als
unterbrochene Versuchspersonen. (vgl. Gollwitzer et al. 1982, S. 358)
Im zweiten Experiment wurden die Versuchspersonen gebeten, sechs Fehler
aufzulisten, die sie früher in ihren jeweiligen Fachgebieten begangen hatten.
Die Kontrollgruppe sollte ebenfalls ihre Fehler vermerken, die sich
allerdings auf Bereiche bezogen, in denen sie keine besonderen Kenntnisse
hatten. Daraufhin hatten die Versuchspersonen 15 Minuten Zeit, um einen
selbstbeschreibenden Aufsatz zu ihren jeweiligen Interessengebieten
schreiben. Das Ergebnis zeigte, dass die Versuchspersonen, die zuvor Fehler
in ihren Fachgebieten aufgelistet hatten, mehr Zeit in ihre Aufsätze
investierten und längere Texte verfassten als Versuchspersonen, die vorher
auf Fehler in anderen Bereichen hingewiesen hatten. (vgl. Gollwitzer et al.
1982, S. 366367)
2.1.2.2 Studien zur sozialen Realisierungshypothese
Innerhalb der Studien wurden die Versuchspersonen, die bestimmte
Identitätsabsichten hatten, in einen Mangelzustand versetzt. Bei der
angebotenen Gelegenheit zum Ausgleich wurde das Kompensationsstreben
entweder zur Kenntnis genommen oder ignoriert. Es wurde beobachtet, wie
persistent sich die Versuchspersonen verhielten. Die Versuchspersonen,
deren Kompensationsstreben von anderen Menschen wahrgenommen
wurde, verhielten sich weniger beharrlich, da sie das Gefühl der
Vollkommenheit erreicht hatten. (vgl. Gollwitzer et al. 2002, S. 197198)
Gollwitzer (1986) untersuchte im Rahmen von vier Studien den Einfluss der
sozialen Realität auf selbstsymbolisierende Anstrengungen (vgl. Gollwitzer
1986, S. 146).
11
Studie 1 thematisierte identitätsbezogene Selbstbeschreibungen. Die
Versuchspersonen waren Studentinnen, die Interesse an der Gründung einer
eigenen Familie bekundet hatten. Sie sollten persönliche Fähigkeiten
notieren, die ihnen für die Mutterrolle wichtig erschien. Bevor sie sich mit
einem Gesprächspartner darüber austauschen sollten, wurde den
Versuchspersonen entweder mitgeteilt, dass ihr Gesprächspartner ihre
Selbstbeschreibungen sorgfältig studiert oder dass er sie verworfen hatte.
Die Versuchspersonen konnten sich im Rahmen eines Fragebogens zu ihrem
Persönlichkeitsprofil zusätzlich selbst symbolisieren, das heißt positiv
darstellen.
Wenn die Gesprächspartner die ursprünglichen
Selbstbeschreibungen nicht zur Kenntnis genommen hatten, fühlten sich die
Versuchspersonen gezwungen, sich zusätzlich selbst zu symbolisieren,
indem sie ihr eigenes Persönlichkeitsprofil an das ideale Mutterprofil
anglichen. Die Versuchspersonen, deren Selbstbeschreibungen von ihrem
Gesprächspartner wahrgenommen wurden, wählten im Fragebogen
Eigenschaften aus, die uneins mit dem idealen Mutterprofil waren. Das
Ergebnis zeigte, dass sich die Versuchspersonen bei gefühlter
Unvollständigkeit an dem beispielhaft gezeigten Idealprofil einer Mutter
orientierten. (vgl. Gollwitzer 1986, S. 146)
Studie 2 hatte identitätsbezogene Leistungen zum Inhalt. Männliche
Medizinstudenten, deren Selbstziel ,,Arzt" war, sollten aus insgesamt 45
Problemfällen für einige Fälle Lösungen finden. Es erschien eine Person,
die verdeckt zu den Versuchsleitern gehörte, einige Lösungen überflog und
die Hälfte der Versuchspersonen als Mediziner ansprach. Wie die andere
Hälfte die Aufgaben erfüllt hatte, wurde von der Person nicht
wahrgenommen. Zudem wurde diese Hälfte nicht als Mediziner bezeichnet.
Anschließend wurde gemessen, wie lange die zweite Hälfte an den
Aufgaben weiterarbeitete. Die Versuchspersonen, deren Lösungen zur
Kenntnis genommen und die als Mediziner bezeichnet wurden, zeigten
weniger Ausdauer bei den Aufgaben. Daraus folgt, dass bei
wahrgenommenen Selbstsymbolisierungen ein stärkerer Sinn dafür entsteht,
dass die beabsichtigte Identität erreicht wird, als bei unberücksichtigten
Selbstsymbolisierungen. (vgl. Gollwitzer 1986, S. 146147)
12
Studie 3 untersuchte die Eigeninitiative von männlichen Medizinstudenten,
die Mediziner werden wollten. Die Versuchspersonen erhielten eine
Rückmeldung, ob ihre persönlichen Qualitäten denen erfolgreicher
Mediziner entsprachen. Ein anschließendes Experiment gab den
Versuchspersonen die Möglichkeit, 15 medizinische Aufgaben zu lösen und
bereits vollständige, einzelne Aufgabenteile dem Versuchsleiter vorzulegen.
Das Ergebnis zeigte, dass mehr als 50% der Versuchspersonen mit zuvor
negativem Persönlichkeitsfeedback versuchten, bereits vollständige
Aufgaben einzureichen, bevor die gesamten Aufgaben erledigt waren. Nur
bei 8% der Versuchspersonen mit positivem Feedback traf dieses Verhalten
zu. (vgl. Gollwitzer 1986, S. 147148)
Studie 4 prüfte die Neigung, die eigenen selbstsymbolisierenden
Anstrengungen anderen zu vermitteln. Dazu wurden Studentinnen mit dem
Selbstziel ,,Tänzerin" um einen langen Aufsatz gebeten. Eine Hälfte sollte
den schlechtesten Lehrenden beschreiben, den sie je hatte, die andere Hälfte
sollte sich auf den besten Lehrenden beziehen. Anschließend wurden die
Versuchspersonen gebeten, in einem anderen sozialen Kontext vor einem
kleinen, öffentlichen Publikum zu tanzen. Auf einem Anmeldeformular
sollten sie vermerken, in wie vielen Tagen sie wieder für einen derartigen
Auftritt angerufen werden wollten. Das Ergebnis zeigte, dass die
Versuchspersonen, die sich an ihren schlechtesten Lehrenden erinnert
hatten, zwei Wochen früher auftreten wollten als die Versuchspersonen, die
ihren besten Lehrenden beschrieben hatten. (vgl. Gollwitzer 1986, S. 148)
Selbstsymbolisierungen, die durch die Wahrnehmung anderer Menschen zu
einer sozialen Tatsache werden, eignen sich demzufolge effektiver dazu,
anderen Menschen die beabsichtigte Identität, das heißt das Selbstziel,
glaubhaft zu machen, als nicht wahrgenommene Selbstsymbolisierungen
(vgl. Gollwitzer 1986, S. 146). Eine soziale Tatsache ist dann erreicht, wenn
die Person mit Selbstziel ihr Kompensationsstreben aktiv vermittelt oder
wenn die Menschen das Streben bereitwillig zur Kenntnis nehmen. (vgl.
Gollwitzer et al. 2002, S. 197)
13
2.1.2.3 Studien zur sozialen Insensibilitätshypothese
Im Rahmen der Untersuchungen wurde den Versuchspersonen mitgeteilt,
dass die Gesprächsperson bestimmte Wünsche hatte, die absichtlich
inhaltlich so angelegt waren, dass sie potentiellen Kompensationsinteressen
der Versuchspersonen entgegenstanden. Die Reaktion der Versuchspersonen
wurde beobachtet, das heißt, ob sie die Wünsche befolgten oder ihre eigenen
Interessen verfolgten. (vgl. Gollwitzer et al. 2002, S. 199)
In den beiden durchgeführten Studien wurde geprüft, wie sich die
Versuchspersonen verhielten, wenn ihre Selbstsymbolisierungen durch
positive Selbstbeschreibungen in Konflikt mit den Wünschen der
Gesprächsperson standen (vgl. Gollwitzer und Wicklund 1985, S. 704).
Im Rahmen von Studie 1 wurde weiblichen Versuchspersonen mitgeteilt, ob
ihre Persönlichkeiten ihren Karriere-Selbstzielen entsprachen. Daraufhin
wurden Zweiergruppen gebildet, die aus einer positiv bewerteten und einer
negativ bewerteten Versuchsperson bestanden. Beide Personen sollten ihre
Kompetenzindikatoren hinsichtlich ihrer Selbstziele nennen, beispielsweise
Fähigkeiten. Wer seine Selbstbeschreibungen schnell vortrug, blockierte
dadurch den Versuch des Gesprächspartners, das gleiche Ziel zu erreichen.
In einer anderen Gruppe bezogen sich die Indikatoren auf die Kompetenz
als potentielle Mütter, was nicht den Selbstzielen der Versuchspersonen
entsprach. (vgl. Gollwitzer und Wicklund 1985, S. 705706)
Die Ergebnisse zeigten, dass die Versuchspersonen mit nicht-idealem Profil
angaben, dass ihr Persönlichkeitsprofil dem Idealprofil unähnlich sei,
wohingegen die Versuchspersonen mit idealem Profil es als wichtiger
empfanden, die ideale Persönlichkeit zu besitzen. 73% der
Gesprächsdurchgänge gewannen Versuchspersonen mit dem nicht-idealen
Profil. In der Mutter-Bedingung setzten sich 27% mit nicht-idealem Profil
durch. Insbesondere in der Karriere-Bedingung wurden Versuchspersonen
14
mit nicht-idealem Profil von Gesprächspersonen mit idealem Profil als
egoistisch wahrgenommen. (vgl. Gollwitzer und Wicklund 1985, S. 706
707)
Studie 2 war so angelegt, dass die Bindung männlicher Studenten an
bestimmte Bereiche, zum Beispiel Journalismus, sichergestellt wurde. Die
Versuchspersonen sollten einen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen und
eine attraktive Frau namens Debbie treffen. Es wurden ihnen die
Selbstbeschreibungen anderer Männer vorgelegt, die mit Debbies
Kommentaren zu ihren Präferenzen versehen waren. Den Versuchspersonen
mit der negativen Bedingung wurde vermittelt, dass Debbie Männer
bevorzugte, die sich negativ charakterisierten, während den Personen mit
der positiven Bedingung mitgeteilt wurde, dass Debbie Männer präferierte,
die sich positiv darstellten. Die Studenten erhielten das Feedback, ob ihre
Persönlichkeit dem idealen Profil ähnelte und sollten daraufhin ihre
Selbstbeschreibungen für Debbie verfassen. (vgl. Gollwitzer und Wicklund
1985, S. 710711)
Die Ergebnisse zeigten, dass sich Versuchspersonen mit nicht-idealem
Profil positiver beschrieben als jene mit idealem Profil. Versuchspersonen
mit nicht-idealem Profil folgten in der positiven Bedingung leichter dem
Aufruf zur Selbstdarstellung als Versuchspersonen mit idealem Profil.
Zudem waren Versuchspersonen mit nicht-idealem Profil weniger gewillt,
Debbies Präferenz zu folgen und sich selbst negativ darzustellen. Es war
ihnen nicht wichtig, Debbie sympathisch zu sein, da ihre Bedürfnisse
hinsichtlich ihrer Selbstdefinition stärker waren. (vgl. Gollwitzer und
Wicklund 1985, S. 712)
Für unvollständige Individuen sind die Wünsche und Bedürfnisse anderer
sekundär. Obwohl die Personen das Bedürfnis haben, eine Bestätigung für
die Erzielung ihrer Selbstdefinition zu erhalten, interessieren sie sich nicht
aufrichtig für die Personen, die ihr erreichtes Selbstziel bestätigen können.
(vgl. Gollwitzer und Wicklund 1985, S. 704)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783842844469
- DOI
- 10.3239/9783842844469
- Dateigröße
- 2.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Duisburg-Essen – Erziehungswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2012 (Dezember)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- second life avatar selbstergänzung avatargestaltung
- Produktsicherheit
- Diplom.de