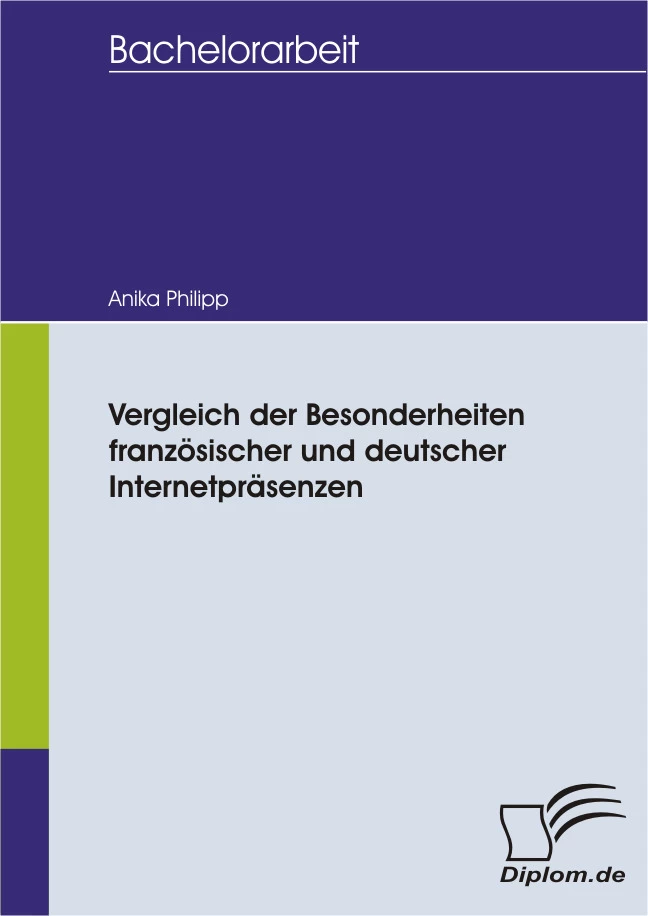Vergleich der Besonderheiten französischer und deutscher Internetpräsenzen
Zusammenfassung
Motivation und Zielsetzung:
In unserer immer mehr globalisierten Welt scheinen sich durch das World Wide Web die unterschiedlichsten Kulturen anzunähern. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten eines ungehinderten Informationsflusses und -austausches. Es stellt sich die Frage, wie im digitalen Zeitalter diese Informationen verbreitet werden, denn gerade wegen der unterschiedlichsten Migrationsströme und der daraus resultierenden Kulturvermischung ist es wichtig, eine Anpassung von Webseiten im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse vorzunehmen.
Insbesondere die Individualisierung von Webseiten wird immer wichtiger und deren usability. Demzufolge werden Internetpräsenzen zum einen auf der sprachlichen Ebene zum anderen durch die Internationalisierung bzw. Lokalisierung vollzogen.
In der vorliegenden Arbeit sollen im Kontext der verschiedenen bereits resultierenden wissenschaftlichen Untersuchungen und v.a. anhand der Kulturdimensionen nach Gert Hofstede (Hofstede 2006), Unterschiede und Besonderheiten der Kulturen, insbesondere die französische und deutsche Webpräsenz anhand eines global agierenden Unternehmens aufgezeigt werden.
Zur Charakterisierung und Differenzierung von Internetpräsenzen werden in den Beschreibungsdimensionen das mentale Modell, Differenzen der jeweiligen Länder im Bezug auf Navigation, Interaktion und Präsentation verwendet. Diese Unterschiede entsprechen starken kulturellen Werten (Marcus, 2001).
Aufbau der Arbeit:
Die Arbeit ist in einen theoretischen (Teil I) und einen praktischen Teil (Teil II) gegliedert.
In Teil I werden sowohl der Kulturbegriff nach Geert Hofstede (Kapitel 1), als auch die Grundlage der Kulturdimensionen (Kapitel 2 und 3) und Studien und Kulturkonzepte von Aaron Marcus (Kapitel 5.1), Fons Trompenaar (Kapitel 5.2), Singh & Pereira (Kapitel 5.3) und von Edward Hall (Kapitel 5.4) näher erläutert.
In Teil II vergleiche ich insbesondere anhand des Kulturmodells nach Geert Hofstede (aufbauend auf Teil I, Kapitel 1) und den dazugehörigen Kulturdimensionen, die in Teil I, Kapitel 2 und 3, explizit erläutert werden, französische und deutsche Webseiten insbesondere von global agierenden Institutionen/Unternehmen (Sorbonne - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg [Kapitel 1.1.], Coca-Cola [1.2], Nivea [1.2] und Avène [1.4]).
Im abschließenden Teil der vorliegenden Arbeit (Teil III) werden die Ergebnisse […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
Motivation und Zielsetzung
Aufbau der Arbeit
Teil I Theoretische Vorbetrachtungen
1. Kulturbegriff nach Geert Hofstede
1.1 Kulturmerkmale
1.2 Kulturdimensionen
1.2.1 Machtdistanz (Power Distance)
1.2.2 Individualismus versus Kollektivismus
1.2.3 Femininität vs. Maskulinität
1.2.4 Unsicherheitsvermeidung
1.2.5 Langzeitorientierung vs. Kurzzeitorientierung
2. Weitere Kulturdimensionen
2.1. Low-context/High-context Kulturen
3. Lokalisierung von Webseiten
4. Weitere Studien und Kulturkonzepte
4.2. Fons Trompenaars
4.3. Singh&Pereira
4.4. Edward T. Hall
Teil II Anwendungsteil
1.Vergleich französischer und deutscher Webseiten anhand der verschiedenen Kulturdimensionen - methodische Vorgehensweise nach Aaron Marcus
1.1. Machtdistanz und Webdesign
1.1.1. Vergleich deutscher und französischer Universitätswebseiten
1.2. Maskulinität/ Feminität
1.2.1. Vergleich der Coca-Cola Webseite
1.3.1. Vergleich deutscher und französischer Nivea Webseite
1.3.2. Bilder von einzelnen oder mehreren Individuen in Verbindung mit dem Produkt- Deutschland/Frankreich im Vergleich zu China
1.4. Unsicherheitsvermeidung auf das Webdesign
1.4.1. Vergleich der deutschen und französischen Avène Website
1.5 Kurzzeitorientierung vs. Langzeitorientierung auf das Webdesign
1.6. Low-/High-context Kulturen
1.6.1. Vergleich der McDonalds Webseite
1.6.2. Personenorientierung vs. Aufgabenorientierung
2. Sprache
2.1. Anglizismus im Webdesign
Teil III Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1. Hohe Machtdistanz: französische Universitätswebseite www.univ-paris1.fr (18.03.2010, 14.45 Uhr)
Abbildung 2. Niedrige Machtdistanz: deutsche Universitätswebseite www.uni-magdeburg.de (28.02.10, 14.46 Uhr)
Abbildung 3. Maskulinität: deutsche Coca-Cola Webseite www.coce.de/ (31.03.2010,13.36 Uhr)
Abbildung 4. Femininität: französische Coca-Cola Webseite www.coca-cola.fr (15.03.2010, 07.35 Uhr)
Abbildung 5. Individualismus: deutsche Nivea Webseite www.nivea.de (12.03.2010,12.23 Uhr)
Abbildung 6. Kollektivismus: arabische Nivea Webseite Kuwait www.en-nivea-me.com (13.03.2010,13.34 Uhr)
Abbildung 7. Gegenüberstellung deutscher und chinesischer Webauftritt www.maybelline.de (03.03.2010, 20.21 Uhr) und www.maybelline.ch (03.03.2010, 20.23 Uhr): Lippenstift
Abbildung 8. Gegenüberstellung deutscher und chinesischer Webauftritt www.maybelline.de (04.03.2010, 20.43 Uhr) und www.maybelline.ch (04.03.2010, 20.45 Uhr): Makeup
Abbildung 9. Hohe Unsicherheitsvermeidung: französische Avène Webseite www.eau-thermale-avene.com/public/avene/html/toolkit/flash/site.php?langueHtml=fr (19.03.2010, 18.36 Uhr)
Abbildung 10. Niedrige Unsicherheitsvermeidung: deutsche Avène Webseite www.avène.de (31.03.2010, 13.51 Uhr)
Abbildung 11.Kommunikationsstil: In Anlehnung an Hall (Usunier/Walliser,1993:65)
Abbildung 12. LC- Kultur: deutsche McDonalds Webseite www.mcdonalds.de/ (05.03.2010, 13.34 Uhr)
Abbildung 13. HC- Kultur: französische McDonalds Webseite www.mcdonalds.fr/ (05.03.2010, 13.34 Uhr)
Abbildung 14. Personenorientierung: französische McDonalds Webseite www.Mcdonalds.fr (23.03.2010, 12.34 Uhr)
Abbildung 15. Produktnamen auf französischer Coca-Cola Webseite www.coca-cola.fr
Abbildung 16. Produktnamen auf deutscher Coca-Cola Webseite www.coke.de/
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Fünf Beschreibungsebenen nach Aaron Marcus (2001)
Tabelle 2. Gegenüberstellung der fünf Dimensionen für die Länder Frankreich und Deutschland
Tabelle 3. Auflistung von Ländern mit hoher Machdistanz und niedriger Machtdistanz
Tabelle 4. Auflistung von individualistischen und kollektivistischen Ländern
Tabelle 5. Auflistung von maskulinen und femininen Ländern
Tabelle 6.Auflistung der Länder mit hoher Unsicherheitsvermeidung und niedriger Unsicherheitsvermeidung
Tabelle 7. Besondere Merkmale des Webdesigns bezüglich der unterschiedlichen Machtdistanz in Anlehnung an Aaron Marcus 2001 (hohe/niedrige)
Tabelle 8. Besondere Merkmale des Webdesigns bezüglich der Maskulinität und Femininität in Anlehnung an Aaron Marcus 2001
Tabelle 9. Besondere Merkmale des Webdesigns bezüglich Individualismus und Kollektivismus in Anlehnung an Aaron Marcus 2001
Tabelle 10. Besondere Merkmale bezüglich des Webdesign niedriger und hoher Unsicherheitsvermeidung in Anlehnung an Aaron Marcus 2001
Zusammenfassung
Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt die Merkmale kulturellen Einflusses auf internationales Webdesign unter Verwendung des Kulturmodells Hofstedes. Mitunter soll anhand von Beschreibungsebenen, Besonderheiten im Bezug auf deutsches und französisches Webdesign untersucht werden. Hierbei wurden Hypothesen von Wissenschaftlern wie Aaron Marcus und Edward .T. Hall gewählt, die auf Hofstedes Kulturdimensionen aufbauen.
Abstract
The following B.Sc. thesis deals with the elements of culture influence on international web design by using the culture model of Hofstede. Occasional by the means of description areas characteristics features of the German and French web design shall be pointed out. Therefore are hypotheses of scientists such as Aaron Marcus and Edward T. Hall selected, based of hofstedes culture dimensions.
Einleitung
Motivation und Zielsetzung
In unserer immer mehr globalisierten Welt scheinen sich durch das „World Wide Web“ die unterschiedlichsten Kulturen anzunähern. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten eines ungehinderten Informationsflusses und -austausches. Es stellt sich die Frage, wie im digitalen Zeitalter diese Informationen verbreitet werden, denn gerade wegen der unterschiedlichsten Migrationsströme und der daraus resultierenden Kulturvermischung ist es wichtig, eine Anpassung von Webseiten im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse vorzunehmen.
Insbesondere die Individualisierung von Webseiten wird immer wichtiger und deren usability. Demzufolge werden Internetpräsenzen zum einen auf der sprachlichen Ebene zum anderen durch die Internationalisierung bzw. Lokalisierung vollzogen.
In der vorliegenden Arbeit sollen im Kontext der verschiedenen bereits resultierenden wissenschaftlichen Untersuchungen und v.a. anhand der „Kulturdimensionen“ nach Gert Hofstede (Hofstede 2006), Unterschiede und Besonderheiten der Kulturen, insbesondere die französische und deutsche Webpräsenz anhand eines global agierenden Unternehmens aufgezeigt werden.
Zur Charakterisierung und Differenzierung von Internetpräsenzen werden in den Beschreibungsdimensionen das mentale Modell, Differenzen der jeweiligen Länder im Bezug auf Navigation, Interaktion und Präsentation verwendet. Diese Unterschiede entsprechen starken kulturellen Werten (Marcus, 2001).
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in einen theoretischen (Teil I) und einen praktischen Teil (Teil II) gegliedert.
In Teil I werden sowohl der „Kulturbegriff“ nach Geert Hofstede (Kapitel 1), als auch die Grundlage der Kulturdimensionen (Kapitel 2 und 3) und Studien und Kulturkonzepte von Aaron Marcus (Kapitel 5.1), Fons Trompenaar (Kapitel 5.2), Singh & Pereira (Kapitel 5.3) und von Edward Hall (Kapitel 5.4) näher erläutert.
In Teil II vergleiche ich insbesondere anhand des Kulturmodells nach Geert Hofstede (aufbauend auf Teil I, Kapitel 1) und den dazugehörigen Kulturdimensionen, die in Teil I, Kapitel 2 und 3, explizit erläutert werden, französische und deutsche Webseiten insbesondere von global agierenden Institutionen/Unternehmen (Sorbonne - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg [Kapitel 1.1.], Coca-Cola [1.2], Nivea [1.2] und Avène [1.4]).
Im abschließenden Teil der vorliegenden Arbeit (Teil III) werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Teil I Theoretische Vorbetrachtungen
1. Kulturbegriff nach Geert Hofstede
Es erscheint sinnvoll, den Begriff „Kultur“ in Anlehnung an Hofstede zum Verständnis des Themas dieser Arbeit aufzugreifen. Hofstede schreibt in seinem Buch „Lokales Denken, Globales Handeln“ (2006) von „Kultur als mentale Programmierung“.
Desweiteren schreibt Hofstede, dass „Kultur erlernt ist und nicht angeboren“ (Hofstede, 2006:4) und diese sich aus unserem sozialen Umfeld und nicht aus den Genen ableitende Kultur müsse einerseits unterschieden werden von der menschlichen Natur und andererseits von der Persönlichkeit des einzelnen Individuums (Hofstede, 2006:4). Nach Hofstede ist die Kultur die „mentale Software“ (Software of the mind) (Hofstede, 2006:3). Sie entsteht im Laufe eines Sozialisationsprozesses und ist demnach ein „kollektives Phänomen“. Die Verhaltensweisen in dieser Kultur zeichnen sich dadurch aus, dass sie weder geplant noch von einer Autoritätsperson bestimmt worden sind, sondern sich alleine organisiert haben (Eibl, 2006:282).
Die verschiedenen Gesellschaften einer Kultur haben über Jahre hinweg eigene Lösungen für diese Probleme entwickelt. Die Lösungen sind so vielfältig und unterschiedlich, dass sie von Gesellschaft zu Gesellschaft nicht immer nachvollziehbar sind. Dies ist der Bereich der Grundwerte einer Kultur, ein Fundament einer jeden Nation.
Geert Hofstede schreibt: „Man entdecke die Grundwerte einer Kultur erst dann, wenn man mit einer anderen Kultur in Kontakt kommt, so wie ein Fisch erst dann den Wert des Wassers entdeckt, wenn er gefangen ist.“ (Hofstede, 1997)
Diese Interaktion von (individuumsspezifischer) Persönlichkeit (Persönlichkeitsstruktur) der (universellen) menschlichen Natur und der Kultur wird anhand von „Drei Ebenen der Einzigartigkeit in der mentalen Programmierung des Menschen“ (Hofstede, 2006:4) im Folgenden erläutert (siehe Abb.1).
Die „menschliche Natur“, die universelle Ebene der „mentalen Software“, wird genetisch determiniert und geerbt. Dazu gehört die menschliche Fähigkeit Gefühle wie Angst, Ärger, Liebe, Glück und Traurigkeit zu zeigen oder Scham zu empfinden. Ebenso gehört das Verlangen nach Spielen, Bewegungen und Beobachtungen dazu. Wie sich jedoch jemand verhält und damit umgeht gehört zum Aspekt der Kultur.
Kultur ist erlernt und hängt ebenso auch von den Gruppen und den Mitgliedern ab, mit denen der Mensch aufgewachsen ist. Der Gefühlsausdruck wird somit durch seine Kultur beeinflusst. Die „Persönlichkeit“ wurde zum Teil von den Eltern und dem sozialen Umfeld mitgegeben. Der Mensch lernt durch Erfahrungen und ohne, dass der Mensch es merkt, stellen diese individuellen Erfahrungen das eigene „Ich“ dar, die sog. „Persönlichkeit“. Diese Eigenschaften teilt der Mensch mit keinem anderen und somit kommt es zu einer Individualisierung eines Charakters mit ausgeprägten Charakterzügen. Der Baustein „Persönlichkeit“ an der Spitze des Dreiecks der Abbildung 1 ergibt sich aus der Mischung des Erlebten und Erlernten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1. Drei Ebenen der Einzigartigkeit in der mentalen Programmierung des Menschen (nach Hofstede 2006)
1.1 Kulturmerkmale
Die Besonderheiten, die Kulturen der verschiedenen Länder voneinander unterscheiden und oft auch abgrenzen, sind besonders relevante Aspekte für die Analyse von Webseiten. Wofür kulturelle Besonderheiten vorhanden sind und wie diese wirken, stellt der Kulturwissenschaftler Geert Hofstede in einem „Zwiebelschalen-Diagramm“ dar (siehe Abb.2).
„Kultur“ kann sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren. Sie sind im „Zwiebelschalendiagramm“ in verschiedenen Schichten platziert, die ineinander gereiht sind.
Eindrücklich beschrieben werden diese durch Symbole, Helden und Rituale, die allesamt unter dem Begriff Praktiken zusammengefasst sind, sowie die am tiefsten gehende Manifestation der Kultur, die „Werte“ (im inneren Kern).
Die Rituale an zweiter Stelle spiegeln in der Gesellschaft die kollektiven Tätigkeiten wider, die dazu gehören, auch wenn sie manchen eventuell überflüssig vorkommen (Hofstede, 2006:23). Ein Beispiel solchen Rituals auf einer Homepage sind förmliche Anreden. Diese beginnt in Deutschland meist mit „Liebe(r) (Herr/Frau)/Sehr geehrte(r) (Herr/Frau)“ oder im Französischen mit „Monsieur/Madame“ oder auch „Madame/Monsieur“.
Helden sind Personen, die tot oder lebend, fiktiv oder real sind und Eigenschaften der Kultur besitzen, die hoch angesehen sind (vgl. Hofstede, 1993:22). Diese Menschenbilder dienen der Gesellschaft als sog. Verhaltensvorbilder. Abbildungen oder Erwähnungen solcher Helden (z.B. Jeanne d’ Arc, Abraham Lincoln, Gandhi) auf einer Homepage wären ein Indiz.
Kultur manifestiert sich oberflächlich in Symbolen (z.B. Worte, Gesten, Bilder, Objekte). Diese sind für alle Außenstehenden direkt sichtbar. Deren Bedeutungen sind immer noch für die Zugehörigkeit einzelner Gesellschaftsgruppen zu einer Kultur nach außen und im Zuge der Globalisierung zunehmend zur Individualisierung gegenüber anderen Kulturen charakteristisch (s.u.). Symbole beinhalten auch Farben oder Zahlen in der Kultur (Hofstede, 2006:7)
Diese drei genannten Elemente lassen sich unter dem Begriff „Praktiken“ zusammenfügen. Es sind Verhaltensmuster, die nach außen hin für alle erkenntlich sind. Diese Muster und deren Bedeutung zu verstehen liegt in der „Art und Weise“, wie diese Praktiken von Insidern interpretiert werden (Hofstede, 2006:9).
Es existieren weltweit vermehrt zahlreiche Kulturen, die hinsichtlich der Deutung von Werten und Praktiken auf besondere Art und Weise unterschiedlich aufgebaut sind.
Die kulturelle Vielfalt entsteht durch „die Anpassung an neue natürliche Umgebungen“ (Hofstede, 2006:19f) .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2. Manifestation von Kultur auf unterschiedlichen Ebenen (nach Hofstede, 2006)
1.2 Kulturdimensionen
Kulturdimensionen sind Kategorien, in die Daten aus interkulturellen Studien unterteilt werden können (Hoft,1996:66). In den 70er Jahren begann Geert Hofstede als erster bedeutender Kulturanthropologe eine Studie mit wegweisenden empirischen Untersuchungen zur Klassifizierung unterschiedlicher Kulturkreise unter Mitarbeitern der International Business Machines Corporation (IBM) auf der ganzen Welt in 72 Ländern durchzuführen und füllte mittels der Analysen statistische Auswertungen von rund 117000 Fragebögen aus.
Bei der anschließenden Auswertung der Ergebnisse mittels der Faktorenanalyse entstand ein Muster, die sog. „Länderspezifischen Punktewertetabellen“ nach den bedeutenden Kulturdimensionen.
Anhand der Klassifizierung bilden sich fünf Kulturdimensionen heraus:
1. Machtdistanz (Power Distance)
2. Individualismus vs. Kollektivismus
3. Femininität vs. Maskulinität
4. Unsicherheitsvermeidung
5. Langzeitorientierung vs. Kurzzeitorientierung
Durch die Hilfe des Forschungsprojekts, welches unter Mitarbeitern der Firma IBM in ähnlichen beruflichen Positionen jedoch in ganz unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurde, ist es nun möglich für jedes Land eine Einordnung zu finden. Im Folgenden wird erläutert, was diese Kulturdimensionen beinhalten.
1.2.1 Machtdistanz (Power Distance)
Machtdistanz (Power Distance) wird nach Hofstede definiert als „das Ausmaß, bis zu welchem die weniger mächtigen Mitglieder von Institutionen bzw. Organisationen eines Landes erwarten und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist […].“ (Hofstede, 2006:59)
Die Position eines Machtindexwert (MDI-Wert) gibt die Abhängigkeitsbeziehungen unter Mitgliedern einer Gruppe wieder. In Ländern, die einen geringen MDI-Wert aufweisen, ist die Abhängigkeit der Mitarbeiter gegenüber zum Vorgesetzten eher klein. Die Interdependenz[1] zwischen Mitarbeitern ist zwar vorhanden, dennoch wird für den Mitarbeiter der Vorgesetzte zu jeder Zeit ansprechbar sein. Ebenso wird ihm zu jeder Zeit eine eigene Meinung gewährleistet (Hofstede, 2006:59). In diesen Ländern wird versucht, die sozialen und hierarchischen Unterschiede nicht allzu offensichtlich werden zu lassen. Es wird verstärkt darauf geachtet, dass unter den Menschen und innerhalb der Bevölkerungsschichten ein soziales und hierarchisches Gleichgewicht besteht. Statussymbole werden vermieden und wenn nur dezent eingesetzt.
Auch gibt es Länder mit hoher Machtdistanz. Die Recherchen nach Hofstede zeigen eine große Abhängigkeit zwischen den Ländern. In der Psychologie spricht man von Kontradependenz[2] (Hofstede, 2006:59). Ein Beispiel ist: Ein Mitarbeiter ist sich der Abhängigkeit gegenüber dem Vorgesetzen bewusst, sträubt sich aber innerlich gegen diese Abhängigkeit und lehnt sie ab. Dementsprechend wird er dem Vorgesetzen widersprechen. Viele asiatischen Länder (v.a. Malaysia und die Philippinen), sowie osteuropäische Nationen wie Slowakei, Russland und Rumänien weisen einen hohen MDI- Wert auf, ebenso die arabischen und afrikanischen Länder.
Die Machtdistanz wird durch die Menschen bzw. Mitglieder geprägt, insofern sie diese ungleiche Verteilung zulassen. Für die Verteilung der Macht untereinander sind letztendlich die führenden Mitglieder einer Institution oder auch Organisation verantwortlich. „Führung“ kann nur da geschehen, wo eine passende „Gefolgschaft“ existiert (Hofstede, 2006:59). Somit entsteht Autorität genau dann, wenn Menschen diese Autorität zu lassen.
Die Arbeitswelt zeigt, dass Länder mit hohem MDI-Wert eher zu Zentralisation[3] neigen, als Länder, die einen niedrigeren MDI-Wert aufweisen. Ein niedriger MDI-Wert wird dementsprechend zu Dezentralisierung[4] führen. Die Mitarbeiter mit niedrigem MDI-Wert erwarten von ihrem Vorgesetzten Kenntnisnahme und Anteilnahme von wichtigen Geschäftsprozessen (Hofstede, 2006:59).
1.2.2 Individualismus versus Kollektivismus
Individualistische Gesellschaften sind lockerere Beziehungen unter den Mitgliedern einer Kultur. Jeder kann für sich selbst sorgen, will für sich selbst sorgen und betrachtet sich selbst als eigenständiges, handelndes Individuum (vgl. Hofstede, 2006:100ff).
So schreibt Hofstede (2006:111ff), dass die kollektivistischen Beziehungen gekennzeichnet sind durch „Wir-Menschen“. Diese Gruppen werden an starken, geschlossen Gruppen erkannt. Zu erfüllende Kriterien, an denen Untersuchungen gemessen wurden, sind beispielsweise beim Individualismus die „freie Zeit“ hinsichtlich des Familien- und Privatlebens, die Freiheit hinsichtlich Aufgaben und diese nach eigenen Vorstellungen zu verrichten und als letztes Kriterium, die „Herausforderung“ Aufgaben zu erledigen, um „persönliche Erfolge“ für sein inneres Wohlbefinden und Gleichgewicht zu verzeichnen. Beim Kollektivismus liegt der Fokus auf „Weiterbildung“, „Arbeitsumfeld“ und seine „Fähigkeiten“ einsetzen zu können (Hofstede,2006:103).
Ein weiterer Punkt der Unterscheidung zwischen Individualismus und Kollektivismus liegt im Besitzverhältnis der Länder; Individualistische Länder seien im Vergleich zu kollektivistischen Ländern tendenziell eher reich (Hofstede, 2006:104). So sind die finanziellen Mittel für Weiterbildungen, Arbeitsausstattung und gutes Arbeitsumfeld viel größer als in armen Ländern (ebd. S.104). Daraus ergibt sich eine schnellere und freiere Entfaltung des einzelnen Menschen. Der individualistische Mensch zeichnet sich durch Leistung, Persönlichkeit und Selbständigkeit aus. Hofstede schreibt, dass Länder mit hoher Machtdistanz in der Regel einen niedrigen Wert für den Individualismus aufweisen. Es gebe jedoch die Ausnahme bei den romanischen Ländern, insbesondere Frankreich und Belgien. Diese beiden Länder weisen einen höheren Machtindexwert und starken Wert für den Individualismus auf (Hofstede, 2006:111).
Der französische Soziologe Crozier schreibt (1964:222): „ […] Abhängige persönliche Beziehungen gelten im kulturellen Umfeld Frankreichs als schwer zu ertragen. Dennoch ist die vorherrschende Sicht der Autorität noch immer die diejenige […] des Absolutismus. Diese beiden Haltungen sind widersprüchlich. Sie lassen sich jedoch in einem bürokratischen System miteinander vereinbaren, da unpersönliche Regeln und die Zentralisation es ermöglichen, eine absolutistische Vorstellung von der Autorität mit der Beseitigung der deutlichsten Abhängigkeitsbeziehungen zu vereinbaren […].“
Croziers Landsmann Philipp d‘Iribane erklärt diesen Widerspruch mit dem Organisationsprinzip „Logik der Ehre“ (1989:59). Dieses Prinzip wurde bereits im französischen Königreich entdeckt und besagt, dass jeder einen Rang hat (große Machtdistanz) jedoch die dazugehörigen Rechte und Pflichten nicht von der Gruppe zugetragen worden sind, sondern Resultat aus jahrelanger Tradition sein. Es ist „nicht so sehr das, was man anderen schuldet, sondern das, was man sich selber schuldet“, so d’Iribarne (D’Iribane,1989:59).
Deutsche und Franzosen sind in vielerlei Hinsicht Antipoden. Die deutsche Kultur misst den deutschen nach der Qualität der Aufgaben, die er im Interesse der Gruppe ausführt (kollektivistisch). In der französischen Kultur hingegen wird der Wert des Einzelnen nach Qualität seiner Beziehung zu den Mächtigen als den Trägern von Macht gewertet (individualistisch).
[...]
[1] Interdependenz bedeutet wechselseitige Abhängigkeit (Dependenz). Als "soziale Interdependenz" wird auf den Begriff gebracht, dass Menschen in ihrem Dasein aufeinander eingestellt und angewiesen sind (vgl. Geigner, 1964:46).
[2] In der Phase der Kontradependenz ist die Gruppe auf dem Weg sich vom Gruppenleiter als Autoritätsperson unabhängig zu machen. Die bis dahin bestehende Pseudohöflichkeit beginnt aufzuweichen. Die Ich-Durchsetzung kann dabei ziemlich intensiv ausgelebt werden (vgl. Hanus, 2004:60).
[3] In einer zentralisierten Organisationsstruktur wird über strategische, taktische und operative Fragen entschieden, wobei entweder eine oder mehrere Personen gemeinsam entscheiden. Alle Entscheidungen müssen an einem Ort zusammenlaufen, d.h. Entscheidungskompetenzen sind an der Organisationsspitze angesiedelt (vgl. Laux/Liermann, 1997:198f).
[4] In einer dezentralisierten Organisationsstruktur werden die Kompetenzen auf niedrigere Führungsebenen verlagert. Natürlich werden nicht alle Kompetenzen verlagert, sondern die, die nicht notwendigerweise das Top-Management ausführen muss. Es wird sozusagen das Entscheidungsproblem in Teilprobleme zerlegt und die Lösung dieser Teilprobleme wird an verschiedene Mitarbeiter übertragen (vgl. Laux/Liermann, 1997:198f).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842842304
- DOI
- 10.3239/9783842842304
- Dateigröße
- 8.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Anhalt in Köthen – Informatik, Informationsmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2012 (November)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- geert hofstede kulturdimensionen webdesign kommunikation aaron marcus
- Produktsicherheit
- Diplom.de