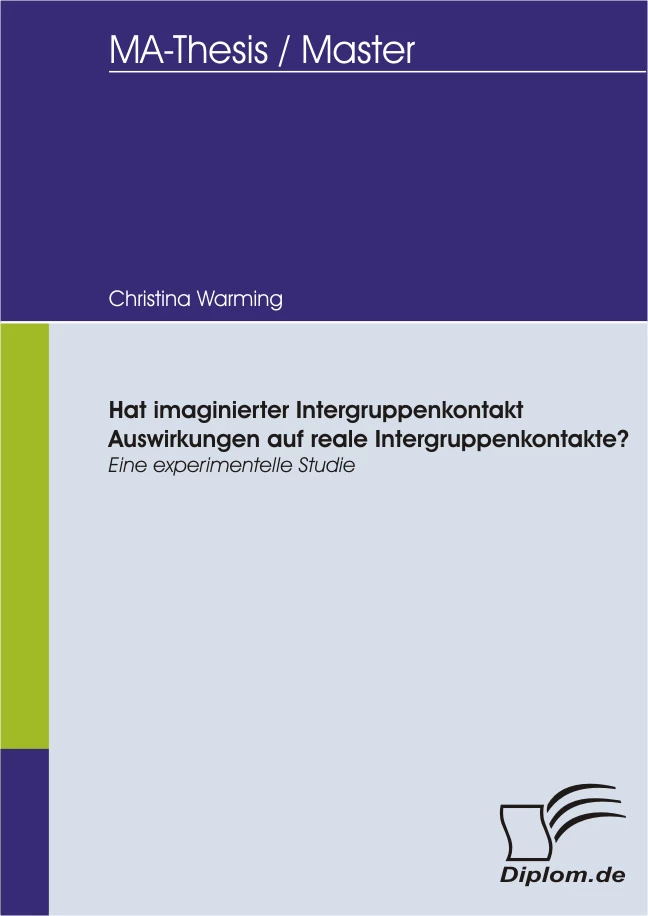Hat imaginierter Intergruppenkontakt Auswirkungen auf reale Intergruppenkontakte?
Eine experimentelle Studie
©2012
Masterarbeit
104 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Nahezu jeder Mensch gehört einer Gruppe an, beispielsweise aufgrund seiner Staatsbürgerschaft, ethnischen Zugehörigkeit oder Religion. Ein allgegenwärtiges Phänomen sind Intergruppenkonflikte. Generell besteht bei Menschen die Tendenz, die Eigengruppe zu bevorzugen und die Mitglieder von Fremdgruppen abzuwerten. Eine solche Eigengruppenfavorisierung ist selbst dann zu finden, wenn keine negativen Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe bestehen und die Zuteilung zur Eigen- und Fremdgruppe willkürlich erfolgt (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971). Zur Entstehung von Intergruppenkonflikten können Stereotype und Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe beitragen. Stereotype sind sozial geteilte kognitive Überzeugungen über bestimmte Eigenschaften der Fremdgruppe, wie z.B. Ansichten über das Äußere der Gruppenmitglieder, ihre Verhaltensweisen oder Einstellungen (Aronson, Wilson & Akert, 2008). Vorurteile werden als feindselige oder negative Einstellung gegenüber den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe, und zwar allein aufgrund deren Zugehörigkeit zu dieser Gruppe definiert (Aronson, et al., 2008, S. 460). Dadurch wird deutlich, dass Vorurteile weitestgehend ungerechtfertigt gegenüber einzelnen Mitgliedern sind. Durch soziale Kategorisierung und soziales Lernen können Vorurteile immer wieder neu entstehen. Wird aufgrund der Vorurteile ein aktives Verhalten gegenüber der Fremdgruppe entwickelt, entstehen Diskriminierungen, ungerechtfertigte negative oder schädliche Verhaltensweisen nur wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (Aronson et al., 2008, S. 460). Diskriminierungen können sogar durch Ereignisse, die durch die Weltpresse gehen, aktiviert werden. Nach dem 11. September 2001 stieg in Großbritannien die indirekte Diskriminierung von Muslimen um 82.6% an, die offene Diskriminierung um 76.3% (Sheridan, 2006).
Für den Einzelnen und für die Gesellschaft können Vorurteile schwerwiegende Konsequenzen haben. Unter Weißen bestehen bis heute subtile und unbewusste Vorurteile gegenüber Schwarzen, die zu Misstrauen und Benachteiligung führen, z.B. bei beruflichen Auswahlentscheidungen (Dovidio, Gaertner, Kawakami & Hodson, 2002). Auf die volkswirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft können sich Diskriminierungen negativ auswirken, da Potentiale ganzer Gruppen möglicherweise nicht genutzt werden (Woellert, Kröhnert, Sippel & Klingholz, 2009). Bis heute bestehen Intergruppenkonflikte zwischen Ländern, wie der Nahostkonflikt […]
Nahezu jeder Mensch gehört einer Gruppe an, beispielsweise aufgrund seiner Staatsbürgerschaft, ethnischen Zugehörigkeit oder Religion. Ein allgegenwärtiges Phänomen sind Intergruppenkonflikte. Generell besteht bei Menschen die Tendenz, die Eigengruppe zu bevorzugen und die Mitglieder von Fremdgruppen abzuwerten. Eine solche Eigengruppenfavorisierung ist selbst dann zu finden, wenn keine negativen Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe bestehen und die Zuteilung zur Eigen- und Fremdgruppe willkürlich erfolgt (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971). Zur Entstehung von Intergruppenkonflikten können Stereotype und Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe beitragen. Stereotype sind sozial geteilte kognitive Überzeugungen über bestimmte Eigenschaften der Fremdgruppe, wie z.B. Ansichten über das Äußere der Gruppenmitglieder, ihre Verhaltensweisen oder Einstellungen (Aronson, Wilson & Akert, 2008). Vorurteile werden als feindselige oder negative Einstellung gegenüber den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe, und zwar allein aufgrund deren Zugehörigkeit zu dieser Gruppe definiert (Aronson, et al., 2008, S. 460). Dadurch wird deutlich, dass Vorurteile weitestgehend ungerechtfertigt gegenüber einzelnen Mitgliedern sind. Durch soziale Kategorisierung und soziales Lernen können Vorurteile immer wieder neu entstehen. Wird aufgrund der Vorurteile ein aktives Verhalten gegenüber der Fremdgruppe entwickelt, entstehen Diskriminierungen, ungerechtfertigte negative oder schädliche Verhaltensweisen nur wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (Aronson et al., 2008, S. 460). Diskriminierungen können sogar durch Ereignisse, die durch die Weltpresse gehen, aktiviert werden. Nach dem 11. September 2001 stieg in Großbritannien die indirekte Diskriminierung von Muslimen um 82.6% an, die offene Diskriminierung um 76.3% (Sheridan, 2006).
Für den Einzelnen und für die Gesellschaft können Vorurteile schwerwiegende Konsequenzen haben. Unter Weißen bestehen bis heute subtile und unbewusste Vorurteile gegenüber Schwarzen, die zu Misstrauen und Benachteiligung führen, z.B. bei beruflichen Auswahlentscheidungen (Dovidio, Gaertner, Kawakami & Hodson, 2002). Auf die volkswirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft können sich Diskriminierungen negativ auswirken, da Potentiale ganzer Gruppen möglicherweise nicht genutzt werden (Woellert, Kröhnert, Sippel & Klingholz, 2009). Bis heute bestehen Intergruppenkonflikte zwischen Ländern, wie der Nahostkonflikt […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Christina Warming
Hat imaginierter Intergruppenkontakt Auswirkungen auf reale Intergruppenkontakte?
Eine experimentelle Studie
ISBN: 978-3-8428-4207-6
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
Zugl. Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland, MA-Thesis / Master, 2012
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2012
I
Abstract
Imaginierter Intergruppenkontakt (IIK) ist eine relativ neue Form Indirekten
Intergruppenkontakts zur Verbesserung von Intergruppeneinstellungen sowie zur
Verringerung von Vorurteilen und Intergruppenängsten. Bisherige Studien zeigen, dass IIK
die Kontaktintentionen und das Kontaktinteresse an der Fremdgruppe stärkt und sich auf
das Verhalten im antizipierten Intergruppenkontakt positiv auswirkt. Diese Studie
untersuchte als erste die Auswirkungen von IIK auf die Qualität realer
Intergruppenkontakte (RIK). Die Versuchspersonen (Vpn) imaginierten zwei
Kontaktszenarien, entweder mit einem Eigen- oder Fremdgruppenmitglied in neutraler oder
positiver Qualität. Danach erfolgte ein RIK mit einer Konföderierten. Subjektive und
objektive Daten wurden für die Bewertung von RIK analysiert. Die Ergebnisse sind nicht
eindeutig; den stärksten Effekt auf RIK hatten vorhandene reale Kontakterfahrungen mit
der Fremdgruppe. Für Vpn mit geringen Kontakterfahrungen hatte IIK eher negative
Effekte. Tendenziell zeigte IIK in positiver Qualität positive Auswirkungen auf RIK. Die
Kontakterfahrungen der Vpn könnten eine Erklärung der uneindeutigen Effekte von IIK auf
RIK sein.
I
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
V
1. Einleitung ... 1
1.2. Realer Intergruppenkontakt... 4
1.2.1. Selbstoffenbarung... 7
1.2.2. Begründung für Indirekte Kontakte ... 9
1.3. Indirekte Intergruppenkontakte ... 10
1.3.1. Erweiterter Kontakt ... 10
1.3.2. Stellvertretender Kontakt ... 11
1.4. Imaginierter Intergruppenkontakt... 12
1.4.1. Auswirkungen auf das Verhalten ... 17
1.4.2. Fragestellung und Ziel der Untersuchung ... 18
2. Hypothesen... 19
3. Methode... 21
3.1. Untersuchungsdesign... 21
3.2. Intergruppenkontext ... 22
3.3. Untersuchungsablauf und Versuchsmaterialien ... 22
3.3.1. Phase 1: Imaginierter Intergruppenkontakt ... 23
3.3.2. Phase 2: Realer Intergruppenkontakt ... 24
3.4. Vortest ... 27
3.4.1. Methode... 27
3.4.2. Ergebnis... 29
3.4.3. Schlussfolgerung ... 31
3.5. Unabhängige Variablen... 31
3.5.1. Manipulationscheck... 33
3.6. Abhängige Variablen und Kontrollvariablen ... 33
3.6.1. Abhängige Variablen... 33
3.6.2. Moderatorvariable ... 37
3.7. Stichprobe... 38
3.8. Statistische Analysen... 38
4. Ergebnis... 39
4.1. Deskriptive Statistiken ... 39
Imaginierter Intergruppenkontakt
II
4.1.1. Manipulationscheck... 39
4.1.2. Nach IIK ... 41
4.1.3. Nach IIK und RIK ... 42
4.2. Kontakterfahrung... 43
4.3. Prüfung der Hypothesen... 44
4.3.1. Kontaktintention nach IIK... 45
4.3.2. Kontaktinteresse nach IIK ... 47
4.3.3. Subjektive Kontaktqualität der Vpn ... 49
4.3.4. Subjektive Kontaktqualität der Konföderierten ... 50
4.3.5. Beurteilung der Konföderierten... 52
4.3.6. Beurteilung der Vpn ... 53
4.3.7. Selbstoffenbarung der Vpn... 55
4.3.8. Anzahl Fragen der Versuchsperson... 57
4.3.9. Qualität des RIK... 59
5. Diskussion ... 63
5.1. Auswirkungen von IIK auf Kontaktintention und -interesse ... 65
5.2. Auswirkungen von IIK auf RIK... 66
5.3. Limitationen und Implikationen... 69
6. Schlussfolgerung ... 74
7. Literaturverzeichnis... 75
8. Anhang ... 86
Imaginierter Intergruppenkontakt
III
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Mittelwerte und Standardabweichungen der nach aufsteigender Intimität
bewerteten Fragen...29
Tabelle 2 Manipulationscheck: Mittelwerte und Standardabweichungen der AVn...41
Tabelle 3 Mittelwerte und Standardabweichungen der AVn nach IIK...42
Tabelle 4 Mittelwerte und Standardabweichungen der AVn nach IIK und RIK...43
Tabelle 5 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der
Kontaktintentionen nach IIK durch die Bedingungen und die
Kontakterfahrung ...47
Tabelle 6 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage des
Kontaktinteresses nach der Imagination durch die Bedingungen und die
Kontakterfahrung...48
Tabelle 7 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der subjektiven
Kontaktqualität der Vpn durch die Bedingungen und die
Kontakterfahrung...50
Tabelle 8 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der subjektiven
Kontaktqualität der Konföderierten durch die Bedingungen und die
Kontakterfahrung...51
Tabelle 9 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der Beurteilung
der Konföderierten durch die Bedingungen und die Kontakterfahrung...52
Tabelle 10 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der Beurteilung
der Vpn durch die Bedingungen und die Kontakterfahrung ...55
Imaginierter Intergruppenkontakt
IV
Tabelle 11 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der
Selbstoffenbarung der Vpn durch die Bedingungen und die
Kontakterfahrung...56
Tabelle 12 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der Anzahl der
gestellten Fragen der Vpn durch die Bedingungen und die
Kontakterfahrung...58
Tabelle 13 Hierarchisch moderierte Regressionsanalyse zur Vorhersage der Qualität des
RIK durch die Bedingungen und die Kontakterfahrung...61
Imaginierter Intergruppenkontakt
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1. Interaktionsdiagramm von Gruppe und Qualität auf die gestellten Fragen
der Versuchsperson...59
Abbildung 2. Simpel-Slopes für die Qualität des RIK, vorhergesagt durch die Imagination
der Eigen- und Fremdgruppe bei hoher Kontakterfahrung (+1 SD) und
geringer Kontakterfahrung (-1 SD)...62
Abbildung 3. Simpel-Slopes für die Qualität des RIK, vorhergesagt durch die Imagination
der Eigen- und Fremdgruppe in positiver und neutraler Qualität bei hoher
Kontakterfahrung (+1 SD) und geringer Kontakterfahrung (-1 SD) IK =
imaginierter Kontakt...63
1
Nahezu jeder Mensch gehört einer Gruppe an, beispielsweise aufgrund seiner
Staatsbürgerschaft, ethnischen Zugehörigkeit oder Religion. Ein allgegenwärtiges
Phänomen sind Intergruppenkonflikte. Generell besteht bei Menschen die Tendenz, die
Eigengruppe zu bevorzugen und die Mitglieder von Fremdgruppen abzuwerten. Eine solche
Eigengruppenfavorisierung ist selbst dann zu finden, wenn keine negativen Einstellungen
gegenüber der Fremdgruppe bestehen und die Zuteilung zur Eigen- und Fremdgruppe
willkürlich erfolgt (Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971). Zur Entstehung von
Intergruppenkonflikten können Stereotype und Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe
beitragen. Stereotype sind sozial geteilte kognitive Überzeugungen über bestimmte
Eigenschaften der Fremdgruppe, wie z.B. Ansichten über das Äußere der
Gruppenmitglieder, ihre Verhaltensweisen oder Einstellungen (Aronson, Wilson & Akert,
2008). Vorurteile werden als ,,feindselige oder negative Einstellung gegenüber den
Mitgliedern einer bestimmten Gruppe, und zwar allein aufgrund deren Zugehörigkeit zu
dieser Gruppe" definiert (Aronson, et al., 2008, S. 460). Dadurch wird deutlich, dass
Vorurteile weitestgehend ungerechtfertigt gegenüber einzelnen Mitgliedern sind. Durch
soziale Kategorisierung und soziales Lernen können Vorurteile immer wieder neu
entstehen. Wird aufgrund der Vorurteile ein aktives Verhalten gegenüber der Fremdgruppe
entwickelt, entstehen Diskriminierungen, ,,ungerechtfertigte negative oder schädliche
Verhaltensweisen...nur wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe" (Aronson et al., 2008,
S. 460). Diskriminierungen können sogar durch Ereignisse, die durch die Weltpresse gehen,
aktiviert werden. Nach dem 11. September 2001 stieg in Großbritannien die indirekte
Diskriminierung von Muslimen um 82.6% an, die offene Diskriminierung um 76.3%
(Sheridan, 2006).
Für den Einzelnen und für die Gesellschaft können Vorurteile schwerwiegende
Konsequenzen haben. Unter Weißen bestehen bis heute subtile und unbewusste Vorurteile
Imaginierter Intergruppenkontakt
2
gegenüber Schwarzen, die zu Misstrauen und Benachteiligung führen, z.B. bei beruflichen
Auswahlentscheidungen (Dovidio, Gaertner, Kawakami & Hodson, 2002). Auf die
volkswirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft können sich Diskriminierungen
negativ auswirken, da Potentiale ganzer Gruppen möglicherweise nicht genutzt werden
(Woellert, Kröhnert, Sippel & Klingholz, 2009). Bis heute bestehen Intergruppenkonflikte
zwischen Ländern, wie der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern sowie der
Zypernkonflikt zwischen griechischen und türkischen Zyprioten.
Seit langem gilt der reale Intergruppenkontakt als die effektivste Strategie zur
Verbesserung von Intergruppenbeziehungen und zur Reduktion von Vorurteilen (Pettigrew
& Tropp, 2006). Insbesondere zeigen positive Intergruppenkontakte positive Auswirkungen
auf Vorurteile und Intergruppenbeziehungen (Pettigrew & Tropp, 2006). Die Qualität des
Intergruppenkontakts spielt somit eine bedeutsame Rolle bei der Reduktion von
Vorurteilen.
In der Praxis sind Intergruppenkontakte in hoher Qualität häufig nur schwer zu
realisieren. Insbesondere bei Intergruppenkonflikten vermeiden die Mitglieder der Gruppen
häufig den Kontakt aufgrund von Vorurteilen oder Intergruppenängsten. Selbst ohne
bestehende Intergruppenkonflikte leben Mitglieder verschiedener Gruppen freiwillig
segregiert und vermeiden alltägliche Intergruppenkontakte (Clack, Dixon & Tredoux,
2005). Selbst wenn Gruppen gerne miteinander in Kontakt treten würden, vermeiden sie
dieses in dem Glauben, dass die Fremdgruppe keinen Kontakt zu ihnen möchte (Shelton &
Richeson, 2005). Allein aufgrund von gesellschaftlicher Segregation kann keine
Möglichkeit bestehen, Kontakterfahrungen mit einer bestimmten Fremdgruppe zu sammeln
(Wagner, van Dick, Pettigrew & Christ, 2003). Sogar innerhalb einer Gemeinde können die
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme begrenzt sein, da Gruppen in unterschiedlichen
Wohngebieten leben oder verschiedene Bildungsinstitutionen besuchen. Bedingt durch das
Imaginierter Intergruppenkontakt
3
Leben in entfernten Ländern und bestehende Ländergrenzen können einige
Intergruppenkontakte nicht hergestellt werden. Diese Hindernisse beschränken die
Möglichkeiten, reale Intergruppenkontakte aufzunehmen.
Da Intergruppenkonflikte ein allgegenwärtiges Problem sind und immer wieder neu
entstehen, sind die Forschungsarbeiten zum Intergruppenkontakt in den letzten Jahrzehnten
stark angestiegen (Pettigrew, Tropp, Wagner & Christ, 2011). Unlängst wurde die
praktische Anwendbarkeit von realen Intergruppenkontakten nach gewalttätigen Unruhen
in Großbritannien kritisch diskutiert (Dixon, Durrheim & Tredoux, 2005). Bemängelt
wurde, dass reale Intergruppenkontakte aufgrund rassistischer Segregation in der Realität
nicht durchzuführen wären. Da diese Hindernisse für Intergruppenkontakte weiter bestehen,
bleibt bis heute die Frage aktuell, wie Vorurteile gegenüber Fremdgruppen verringert
werden können (Pettigrew et al., 2011).
In der Forschung wurden vermehrt Indirekte Intergruppenkontakte entwickelt, d.h.
Kontakte, die das reale Aufsuchen der Fremdgruppe nicht erfordern. Indirekte
Intergruppenkontakte können ähnlich wie reale Intergruppenkontakte die Einstellungen
gegenüber der Fremdgruppe positiv beeinflussen (Dovidio, Eller & Hewstone, 2011). Der
imaginierte Intergruppenkontakt (IIK) ist die neuste indirekte Kontaktform, bei der ein
realer Intergruppenkontakt (RIK) nicht erforderlich ist. IIK beinhaltet die Imagination eines
realen Kontakts, sodass der Intergruppenkontakt allein in der Vorstellung stattfindet. Diese
Kontaktform verringert Vorurteile und verbessert Emotionen gegenüber einer Fremdgruppe
(Turner & Crisp, 2010; Turner, Crisp & Lambert, 2007; Turner & West, 2011), reduziert
Intergruppenangst (Husnu & Crisp 2010a, Turner, Crisp & Lambert, 2007; West et al.,
2011) und verstärkt die Kontaktintentionen sowie das Kontaktinteresse an der Fremdgruppe
(Crisp & Husnu, 2011; Husnu & Crisp, 2010a, 2010b, 2011). Aufgrund der positiven
Imaginierter Intergruppenkontakt
4
Forschungsergebnisse von IIK ist anzunehmen, dass nachfolgender RIK in positiver
Qualität verläuft.
Es wird vielfach abgeleitetet, dass IIK zur Förderung positiver
Intergruppenbeziehungen eingesetzt werden kann, wenn keine realen
Kontaktmöglichkeiten gegeben sind (Crisp & Turner, 2009; Crisp, Husnu, Meleady, Stathi
& Turner, 2010; Turner, Crisp et al., 2007). IIK kann als Methode zur Herstellung positiver
Intergruppenkontakte eingesetzt werden und reale Intergruppenkontakte erleichtern.
Angenommen wird, dass IIK positive Auswirkungen auf das Verhalten im RIK zeigt
(Turner & West, 2011) und die Wahrscheinlichkeit für nachfolgenden positiven
Intergruppenkontakt erhöht (Crisp & Turner, 2009). Demnach könnte IIK bei
Interventionen als erste Kontaktform auf einem Kontinuum von Kontakten eingesetzt
werden, zur Vorbereitung auf einen positiven RIK (Crisp & Turner, 2009).
Bis zum heutigen Forschungsstand wurde nicht untersucht, ob sich IIK positiv auf
RIK auswirkt. Empfohlen wird, nach IIK das verbale und nonverbale Verhalten während
RIK zu untersuchen (Turner & West, 2011); die vorliegende Studie widmet sich dieser
Untersuchung. Damit schließt diese Studie direkt an den bisherigen Forschungsstand an.
Insbesondere wird untersucht, ob IIK positive Auswirkungen auf die Qualität realer
Intergruppenkontakte zeigt und somit Intergruppenkontakte erleichtert. Positive Ergebnisse
dieser Studie könnten zu der Verbesserung von Intergruppenbeziehungen beitragen.
1.2. Realer Intergruppenkontakt
Seit langem gilt RIK als die effektivste Strategie zur Verbesserung von
Intergruppenbeziehungen und zur Reduktion von Vorurteilen und Konflikten. Sammeln
Menschen Kontakterfahrungen mit einer Fremdgruppe, ist es wahrscheinlich, dass wenige
Vorurteile bestehen (Pettigrew et al., 2011). Gordon Allport (1954) entwickelte die wohl
Imaginierter Intergruppenkontakt
5
einflussreichste Theorie zum Intergruppenkontakt, die Kontakthypothese. Sie beschreibt die
Bedingungen realen Intergruppenkontakts, die erfüllt sein sollten, um Vorurteile und
Diskriminierungen zwischen Fremdgruppenmitgliedern abzubauen. Diese Bedingungen
beinhalten, dass während RIK die Fremdgruppenmitglieder den gleichen Status aufweisen,
gemeinsame Ziele verfolgen, miteinander kooperieren und die Unterstützung durch
Autoritäten, Gesetze oder Normen gegeben ist (Allport, 1954). Die Erfüllung dieser
optimalen Bedingungen führt laut Allport (1954) zu einem Abbau von Vorurteilen und
Feindseligkeit gegenüber der Fremdgruppe.
RIK reduziert Vorurteile insbesondere unter der Erfüllung von Allports
Kontaktbedingungen (Allport, 1954), dieses ist empirisch gut belegt (Pettigrew & Tropp,
2006; Pettigrew et al., 2011).
Zudem kann RIK Bedrohungen durch Stereotype verringern
(Abrams et al., 2008). Pettigrew und Tropp (2006) zeigen in einer Metaanalyse von 515
Studien mit 713 unabhängigen Stichproben aus 38 Nationen, dass RIK Vorurteile
gegenüber einer Fremdgruppe reduziert. In 94% der Studien bestand eine negative
Beziehung zwischen RIK und Vorurteilen. Je strenger das methodische Vorgehen der
Studien und je höher die Qualität des RIK war, desto geringer waren die Vorurteile. Die
positiven Effekte von RIK wurden anhand unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten
bestätigt und bei verschiedenen Gruppen nachgewiesen, z.B. Homosexuellen, älteren
Personen oder psychisch Erkrankten. Zudem zeigen die positiven Effekte von RIK eine
Generalisierung über die gesamte Fremdgruppe hinweg. Pettigrew und Tropp (2006) stellen
fest, dass Intergruppenkontakt selbst dann zu einer Reduktion von Vorurteilen führt, wenn
Allports Bedingungen realen Intergruppenkontakts (Allport, 1954) nicht erfüllt sind. Sie
schlussfolgern hieraus, dass Allports Kontaktbedingungen (Allport, 1954) optimal für den
Abbau von Vorurteilen sind, aber nicht unbedingt notwendig, um Vorurteile zu reduzieren.
Imaginierter Intergruppenkontakt
6
Somit können Kontakterfahrungen im Allgemeinen zur Förderung harmonischer
Intergruppenbeziehungen beitragen.
Die Untersuchungen der Wirkmechanismen des realen Intergruppenkontakts zeigen,
dass die Aktivierung von Affekten im Intergruppenkontakt besonders bedeutsam ist. Eine
Metaanalyse von Pettigrew und Tropp (2008) zeigt, dass die Empathieerhöhung und die
Angstreduktion die einflussreichsten Mediatoren bei der Reduktion von Vorurteilen
darstellen. Es ist bedeutender, eine affektive Bindung zu einem Fremdgruppenmitglied
einzugehen als kognitive Erfahrungen zu machen und beispielsweise vermehrtes Wissen
über die Fremdgruppe zu erlangen.
Intergruppenfreundschaften beinhalten affektive Bindungen und sind die wohl
effektivste Form von Intergruppenkontakten. Pettigrew (1997) sah das
Freundschaftspotential eines Intergruppenkontakts als eine wichtige Bedingung zur
Reduktion von Vorurteilen an. Ein Intergruppenkontakt sollte so gestaltet sein, dass
zwischen den Fremdgruppenmitgliedern eine Freundschaft entstehen kann. Pettigrew
(1998) erweiterte Allports Kontakthypothese (Allport, 1954) um den Faktor
Freundschaftspotential. Einer breite Stichprobe von über 3800 befragten Personen aus
Frankreich, Großbritannien, Niederlanden und Deutschland zeigte, dass
Intergruppenfreundschaften mit geringeren Vorurteilen einhergehen (Pettigrew, 1997).
Zahlreiche Studien bestätigen, dass Intergruppenfreundschaften die Einstellungen
gegenüber der Fremdgruppe verbessern und Vorurteile reduzieren (Pettigrew, 1997;
Pettigrew & Tropp, 2006; Turner, Hewstone & Voci, 2007). Intergruppenfreundschaften
beeinflussen explizite und implizite Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe (Turner,
Hewstone & Voci, 2007) und erhöhen die Wahrnehmung der Fremdgruppenvariablilität,
die Gruppe wird weniger einseitig wahrgenommen (Paolini et al., 2004).
Imaginierter Intergruppenkontakt
7
Intergruppenängste oder Vorurteile gegenüber einer bestimmten Fremdgruppe
können im Intergruppenkontakt sichtbar werden. Ein Zeichen für Intergruppenangst kann
die Vermeidung von Augenkontakt sein. Menschen, die lieber einen bestimmten
Fremdgruppenkontakt vermeiden, neigen dazu, weniger Augenkontakt mit dem
Fremdgruppenmitglied zu suchen als jene, die gerne in solch einem Kontakt stehen (Ickes,
1984). Zudem empfinden diejenigen, die lieber den Fremdgruppenkontakt vermeiden, mehr
Ängste und auch vermehrte Sorgen im Intergruppenkontakt, und diese Ängste können sich
auf ihren Interaktionspartner auswirken (Ickes, 1984). Wichtig ist, Intergruppenängste
abzubauen, bevor RIK entsteht, da eine positive Qualität während RIK Vorurteile
reduzieren kann.
RIK ist in der Forschung und Praxis erfolgreich anwendbar, solange Fremdgruppen
für die Kontaktherstellung verfügbar sind. Werden die von Allport (1954) geforderten
Bedingungen geschaffen, ist der Abbau von Vorurteilen sehr wahrscheinlich.
Kontakterfahrungen in freundschaftlicher Natur sind sehr förderlich, um positive
Intergruppenbeziehungen zu schaffen.
Geringe Kontakterfahrungen mit der Fremdgruppe können zu Vorurteilen
gegenüber der Fremdgruppe führen (McGlothlin & Killen, 2010) und zu
Missverständnissen im Intergruppenkontakt (Vorauer & Sakamoto, 2006). Demzufolge
sind besonders bei Personen mit geringen Kontakterfahrungen Interventionen zur
Verringerung von Vorurteilen notwendig.
1.2.1. Selbstoffenbarung
Selbstoffenbarung ist ein Prozess, in dem Menschen ihre innersten Gefühle und
Erfahrungen ihrem Interaktionspartner offenbaren (Manstead & Hewstone, 1995) und ihre
intimen Gedanken oder privaten Lebenserfahrungen mitteilen. Den stärksten positiven
Imaginierter Intergruppenkontakt
8
Einfluss auf die Einstellung zur Fremdgruppe hat die Selbstoffenbarung zu einem
befreundeten Fremdgruppenmitglied, neben der gemeinsam verbrachten Zeit (Davies,
Tropp, Aron, Pettigrew & Wright, 2011). Bei Intergruppenfreundschaften mediiert
Selbstoffenbarung die Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe (Turner, Hewstone, et al.,
2007). Eine Intergruppenfreundschaft wirkt sich positiv auf Selbstoffenbarung aus, und
diese zeigt positive Effekte auf die Einstellungen zur der Fremdgruppe.
Selbstoffenbarung ist zumeist ein reziproker Prozess. Während RIK wurde gezeigt,
dass die Selbstoffenbarung eines weißen Interviewers zu mehr Selbstoffenbarung des
schwarzen Befragten führte (Berg & Wright-Buckley, 1988). In einer longitudinalen Studie
zu Intergruppenbeziehungen stellten Turner und Feddes (2011) fest, dass reziproke
Selbstoffenbarung die Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe positiv vorhersagt. Ist die
Typikalität eines Fremdgruppenmitglieds gegeben, reduziert Selbstoffenbarung während
eines kooperativen Intergruppenkontakts Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe (Ensari &
Miller, 2002). Diese reduzierten Vorurteile können gegenüber der gesamten Fremdgruppe
generalisieren.
Des Weiteren kann Selbstoffenbarung im RIK darauf hinweisen, dass das
Fremdgruppenmitglied von seinem Gegenüber gemocht wird. Schwarze Befragte gaben
vermehrte Sympathien gegenüber einem weißen Interviewer an, wenn dieser
Selbstoffenbarung zeigte (Berg & Wright-Buckley, 1988). Allgemein zeigen Menschen
vermehrt Selbstoffenbarung, wenn ihnen ihr Gegenüber sympathisch ist (Collins & Miller,
1994).
Selbstoffenbarung während RIK kann positive Auswirkungen auf die
Wahrnehmung des Fremdgruppenmitglieds haben. Menschen neigen dazu, denjenigen zu
mögen, dem sie sich offenbart haben (Collins & Miller, 1994). Es werden Menschen, die
Selbstoffenbarung zeigen, mehr gemocht als solche, die sich weniger öffnen (Collins &
Imaginierter Intergruppenkontakt
9
Miller, 1994). Bereits ein Gespräch mit Selbstoffenbarung kann zu positiven Affekten
führen (Vittengl & Holt, 2000).
Entsteht während RIK Selbstoffenbarung, kann dieses auf ein vorhandenes
Freundschaftspotential des Kontakts hinweisen. Selbstoffenbarung ist für die Entwicklung
und Aufrechterhaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig (Chaikin &
Derlega, 1976) und der kürzeste Weg, in Beziehungen Intimität herzustellen (Fehr, 2004).
Der positive Zusammenhang zwischen Selbstoffenbarung und den Einstellungen zur
Fremdgruppe wird durch Vertrauen zur Fremdgruppe, Empathie im Intergruppenkontakt
und persönlichen Wert des Fremdgruppenkontakts mediiert (Turner, Hewstone, et al.,
2007). Demzufolge kann Selbstoffenbarung während RIK Intimität und Vertrauen im
Kontakt reflektieren.
1.2.2. Begründung für Indirekte Kontakte
Die zahlreichen positiven Forschungsergebnisse zu RIK lassen die Schlussfolgerung
zu, dass RIK erfolgreich einsetzbar ist, um Vorurteile zu reduzieren und Toleranz zwischen
Fremdgruppen zu fördern. Allports (1954) Bedingungen im RIK bieten klare Strukturen,
bei deren Einhaltung die Reduktion von Vorurteilen sehr wahrscheinlich ist. Der Erfolg des
RIK ist anhand verschiedener Gruppen in verschiedenen Situationen bewiesen (Pettigrew
& Tropp, 2006), sogar alltägliche Kontakte sind dazu geeignet, Vorurteile zu reduzieren.
Förderliche Faktoren scheinen das Freundschaftspotential, die Kooperation und die
Selbstoffenbarung zu sein.
Bei allen positiven Auswirkungen des RIK gilt es zu berücksichtigen, dass immer
ein Fremdgruppenkontakt hergestellt werden muss. Stets setzt die Erfüllung von Allport
(1954) die Bedingung voraus, dass Fremdgruppen real miteinander in Kontakt treten. RIK
kann jedoch unter Umständen schwer oder gar nicht zu realisieren sein. Insbesondere bei
Imaginierter Intergruppenkontakt
10
Intergruppenkonflikten wird ein Kontakt zumeist gemieden oder ist bei starker Segregation
nicht möglich. In diesen Fällen wäre RIK besonders intendiert. Die Limitationen in der
Anwendbarkeit von RIK werden bereits diskutiert (Dixon et al., 2005). Seit einiger Zeit
werden in der Forschung Indirekte Intergruppenkontakte untersucht, die keine realen
Intergruppenkontakte beinhalten, um Intergruppenbeziehungen zu verbessern.
1.3. Indirekte Intergruppenkontakte
Indirekter Kontakt kann, ähnlich wie RIK, positive Auswirkungen auf die
Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe bewirken. Der Vorteil indirekter
Intergruppenkontakte ist, dass kein direkter Intergruppenkontakt hergestellt werden muss.
Sie sind insbesondere dann praktisch einsetzbar, wenn keine Möglichkeit für die
Herstellung von RIK besteht. Trotz dieses Vorteils der praktischen Anwendbarkeit gibt es
in der Forschung bisher wenige Studien zu indirekten Intergruppenkontakten (Dovidio et
al., 2011). Evaluierte Interventionen nutzen bereits Formen von Indirekten
Intergruppenkontakten zur Verbesserung von Einstellungen gegenüber Fremdgruppen
(Cameron, Rutland & Brown, 2007; Cameron, Rutland, Douch & Brown, 2006). Im
Folgenden werden die am häufigsten untersuchten Formen indirekten Intergruppenkontakts
näher beschrieben: Der stellvertretende Kontakt (SK), der erweiterte Kontakt (EK) und der
imaginierte Intergruppenkontakt (IIK).
1.3.1. Erweiterter Kontakt
Als EK wird das Wissen darüber bezeichnet, dass ein Eigengruppenmitglied in
positivem Kontakt zu einem Fremdgruppenmitglied steht (Wright, Aron, McLaughlin-
Volpe & Ropp, 1997). EK kann negative Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe
verbessern und Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe verringern (Wright et al., 1997).
Imaginierter Intergruppenkontakt
11
Eine kurze Beschreibung von EK lautet: ,,the friend of my friend is my friend" (Pettigrew
et al., 2011, S. 277). Für EK ist es von Bedeutung, wer aus der Eigengruppe mit dem
Fremdgruppenmitglied befreundet ist. Förderlich ist, wenn zu dem Eigengruppenmitglied
eine enge Beziehung besteht, z.B. es ein Freund oder Familienmitglied ist (Tausch,
Hewstone, Schmid, Hughes & Cairns, 2011). Personen, die von EK berichten, schreiben
der Fremdgruppe mehr Variabilität zu (Paolini, et al., 2004). Die positiven Auswirkungen
von EK wurden anhand verschiedenster Fremdgruppen und auf unterschiedlichen
Variablen gezeigt (Paolini et al., 2004; Wright et al., 1997).
Bei Intergruppenkonflikten kann EK zu verbesserten Einstellungen zur
Fremdgruppe führen. Wright et al. (1997) stellten in einer Laborstudie
Intergruppenkonflikte in Anlehnung an die Robbers Cave Studien her; danach brachten sie
rivalisierende Versuchspersonen (Vpn) in positiven Intergruppenkontakt. Diese Vpn
berichteten ihrer Eigengruppe von den positiven Erfahrungen. Dieser EK verringerte die
negativen Einstellungen zu der Fremdgruppe und die Eigengruppenfavorisierung.
EK ist ein mögliches Einsatzmittel zur Reduktion von Vorurteilen, wenn die
Möglichkeiten für RIK nicht bestehen. Dennoch setzt EK ein gewisses Maß an direktem
Kontakt voraus, der jedoch bei einigen Fremdgruppen nicht möglich ist, insbesondere bei
starker Segregation von Gruppen oder aufgrund regionaler Gegebenheiten. Welche
Möglichkeiten bestehen jedoch, wenn solche realen Intergruppenkontakte in dem sozialen
Netzwerk einer Person nicht vorzufinden sind? Eine Lösung wäre eine indirekte
Kontaktform, die keinen realen Intergruppenkontakt erfordert.
1.3.2. Stellvertretender Kontakt
Unter stellvertretendem Kontakt (SK) wird die Beobachtung eines erfolgreichen
Kontakts zwischen einem Eigen- und einem Fremdgruppenmitglied verstanden (Mazziotta,
Imaginierter Intergruppenkontakt
12
Mummendey & Wright, 2011). Während SK ist der Beobachtende nicht in den realen
Intergruppenkontakt involviert, und er muss kein Eigengruppenmitglied kennen, das mit
einem Fremdgruppenmitglied befreundet ist. Es hat sich gezeigt, dass die Fremdgruppe
positiver bewertet wird, wenn die beobachtete Interaktion freundschaftlich ist, im Vergleich
zu einem feindlichen oder fremden Kontakt (Wright et al., 1997). Schon Bandura (1986,
1997) stellte mit der sozial-kognitiven Lerntheorie fest, dass allein durch die Beobachtung
einer anderen Person neue kognitive Fertigkeiten und Verhaltensmuster erworben werden
können.
Erste Studien haben gezeigt, dass SK die Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe
verbessert und die Kontaktbereitschaft mit der Fremdgruppe erhöht (Mazziotta et al.,
2011). Um Vorurteile gegenüber einer Fremdgruppe zu verringern, kann es sogar genügen,
ein Fernsehprogramm zu sehen, in dem ein positiver Intergruppenkontakt dargestellt wird
(Schiappa, Gregg & Hewes, 2005).
Ähnlich wie bei EK ist der Vorteil von SK, dass die positiven Effekte eines RIK
auch dann zu verwirklichen sind, wenn kein RIK hergestellt werden kann. Ein weiteres
Paradigma zu Indirektem Kontakt, das im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht, ist der
Imaginierte Intergruppenkontakt (IIK), der im folgenden Kapitel dargestellt wird.
1.4. Imaginierter Intergruppenkontakt
Imaginierter Intergruppenkontakt (IIK) wird als die mentale Simulation einer
sozialen Interaktion mit einem oder mehreren Mitgliedern einer Fremdgruppe definiert
(Crisp & Turner, 2009). Für IIK werden Personen instruiert, sich ein ihnen vorgegebenes
Intergruppenkontaktszenario für einige Minuten vorzustellen. Bereits ein IIK von 1-2
Minuten genügt, um positive Effekte auf die Kontaktintentionen, die Einstellungen
gegenüber der Fremdgruppe und das nonverbale Verhalten zu erzielen (Husnu & Crisp,
Imaginierter Intergruppenkontakt
13
2010a, 2010b; Turner, Crisp et al., 2007; Turner & West, 2011). Die am häufigsten
verwendeten Kontaktszenarien beinhalten ein Gespräch mit dem Fremdgruppenmitglied
(Crisp et al., 2010). Besonders wichtig ist die positive Qualität von IIK. Eine positive
Qualität während IIK bewirkt positive Einstellungen zur Fremdgruppe und geringere
Intergruppenängste, dahingegen hat ein neutrales, nicht explizit positiv beschriebenes
Kontaktszenario keine positiven Auswirkungen (West, Holmes & Hewstone, 2011). Zwei
Elemente sind für den Erfolg von IIK wesentlich: Zum einen sollen die Personen
Intergruppeninteraktionen positiv imaginieren und zum anderen aktiv imaginieren (Crisp &
Turner, 2009). Die positive Imagination erfolgt durch ein positiv formuliertes
Kontaktszenario, z.B. eine Unterhaltung, in der interessante und positive Dinge über das
Fremdgruppenmitglied erfahren werden (Stathi & Crisp, 2008). Eine aktive Imagination
wird durch ein elaboriertes Kontaktszenario erleichtert. Ein elaboriertes Kontaktszenario
beinhaltet eine detailliert beschriebene Kontaktsituation, beispielsweise eine Unterhaltung
mit einem Fremdgruppenmitglied mit der konkreten Angabe, wo und wann der
Intergruppenkontakt stattfindet (Husnu & Crisp, 2010a).
Zahlreiche Studien belegen die positiven Auswirkungen von IIK. Ein positiver IIK
in hoher Qualität reduziert erfolgreich Vorurteile (West et al., 2011) und
Intergruppenängste (Turner, Crisp, et al., 2007; West et al., 2011). IIK verbessert explizite
Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe (Turner, Crisp, et al., 2007) und auch implizite
Einstellungen (Turner & Crisp, 2010). Zudem stärkt IIK die Kontaktintentionen; nach IIK
gaben die Imaginierenden an, in Zukunft vermehrt in Kontakt mit der Fremdgruppe treten
zu wollen (Crisp & Husnu, 2011; Husnu, & Crisp, 2010a, 2010b, 2011). IIK bewirkt
positive Emotionen und Überzeugungen gegenüber der Fremdgruppe (Turner & West,
2011) und verringert Intergruppenängste und Bedrohungen durch Stereotype erfolgreich
(Abrams et al., 2008; Husnu & Crisp, 2010a; Turner, Crisp et al., 2007; West et al., 2011).
Imaginierter Intergruppenkontakt
14
Nach IIK werden positive Eigenschaften auf die Fremdgruppe projiziert (Stathi & Crisp,
2008). Die Fremdgruppe wird nach IIK als heterogener wahrgenommen, es besteht weniger
Eigengruppenfavorisierung (Turner, Crisp, et al., 2007). Ein positiver IIK kann zu
verstärkter Selbstwirksamkeit in Bezug auf zukünftige reale Kontakte führen und die
Zuversicht erhöhen, von dem Fremdgruppenmitglied verstanden zu werden (Stathi, Crisp &
Hogg, 2011). IIK ist bei verschiedenen Fremdgruppen erfolgreich anwendbar. Die
positiven Effekte von IIK konnten anhand verschiedenster Fremdgruppen festgestellt
werden: An Muslimen, Franzosen, griechischen Zyprioten, Homosexuellen, älteren und
jüngeren Personen sowie auch psychisch Erkrankten (Abrams et al., 2008; Crisp & Husnu,
2011, Husnu & Crisp, 2010b; Husnu & Crisp, 2011; Stathi & Crisp, 2008; Turner & Crisp,
2010; Turner, Crisp et al., 2007). Harwood, Paolini, Joyce, Rubin und Arroyo (2011)
haben gezeigt, dass IIK sekundäre Transfereffekte hervorruft; der positive Effekt von IIK
auf die Einstellungen gegenüber einer Gruppe generalisiert auf die Einstellungen zu
anderen Gruppen.
Ein zentraler Wirkfaktor von IIK ist die mentale Imagination, mit der die positiven
Veränderungen in den Einstellungen und Kontaktintentionen bewirkt werden (Turner, et
al., 2007). Die aktive mentale Imagination wird mit einem elaborierten Kontaktszenario
gefördert; mehrere Studien zeigen, dass IIK wirksamer ist, wenn ein elaboriertes
Kontaktszenario imaginiert wird (Husnu & Crisp, 2010a, 2011; Turner, Crisp et al., 2007,
West et al., 2011). Ein elaborierter IIK bewirkt vermehrte Kontaktintentionen im Vergleich
zu einer Imagination ohne Orts- und Zeitangabe (Husnu & Crisp, 2010a). Ähnlich wie im
realen Kontakt wird während IIK die Wahrnehmung der Fremdgruppe aktiviert. Die
Imaginierenden stellen sich die Inhalte vor, die sie über die Fremdgruppe erfahren können
und die Emotionen, die sie dabei empfinden.
Turner, Crisp et al. (2007) zufolge werden
während IIK automatisch Konzepte aktiviert, die während erfolgreicher realer
Imaginierter Intergruppenkontakt
15
Intergruppenkontakte aktiviert werden. Die Autoren nehmen an, dass IIK bewusste
Prozesse erzeugt, die ähnlich zu den Prozessen während RIK sind; z.B. stellen sich die
Imaginierenden vor, wie sie sich während RIK fühlen und was sie von dem
Fremdgruppenmitglied lernen können. Diese positiven Prozesse könnten eine positive
Einstellungsänderung zur Folge haben, sodass sich die Imaginierenden in zukünftigen
Intergruppenkontakten wohler fühlen könnten (Turner, Crisp et al., 2007).
Alternativerklärungen wie Priming können den Erfolg von IIK nicht erklären; IIK
zeigt nur dann Effekte, wenn der Intergruppenkontakt imaginiert wird, das alleinige
Denken an einen Intergruppenkontakt reicht nicht aus (Turner, Crisp et al., 2007). Des
Weiteren kann ausgeschlossen werden, dass der demand-Charakter einer Untersuchung
eine Alternativerklärung für die Wirksamkeit von IIK ist. Turner, Crisp et al. (2007)
befragten nach ihrer Studie zu IIK die Vpn, keine Vpn hatte das Ziel der Untersuchung
erkannt, dennoch verbesserte IIK die Einstellungen zur Fremdgruppe. Eine weitere
mögliche Alternativerklärung für die positiven Effekte von IIK könnte die soziale
Erwünschtheit sein. Diese Erklärung wurde jedoch ausgeschlossen, da IIK Effekte auf die
impliziten Einstellungen zeigt (Turner & Crisp, 2010) und diese kaum willentlich zu
beeinflussen sind. Möglich wäre, dass allein die Imagination einer sozialen Interaktion die
Erklärung für die Effekte von IIK ist. Jedoch hat die Imagination der sozialen Interaktion
eines Fremdgruppenmitglieds positivere Auswirkungen als die Imagination einer sozialen
Interaktion mit einem unspezifischen Fremden (Stathi & Crisp, 2008). Den
Forschungsergebnissen zufolge erzielt die aktive Imagination der Fremdgruppe positive
Auswirkungen auf die Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe.
Zur Verstärkung der Auswirkungen von IIK ist es wirksam, zwei heterogene
Kontaktszenarien nacheinander zu imaginieren, d.h. Kontaktszenarien, deren Inhalte an
unterschiedlichen Orten zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783842842076
- DOI
- 10.3239/9783842842076
- Dateigröße
- 638 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld – Psychologie und Sportwissenschaft, Studiengang Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2012 (November)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- intergruppenkontakt kontaktinteresse
- Produktsicherheit
- Diplom.de