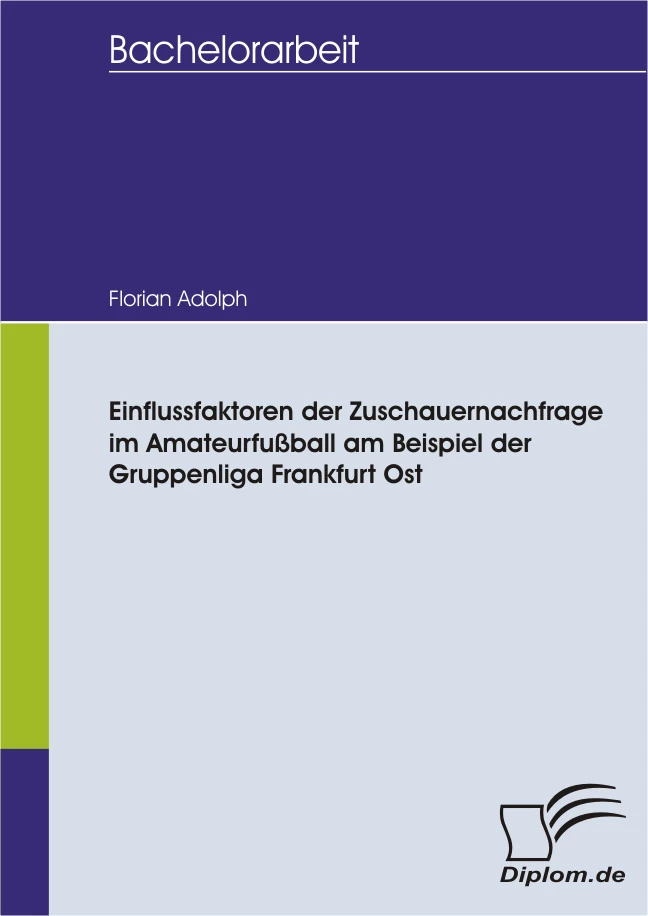Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage im Amateurfußball am Beispiel der Gruppenliga Frankfurt Ost
Zusammenfassung
Am 24. April 2009 beschloss der DFB-Bundestag einen neuen Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der DFL (vgl. DFB 2009). Dieser sah eine Spielplanreform der Fußballbundesliga vor, um massive Einnahmeausfälle bei der Vermarktung der Medienrechte zu verhindern (ebd.). Als wesentlichste Veränderung wurde ein Bundesligaspiel an Sonntagen um 15:30 Uhr ab der Saison 2009/2010 eingeführt. Bis dahin wurde die traditionelle Anstoßzeit der zahlreichen Amateurvereine in Deutschland, sonntags um 15 Uhr, von Bundesligaspielen frei gehalten und erst ab 17:30 Uhr gespielt.
Dieser Beschluss löste seitens der Amateurvereine bundesweit Proteste aus. Vor allem von Vereinen im Ruhrgebiet, wo die Dichte von Bundesligaclubs sehr hoch ist, wurden Einbrüche der Zuschauerresonanz erwartet. Der Sprecher der dort gegründeten Protest-Initiative 'Unser Sonntag', Vorsitzender eines Vereins der Kreisliga A, unweit der Schalker Veltins-Arena, prognostizierte: 'Wenn Schalke um 15:30 Uhr spielen wird, stünde ich alleine auf unserem Sportplatz' (Dobbert 2009). Nach der Einführung des neuen Bundesligaspielplans bestätigte er Ende 2009 die Befürchtungen und resümierte leergefegte Plätze und Einbußen bis zu 50 Prozent (vgl. Drepper 2009). Aber auch andere Regionen zeigen sich betroffen. Der Vorsitzende eines sechs Kilometer von Stuttgart entfernten Vereins beklagt etwa 20 Prozent weniger Zuschauer, wenn der VfB Stuttgart an einem Sonntag spielt (vgl. ebd.).
Die bereits zuvor dagewesenen Klagen über abnehmenden Zuschauerzuspruch im Amateurfußball fanden mit der Einführung des frühen Sonntagsspiels in der Bundesliga ihren jüngsten Höhepunkt. Dies ist Anlass und Motivation, sich zunächst einmal grundsätzlich mit den Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage in diesem Bereich zu beschäftigen. Somit soll die vorliegende Arbeit dazu beitragen, die Diskussion wissenschaftlich zu bereichern.
Problemstellung und Ziel:
Bisherige Forschungsergebnisse von Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage beschränken sich nahezu ausschließlich auf den professionellen Teamsport. Bei Untersuchungen des Fußballs in Deutschland dient dabei wiederum fast ausnahmslos die Bundesliga als Betrachtungsgegenstand. Die Zuschauernachfrage im Amateurfußball ist im Prinzip bis heute wissenschaftlich nicht gewürdigt.
Eine Übersicht ökonomischer Untersuchungsergebnisse von Bestimmungsfaktoren der Nachfrage nach sportlichen Wettkämpfen gibt Heinemann (1995, S. 178 ff.). Roy (2004) liefert […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel
1.2 Ökonomische Relevanz
1.3 Fragestellungen und Aufbau
2 Einbettung der Gruppenliga Frankfurt Ost in die Ligaorganisation des Hessischen Fußball-Verbandes e.V
3 Gründe der Nachfrage nach Sportveranstaltungen
3.1 Motive des Zuschauers aus soziologischer und psychologischer Perspektive
3.2 Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage aus ökonomischer Perspektive
4 Empirische Untersuchung: Ökonomisches Modell der Einflussfaktoren auf die Zuschauernachfrage in der Gruppenliga Frankfurt Ost
4.1 Untersuchungsdesign und Datenbasis
4.1.1 Betrachtungsebene Einzelspiel
4.1.2 Betrachtungsebene Saison
4.2 Beschreibende Darstellung der Zuschauernachfrage
4.3 Bestimmung, Operationalisierung und Wirkungserwartung von Einflussfaktoren
4.3.1 Sportbezogene Konsuminteressen
4.3.1.1 Unsicherheit
4.3.1.2 Sportliche Bedeutung des Einzelspiels
4.3.1.3 Teamqualitäten
4.3.1.4 Besondere Spannungs- und Unterhaltungsmomente
4.3.2 Nicht-sportbezogene Konsuminteressen
4.3.3 Ökonomische Rahmenbedingungen
4.3.4 Soziodemographische Rahmenbedingungen
4.4 Beschreibende Darstellung ausgewählter Einflussfaktoren
4.5 Modellschätzung
4.5.1 Betrachtungsebene Einzelspiel
4.5.2 Betrachtungsebene Saison
4.6 Zusammenfassung und Diskussion der empirischen Ergebnisse
4.6.1 Ergebnisse der Modellschätzung
4.6.2 Vergleich mit Einflussfaktoren im professionellen Fußball
5 Kritische Würdigung der empirischen Untersuchung
6 Mögliche Implikationen und Ansätze zur Angebotsoptimierung
6.1 Handlungsempfehlungen für die Ligaorganisation
6.2 Handlungsempfehlungen für Vereine
6.2.1 Produktpolitik
6.2.2 Preispolitik
6.2.3 Kommunikationspolitik
7 Zusammenfassung und Ausblick
8 Anhang
Anhang 1: Übersichtkarte der untersuchten Vereine auf Einzelspielebene
Anhang 2: Übersicht aller Variablen der empirischen Untersuchung
Anhang 3: Streudiagramme der unabhängigen Variablen mit der abhängigen Variablen
Anhang 4: Korrelationskoeffizienten der unabhängigen Variablen mit der abhängigen Variablen
Anhang 5: Ergebnisse der Modellschätzung mittels schrittweiser multipler Regressionsanalyse
Anhang 6: CD-ROM: Datenerfassung, Onlinequellen und Gesamtdokument
9 Literatur- und Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Einbettung der Gruppenliga Frankfurt Ost in die Spielklassen des HFV
Abb. 2: Determinanten der Stadionnachfrage nach Ligaspielen - Überblick und Beispiele
Abb. 3: Entwicklung des Zuschauerschnitts in der Gruppenliga Frankfurt Ost im Untersuchungszeitraum
Abb.4: Entwicklung der abhängigen Variable Z der Vereine im Untersuchungszeitraum
Abb. 5: Entwicklung der Einflussvariable SPANNE im Untersuchungszeitraum
Abb. 6: Anteil der Saisonspiele mit gegebenem Alternativangebot BLTV und BLSTAD
Abb. 7: Abschlussplatzierungen der Vereine im Untersuchungszeitraum
Abb. 8: Koeffizienten des Regressionsmodells auf Einzelspielebene
Abb. 9: Koeffizienten des Regressionsmodells auf saisonaler Ebene
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Klassifizierung von Zuschauermotiven im Sport
Tab. 2: Motivationstheoretische Ansätze des Zuschauens im Sport
Tab. 3: Einflussvariablen zur Unsicherheit
Tab. 4: Einflussvariablen zur sportlichen Bedeutung des Einzelspiels
Tab. 5: Einflussvariablen zu den Teamqualitäten
Tab. 6: Einflussvariablen zu den besonderen Spannungs- und Unterhaltungsmomenten
Tab. 7: Einflussvariablen zu den nicht-sportbezogenen Konsuminteressen
Tab. 8: Einflussvariablen zu den ökonomischen Rahmenbedingungen
Tab. 9: Einflussvariable zu den soziodemographischen Rahmenbedingungen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Am 24. April 2009 beschloss der DFB-Bundestag einen neuen Grundlagenvertrag zwischen dem DFB und der DFL(vgl. DFB 2009). Dieser sah eine Spielplanreform der Fußballbundesliga vor, um massive Einnahmeausfälle bei der Vermarktung der Medienrechte zu verhindern (ebd.). Als wesentlichste Veränderung wurde ein Bundesligaspiel an Sonntagen um 15:30 Uhr ab der Saison 2009/2010 eingeführt. Bis dahin wurde die traditionelle Anstoßzeit der zahlreichen Amateurvereine in Deutschland, sonntags um 15 Uhr, von Bundesligaspielen frei gehalten und erst ab 17:30 Uhr gespielt.
Dieser Beschluss löste seitens der Amateurvereine bundesweit Proteste aus. Vor allem von Vereinen im Ruhrgebiet, wo die Dichte von Bundesligaclubs sehr hoch ist, wurden Einbrüche der Zuschauerresonanz erwartet. Der Sprecher der dort gegründeten Protest-Initiative „Unser Sonntag“, Vorsitzender eines Vereins der Kreisliga A, unweit der Schalker Veltins-Arena, prognostizierte: „Wenn Schalke um 15:30 Uhr spielen wird, stünde ich alleine auf unserem Sportplatz“ (Dobbert 2009). Nach der Einführung des neuen Bundesligaspielplans bestätigte er Ende 2009 die Befürchtungen und resümierte leergefegte Plätze und Einbußen bis zu 50 Prozent (vgl. Drepper 2009). Aber auch andere Regionen zeigen sich betroffen. Der Vorsitzende eines sechs Kilometer von Stuttgart entfernten Vereins beklagt etwa 20 Prozent weniger Zuschauer, wenn der VfBStuttgart an einem Sonntag spielt (vgl. ebd.).
Die bereits zuvor dagewesenen Klagen über abnehmenden Zuschauerzuspruch im Amateurfußball fanden mit der Einführung des frühen Sonntagsspiels in der Bundesliga ihren jüngsten Höhepunkt. Dies ist Anlass und Motivation, sich zunächst einmal grundsätzlich mit den Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage in diesem Bereich zu beschäftigen. Somit soll die vorliegende Arbeit dazu beitragen, die Diskussion wissenschaftlich zu bereichern.
1.1 Problemstellung und Ziel
Bisherige Forschungsergebnisse von Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage beschränken sich nahezu ausschließlich auf den professionellen Teamsport. Bei Untersuchungen des Fußballs in Deutschland dient dabei wiederum fast ausnahmslos die Bundesliga als Betrachtungsgegenstand. Die Zuschauernachfrage im Amateurfußball ist im Prinzip bis heute wissenschaftlich nicht gewürdigt.[1]
Eine Übersicht ökonomischer Untersuchungsergebnisse von Bestimmungsfaktoren der Nachfrage nach sportlichen Wettkämpfen gibt Heinemann (1995, S. 178 ff.). Roy (2004) liefert eine noch umfassendere Zusammenfassung des Forschungsstands und untersucht seinerseits eine Vielzahl von Determinanten hinsichtlich ihres Erklärungsgehalts für Schwankungen der Zuschauernachfrage in der Fußballbundesliga von der Saison 1998/99 bis 2001/02. Dabei erweisen sich sowohl verschiedene externe Rahmenbedingungen, beispielsweise Wetterbedingungen, als auch einige auf den sportlichen Wettkampf bezogene Größen, z.B. Erfolge der Gastmannschaft, als signifikante Einflussfaktoren auf die Nachfrage nach Stadiontickets.
Inwiefern bestehende Forschungsergebnisse des professionellen Teamsports, v.a.der Fußballbundesliga, auf die Ligen des Amateurfußballs übertragbar sind, ist offen. Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass Motivdimensionen und Präferenzen der Besucher von Amateurfußballspielen denen der Besucher von Fußballbundesligaspielen entsprechen.
Ziel dieser Arbeit ist daher potentielle Einflussfaktoren zu entwickeln, welche zur Erforschung der Zuschauernachfrage herangezogen werden können und speziell dem Charakter niedriger Amateurfußballligen Rechnung tragen. Dies meint insbesondere die Spielklassen ab der bundesweit 7. Ligaebene (siehe Kap. 2). Auf Grundlage operationalisierter Einflussvariablen sollen im Rahmen einer explorativen Untersuchung mögliche Auslöser von Nachfrageschwankungen identifiziert werden. Angesichts des eingangs beschriebenen rückläufigen Zuschauerzuspruchs im Amateurfußball verstärkt sich die Notwendigkeit der Orientierung an den Zuschauern und deren Bedürfnissen. Daher sollen aus den Untersuchungsergebnissen bereits erste Handlungsempfehlungen für Vereine sowie die Ligaorganisationen im Amateurfußball abgeleitet werden.
1.2 Ökonomische Relevanz
Die wirtschaftliche Bedeutung der Fußballbundesligen auf makroökonomischer, sowie die der teilnehmenden Clubs auf mikroökonomischer Sicht gelten inzwischen als unumstritten. „Der Profifußball erzeugt jährlich eine Wertschöpfung von mehr als 5 Mrd.Euro“ (DFL 2010, S. 4). Die 36 Clubs der beiden Bundesligen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2008/2009 Umsatzerlöse von über 2 Mrd. Euro (vgl. ebd., S. 3). Die ökonomische Relevanz des Amateurfußballs scheint angesichts der niedrigeren Eintrittspreise und der vergleichsweise äußerst geringen Zuschauerzahlen hingegen fraglich. In der als Untersuchungsobjekt dieser Arbeit dienenden Gruppenliga Frankfurt Ost betrug der Eintrittspreis für Vollzahler in den letzten vier Spielzeiten 4,00 Euro, der ligaweite Zuschauerdurchschnitt bewegte sich zwischen 113 und 138 Besucher pro Spiel.
Im DFB sind jedoch insgesamt fast 26.000 Fußballvereine zusammengeschlossen, denen über 6,7 Mio.Menschen angehören (vgl. DFB 2011, S. 2). Davon ist die weit überwiegende Mehrheit im Amateurfußball anzusiedeln. Bei der Aufschlüsselung aller sportbezogenen Umsätze in der Stadt Frankfurt am Main im Jahr 1995 wurden beispielsweise etwa 15 Prozent den lokalen Sportvereinen zugeschrieben, was dem zweifachen Umsatz der erwerbswirtschaftlichen Sportunternehmungen entsprach (vgl. Trosien 2009, S. 89). Und dies obwohl in Frankfurt zahlreiche deutsche Spitzensportverbände, Landessportverbände und nicht zuletzt der Deutsche Olympische Sportbund beheimatet sind. In der Region Rhein-Neckar rechnen Trosien/Fronk (2003, S. 120) sogar über 20 Prozent des gesamten Sportumsatzes des Jahres 2000 den örtlichen Sportvereinen zu. Wenngleich es sich hierbei um sportartübergreifende Betrachtungen handelt, wird doch deutlich, dass der Amateurfußball in der Gesamtbetrachtung eine ökonomisch relevante Größe darstellt. Palm (2003, S. 37) unterstreicht, dass „der Breitensport dem Spitzensport finanziell weit voraus ist“ und Messing/Lames (1996, S. 26) gehen davon aus, dass an einem Wochenende wesentlich mehr Menschen ein Amateurfußballspiel als ein Bundesligaspiel besuchen. Freilich ist der indirekte Konsum durch Fernsehen und andere Medien dabei nicht berücksichtigt.
Aus mikroökonomischer Sicht produzieren die einzelnen Vereine, eingebettet in die Ligaorganisation des Verbandes, sportliche Wettkämpfe in Form von Fußballspielen, welche zum Zeitpunkt und am Ort des Entstehens an die Eintritt zahlenden Zuschauer abgesetzt werden. Die so generierten Einnahmen kommen der Erfüllung des Zwecks der gemeinnützigen Vereine zugute. Dieser ist nicht gewinnorientiert, sondern besteht in erster Linie darin, den Mitgliedern das Ausüben des Fußballsports zu ermöglichen. Sie dienen also der Finanzierung des Spielbetriebs und der Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit. Im Spielbetrieb entstehen beispielsweise Schiedsrichter- und Übungsleiterkosten sowie Fahrtkosten zu Auswärtsspielen. Bei einer Analyse der wirtschaftlichen Lage der Sportvereine in Deutschland machten Emrich et al.(1999, S. 45) Zuschauereinnahmen als viertwichtigste Einnahmequelle hinter Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen Zuschüssen aus. Zur identischen Rangfolge kommen auch Weber et al. (1995, S. 146). Bedenkt man, dass es sich um Betrachtungen von Vereinen aller Sportarten handelt, ist die Bedeutung der Zuschauereinnahmen im Fußball noch höher einzustufen, da Fußball zweifelsohne die populärste Sportart in Deutschland ist und daher die stärkste Zuschauernachfrage erfährt. Somit ist anzunehmen, dass die Zuschauereinnahmen eine der wichtigsten Finanzierungsquellen der meisten Vereine im Amateurfußball sind. Einnahmen aus Werbung und Sponsoring kann nur ein geringer Anteil der Fußballvereine generieren (vgl. Emrich/Pitsch 2003, S. 84). Über die direkten Zuschauereinnahmen hinaus gehen mit einer höheren Nachfrage auch Mehreinnahmen im gastronomischen Bereich einher und die Attraktivität für potentielle Spieler und Sponsoren wird gesteigert.
„Das Zuschauen beim Sport hat sich zu einem allgegenwärtigen Massenphänomen entwickelt“ (Beyer 2006, S. 2). Die Bundesliga erfährt in den letzten zehn Jahren, von kleinen Stagnationen abgesehen, einen wachsenden Zuschauerzuspruch (vgl. DFL 2011, S. 56). In der Saison 2010/11 haben mehr Zuschauer die Spiele in den Stadien verfolgt als je zuvor (vgl. Reister 2011). Im Amateurfußball ist jedoch eine eher gegenläufige Entwicklung festzustellen. Im Gegensatz zu den Bundesligaclubs sind die von ehrenamtlicher Tätigkeit getragenen Vereine vielfach durch eine fehlende wirtschaftliche Orientierung gekennzeichnet. Um stärker am wachsenden Fußballinteresse in der Bevölkerung partizipieren zu können, scheint eine am Nachfrager orientierte Ausrichtung des Spielbetriebs dringend notwendig. Dies unterstreicht die Relevanz wissenschaftlicher Analysen der Zuschauernachfrage im Bereich des Amateurfußballs.
1.3 Fragestellungen und Aufbau
Der empirische Teil dieser Arbeit besteht aus einer explorativen Untersuchung. „Derartige Studien sind dann sinnvoll, wenn Kenntnisse und Hypothesen zu einem Problem vorliegen, dem aber nur eine umfangreiche Studie gerecht würde; die umfangreiche Studie vorzubereiten ist Aufgabe einer explorativen Studie (wenngleich oft die Hauptuntersuchung im Anschluss gar nicht erfolgt)“ (Friedrichs 1990, S. 156).
So soll auch die vorliegende Untersuchung, trotz ihres explorativen Charakters, auf einer konkreten Fragestellung fußen:
Welche Faktoren haben, neben den grundlegenden Zuschauermotiven, einen Einfluss auf die Schwankungen der Zuschauernachfrage im Amateurfußball?
Ausgehend davon ergeben sich weitere Fragestellungen:
- Welche Bestimmungsgründe der Nachfrage nach Sportveranstaltungen können aus vorhandener Forschung identifiziert werden?
- Welche Einflussfaktoren könnten neben den identifizierten Gründen speziell für den Amateurfußball relevant sein?
- Inwiefern unterscheiden sich die Untersuchungsergebnisse zu den Erkenntnissen aus dem professionellen Fußball?
- Welche Maßnahmen können die Ligaorganisation sowie die Vereine ergreifen, um die Zuschauernachfrage positiv zu beeinflussen?
- Welche relevanten Faktoren sind zwar nicht beeinflussbar, sollten den Verantwortlichen aber als Ursache von Zuschauerschwankungen bekannt sein?
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird zunächst kurz die Ligaorganisation des Hessischen Fußballverbandes beschrieben, insbesondere die Einordnung der Gruppenliga Frankfurt Ost. Es folgt ein Überblick über den Stand soziologischer und psychologischer Forschung grundsätzlicher Motivgründe für den Besuch von Sportveranstaltungen, bevor bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse über Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage aus ökonomischer Sicht aufgezeigt werden.
Auf diesen baut der dann folgende empirische Teil dieser Arbeit auf, in welchem die Zuschauernachfrage in der Gruppenliga Frankfurt Ost anhand der vier Spielzeiten von 2007/08 bis 2010/11 analysiert wird. Nach einer Beschreibung und Darstellung der Datenbasis werden dazu zunächst potentielle Einflussfaktoren der Nachfrage bestimmt und operationalisiert. Mittels multipler Regressionsanalyse werden diese anschließend hinsichtlich ihres Erklärungsgehalts untersucht und die Befunde abschließend aufbereitet und mit bisherigen Erkenntnissen im professionellen Fußball verglichen.
Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem empirischen Vorgehen und den Ergebnissen, werden mögliche Handlungsempfehlungen zur praktischen Umsetzung durch Ligaorganisationen und Vereine im Amateurfußball formuliert. Zum Abschluss werden aus den Erkenntnissen der Untersuchung Thesen abgeleitet, die weitere Forschung im Bereich der Zuschauernachfrage im Amateurfußball vorantreiben sollen.
2 Einbettung der Gruppenliga Frankfurt Ost in die Ligaorganisation des Hessischen Fußball-Verbandes e.V.
Das Verbandswesen im deutschen Fußball ist monopolistisch strukturiert, wobei der Deutsche Fußball-Bund mit Sitz in Frankfurt am Main die höchste Instanz ist. Ziel dieser hierarchischen Strukturierung ist es, das Entstehen konkurrierender Ligawettbewerbe zu verhindern. Die Prinzipien der Satzungsunterwerfung und der Einfachmitgliedschaft sind Säulen dieser Organisationsform (vgl. van Bentem 2004, S. 12). Dies bedeutet, dass eine organisatorische Einheit immer nur Mitglied der nächsthöheren Einheit sein kann und sich deren Satzungen und Ordnungen zu unterwerfen hat. Eine Ausnahme bilden die 21 Landesverbände, welche gleichzeitig Mitglied in einem der fünf Regionalverbände und des DFB sind (vgl. ebd., S. 12 f.).
Als einer dieser Landesverbände ist der Hessische Fußball-Verband (HFV) demnach Mitglied des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) und des DFB. Dabei erledigt der ebenfalls in Frankfurt am Main beheimatete HFV seine Angelegenheiten selbstständig, jedoch in Einklang mit den Satzungen und Ordnungen des SFVund DFB (vgl. HFV 2011a, S. 9). Mitglieder des HFV sind wiederum alle gemeinnützigen Amateurfußballvereine in Hessen.[2] Sie unterliegen den Satzungen und Ordnungen des HFV und nach oben hin denen des SFV und des DFB (vgl. ebd., S. 10). „DFB-Recht kann daher als oberstes Recht angesehen werden“ (van Bentem 2004, S. 13). Gemäß seiner Satzung besteht die zentrale Aufgabe des HFV darin, Ligawettbewerbe und deren Meisterschaftsspiele in Hessen zu organisieren und durchzuführen (vgl. HFV 2011a, S. 7). Zusammen mit den Mitgliedsvereinen produziert er also vielfach die „Produkte Meisterschaft“. Dabei deckt der Zuständigkeitsbereich (siehe Abb. 1) den gesamten Amateurfußball in Hessen ab (vgl. HFV 2011b, S. 54). Dieser beginnt mit der Hessenliga, welche sich bei bundesweiter Betrachtung auf der 5. Ligaebene befindet, und endend mit den Kreisligen auf Ligaebene 9 und tiefer. Die Gruppenligen befinden sich auf der 7. Ligaebene, unter den Verbands- und über den Kreisoberligen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Einbettung der Gruppenliga Frankfurt Ost in die Spielklassen des HFV
Quelle: eigene Darstellung
Das Verbandsgebiet des HFV entspricht dem Bundesland Hessen und ist in 32 Fußballkreise eingeteilt, welche sich über sechs Regionen erstrecken. Über Grenzänderungen der Kreise kann der Verbandsvorstand entscheiden (vgl. HFV 2011a, S. 8 f.). Eine solche Änderung betrifft auch die vorliegende Untersuchung, denn mit dem FC Bayern Alzenau II ist ein bayrischer Verein Mitglied der Gruppenliga Frankfurt Ost. Die Kreise treten als eigenständige Organisationen mit handelnden Organen auf, sind aufgrund ihrer fehlenden Autonomie jedoch als Verwaltungseinheiten des HFV zu betrachten (vgl. van Bentem 2004, S. 17 f.). Die Gruppenliga Frankfurt Ost befindet sich in der Region Frankfurt und setzt sich aus Mannschaften der Kreise Büdingen, Gelnhausen, Hanau und Offenbach zusammen. Zuständig für die Durchführung der Fußballspiele dieser Liga ist der Verbandsspielausschuss des HFV (vgl. HFV 2011b, S. 53). Dieses Organ auf Verbandsebene beauftragt für die direkte Abwicklung des Spielbetriebs der Meisterschaft einen Klassenleiter (vgl. ebd., S. 54 f.). Vor Saisonbeginn stimmt dieser im Rahmen einer Sitzung den Spielplan mit Vertretern aller Vereine ab und arbeitet Änderungswünsche direkt ein. Während der Saison ist er u.a. für die Neuansetzung ausgefallener und abgebrochener Spiele sowie für die Spielansetzung der Auf- und Abstiegsrelegation zuständig.
3 Gründe der Nachfrage nach Sportveranstaltungen
Als Basis für den nachfolgenden empirischen Teil dieser Arbeit soll zunächst der aktuelle Stand der Zuschauerforschung dargelegt werden. Publikationen in diesem Bereich unterscheiden sich weitestgehend in zwei Kategorien. Soziologisch und psychologisch orientierte Untersuchungen beschäftigen sich mit den Motivgründen, welche Menschen grundsätzlich dazu bewegen, als Zuschauer an sportlichen Wettkämpfen und Sportveranstaltungen teilzunehmen. Daneben gibt es sportökonomische Forschungsansätze, welche Erklärungen für das Ausmaß der Zuschauernachfrage und deren Schwankungen liefern, indem sie entsprechende Einflussgrößen ermitteln und analysieren. Im Folgenden werden Ergebnisse beider Forschungsperspektiven näher erläutert. Grundlage für die nachfolgende Untersuchung bilden dann die ökonomisch orientierten Ansätze, welche sich eignen, die einleitend formulierten Forschungsfragen zu beantworten.
3.1 Motive des Zuschauers aus soziologischer und psychologischer Perspektive
Eine erste umfassende Untersuchung der Motive für den Besuch von Sportveranstaltungen in Deutschland führte Opaschowski (1987) mittels einer Befragung an 2.000 Personen durch. Demnach lassen sich die Gründe der Zuschauer auf vier Bedürfnisse reduzieren: Spaß haben, Spannung erleben, Geselligkeit finden und begeistert werden (vgl. ebd., S. 29). Stollenwerk (1996, S. 19) merkt zu dieser Studie kritisch an, dass eine normale Repräsentativstichprobe durchgeführt und nicht Sportzuschauer vor Ort befragt wurden. Strauß (1994, S. 24 f.) kritisiert zudem die Zuordnung hoch akzeptierter Items auf die Bedürfnisse der Zuschauer, worauf später in diesem Abschnitt noch näher eingegangen wird.
Gabler (1998, S. 121 ff.) nähert sich der Frage nach den Beweggründen von Personen Sportveranstaltungen aufzusuchen zunächst mittels eines phänomenologischen Zugriffs, welcher auf naheliegenden Annahmen basiert. Ein mögliches Motiv eines Fußballzuschauers wird beispielsweise damit beschrieben, dass der Anhänger einer Fußballmannschaft, die gegen den benachbarten Sportverein ein Meisterschaftsspiel austrägt, seine Mannschaft aktiv unterstützen möchte, damit er sich mit dem Erfolg identifizieren kann (vgl. ebd., S. 121). Durch diese Herangehensweise kommt er zu nachstehender Klassifizierung, welche in drei Motivdimensionen gegliedert ist und zudem unterscheidet, ob die Motive in erster Linie auf die eigene Person oder auf andere Personen bezogen sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Klassifizierung von Zuschauermotiven im Sport
Quelle: Gabler 1998, S. 122
In einem nächsten Schritt werden als Erklärungsmodelle des rezeptiven Sportkonsums motivationstheoretische Ansätze herangezogen, die aus empirischen Studien gewonnen wurden (vgl. ebd., S. 124 ff.; Pfaff 2003, S. 78 ff.). Wie in Tab.2 dargestellt, lassen sich diese Ansätze ebenfalls in das Klassifikationsschema von Gabler (1998) einordnen und bestätigen damit die phänomenologisch gewonnen Motive in ihrer Richtigkeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Motivationstheoretische Ansätze des Zuschauens im Sport
Quelle: Gabler 1998, S. 125
Das Stress and Stimulation Seeking-Motiv besagt, dass Langeweile im Alltag zu einem Bedürfnis nach Spannung und Risiko führt, welches durch Zuschauen bei sportlichen Wettkämpfen befriedigt werden kann (vgl. ebd., S. 125). Das ähnlich gelagerte Sensation Seeking-Motiv beschreibt das ausgeprägte „Bedürfnis nach Spannung, „action“, vielfältigen Erlebnissen und Abenteuern“ (ebd.). Daher wird es auch gerne zur Erforschung des Verhaltens von - insbesondere gewalttätigen - Fußballfans herangezogen (vgl. ebd., S. 130 ff.). Der Unterhaltungswert für Zuschauer liegt gemäß dem Entertainment-Motiv in der Ästhetik der sportspezifischen Bewegungsformen sowie der Fairnessidee sportlicher Wettkämpfe (vgl. ebd., S. 125). Ob die alleinige Betrachtung dieser beiden Unterhaltungsmotive in Anbetracht der zunehmenden Eventisierung von Sportveranstaltungen noch zeitgemäß ist, darf jedoch bezweifelt werden.
Das Streben nach Identität, Zufriedenheit mit dem Selbstbild und sozialer Anerkennung, liegt dem Achievement Seeking-Motiv zugrunde (vgl. Pfaff 2003, S. 79). Die daraus entstehende Identifikation mit Mannschaften und Sportlern wird „basking in reflected glory“ (BIRG) genannt (vgl. Strauß et al. 2006, S. 382). Kann dieses Streben im Alltag nicht befriedigt werden und wird stattdessen durch das Beobachten erfolgreicher Sportler oder Mannschaften kompensiert, ist vom Hero Identification-Motiv die Rede (vgl. Gabler 1998, S. 125).
Das Recreation-Motiv zielt auf die Erholung und Entspannung, welche Besucher von Sportveranstaltungen erfahren (vgl. ebd., S. 126). Die damit einhergehende Flucht aus dem Alltag und die Ablenkung von der Arbeitswelt werden mit dem Diversion-Motiv beschrieben (vgl. Stollenwerk 1996, S. 19). Gemäß dem Katharsis-Motiv dient der Besuch von Sportveranstaltungen als Ventil für angestaute Aggressionen (vgl. Pfaff 2003, S. 79). Dieser Ansatz ist jedoch umstritten, da bei empirischen Untersuchungen eher ein Anstieg des Aggressionsniveaus während und nach dem Besuch von Sportveranstaltungen festgestellt wurde (vgl. Gabler 1998, S. 126).
Das Bedürfnis der Zuschauer nach Kontakt und Zugehörigkeit zu einer Gruppe schlägt sich im Affiliation-Motiv nieder. Dessen Bedeutung wächst durch die Abnahme sozialer Kontakte und einen Gemeinschaftsverlust in der modernen Gesellschaft (vgl. Pfaff, S. 80). Auch dem Aggressions-Motiv liegt das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung einer Gruppe zugrunde. Bei der Untersuchung jugendlicher Fußballfans wurde ermittelt, dass diese aufgrund aggressiver Auseinandersetzungen eine Bestätigung eigener Wirksamkeit, körperliche Kompetenz und Macht erfahren (vgl. Gabler 1998, S. 126).
Eine weitere Kategorisierung liefert Messing (1996), der vier Orientierungen der Zuschauer von Sportveranstaltungen erfasst:
- Bei der Sachorientierung steht das Interesse am Handlungsablauf gegenüber der Frage nach Sieg oder Niederlage im Vordergrund. Sie bringt das Bedürfnis der Zuschauer zum Ausdruck einen guten und niveauvollen Wettkampf zu sehen.
- Die Ergebnisorientierung ist mit dem Streben nach Macht und Anerkennung verbunden. „Sieg oder Niederlage des Aktiven spiegeln sich im Erleben des Zuschauers als Macht oder Ohnmacht“ (ebd., S. 17).
- Die Erlebnisorientierung beschreibt den Wunsch nach einer Atmosphäre voll Spannung, Stimmung und Begeisterung. Zudem sind das Genießen von Zerstreuung, Abwechslung bzw.Entspannung Ziele der Zuschauer.
- Die soziale Orientierung bezieht sich auf zwischenmenschliche Kontakte im Rahmen des Besuchs von Sportveranstaltungen.
Im Wesentlichen stimmen diese Orientierungen mit der Klassifizierung und den motivationstheoretischen Ansätzen nach Gabler (1998) überein. Die drei erstgenannten Orientierungen entsprechen in ihrer Reihenfolge den Motivdimensionen der Tab. 1 und 2, wohingegen die soziale Orientierung dem Bezug auf andere Personen („im sozialen Kontext“) entspricht.
Auf Basis der vier Orientierungen nach Messing (1996) hat Strauß (1996, S. 190 ff.) empirisch versucht, verschiedene Zuschauertypen zu identifizieren. Dazu wurden Zuschauer eines Spiels der Basketballbundesliga anhand von acht Items nach den Gründen ihres Besuchs befragt. Im Ergebnis wurde ermittelt, dass es eine übergeordnete Motivdimension zu geben scheint, die Strauß (vgl. ebd., S. 202) als „Attraktivität des Sportereignisses“ bezeichnet. Diese Attraktivität ergibt sich für die Zuschauer wiederum aus individuell höchst unterschiedlichen Kombinationen von Gründen. Demzufolge konnten auch keine Zuschauertypen ermittelt werden, welche sich aufgrund qualitativer Merkmale gegenüber anderen Personengruppen klar differenzieren (vgl. ebd., S. 202 f.). Dies „weist auf das Problem der mangelnden theoretischen Begründung von empirischen Untersuchungen hin, bei denen Items phänomenologisch gewonnen und dann Motiven zugeordnet werden“ (Gabler 1998, S. 124). Daraus schlussfolgernd ist die Unabhängigkeit klassifizierter Motivdimensionen oder -orientierungen äußerst fraglich, vielmehr kann in beträchtlichem Maße von Überlappungen ausgegangen werden.
Die Identifikation mit Sportlern und Sportmannschaften wird im überwiegenden Teil der Publikationen zur Zuschauerforschung als eine wichtige Determinante für den Besuch von Sportveranstaltungen aufgegriffen. Bereits eine Untersuchung von Herrmann (1977, S. 65) an Fußballfans des 1. FC Nürnberg ergab, dass die Identifikation der Fans mit der Mannschaft an vorderster Stelle der Erwartungshaltungen steht. Für Strauß (2000) ist die Identifikation eines von vier Motiven von Menschen, als Zuschauer Massenveranstaltungen zu besuchen. Personen mit einer starken Identifikation zu „ihrer“ Mannschaft sind häufiger als andere in den Stadien anzutreffen (vgl. Strauß et al. 2006, S. 381). Auch in der Klassifikation von Gabler (1998) und den erläuterten motivationstheoretischen Ansätzen findet sich das Motiv der Identifikation wieder. Neben seinen vier Orientierungen der Zuschauer stellt auch Messing (1996) die herausragende Bedeutung der Identifikation heraus: „Gäbe es nicht die Bindung von Zuschauern an Sportmannschaften und –stars, gingen die Einschaltquoten bei Sportsendungen im Fernsehen zurück und die sportliche Leistung würde von Werbung und Politik kaum noch nachgefragt“ (ebd., S. 18). Dies lässt sich wohl auch auf die direkte Zuschauernachfrage vor Ort übertragen.
Beyer (2006, S. 97) stimmt mit der Definition der Identifikation als Motiv zur Erklärung der Sportrezeption hingegen nicht überein. Er sieht in der Identifikation vielmehr einen Ausdruck der sozialen Identität eines Sportzuschauers. Die Verankerung der Identifikationsbeziehung im Selbstkonzept des Sportfans führt dabei zur Ausführung von Handlungen, die auf das Identifikationsobjekt gerichtet sind.[3] Bei der Untersuchung von Zuschauern des damaligen Fußballbundesligisten FC Hansa Rostock anhand von Stichprobenbefragungen ermittelt Beyer (vgl. ebd., S. 150) für die Variable Identifikation einen hohen Erklärungsbeitrag für den Stadionbesuch.
Analysen zweier Amateurfußballspiele in Baden und dem französischen Elsass ergaben, dass von den Zuschauern nahezu 20 Prozent Verwandte, etwa ein Drittel Freunde und fast die Hälfte persönliche Bekannte unter den Spielern haben (vgl. Schantz 1996, S. 77). Persönliche Beziehungen zwischen Zuschauern und Spielern scheinen als Besuchsmotiv speziell im Amateurfußball also ebenfalls eine bedeutende Rolle zu spielen. Dem könnte ein dem Identifikationsmotiv ähnelndes Phänomen zugrunde liegen, was jedoch aufgrund nur spärlich vorliegender Zuschauerforschung im Amateurfußball eine Vermutung bleiben muss.
„Letztendlich zeigt sich, dass die langfristigen Ursachen der Entscheidung für oder gegen rezeptiven Sportkonsum vor allem auf die nicht direkt beobachtbaren emotionalen und kognitiven Prozesse und Zustände im Innern des Zuschauers zurückzuführen sind“ (Beyer 2006, S. IX). Demgegenüber stehen die unmittelbar beobachtbaren und messbaren ökonomischen Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage.
3.2 Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage aus ökonomischer Perspektive
Während es im vorangegangen Abschnitt um die grundsätzlichen Motive von Menschen ging, eine Sportveranstaltung zu besuchen, wird nun der aktuelle Forschungsstand im Bereich ökonomisch orientierter Einflussfaktoren als Erklärung von Variationen der Zuschauernachfrage erläutert.
Um sich mit der Nachfrage nach sportlichen Wettkämpfen, insbesondere Fußballspielen innerhalb eines Ligawettbewerbs, auseinanderzusetzen, soll zunächst kurz auf die Besonderheit dieses Produkts eingegangen werden, welches sich deutlich von herkömmlichen Gütern und Dienstleistungen unterscheidet. Zunächst ist festzustellen, dass eine Attraktivität des Wettkampfsports in der Unsicherheit des Ausgangs und der damit einhergehenden Spannung besteht (vgl. Heinemann 1995, S. 178). In der geringen Vorhersehbarkeit der Ergebnisse liegt der Wert und Reiz sportlicher Wettkämpfe. Schädlich auf dieses Qualitätsmerkmal wirken sich sportliche Monopolstellungen aus. Sind Sieger und Verlierer immer wieder dieselben, wird ein Ligawettbewerb für den Zuschauer unattraktiv. Eine ausgeglichene Konkurrenz mit häufigen Wechseln im Tabellenstand hingegen ist für das Geschäft überaus förderlich (vgl. ebd., S. 178 f.). Ein letztes Merkmal besteht wie auch für andere Dienstleistungen in der Flüchtigkeit des Produkts. Der sportliche Wettkampf vor Ort kann nur zum Zeitpunkt der Produktion verkauft werden (Uno-actu-Prinzip), Herstellung und Absatz sind also nicht voneinander getrennt (vgl. ebd., S. 179).
Aus diesen beschriebenen Besonderheiten lassen sich Einflussfaktoren der Nachfrage nach sportlichen Wettkämpfen ableiten. Dazu existieren zahlreiche Publikationen, vornehmlich aus dem Bereich Fußball. Eine umfassende Übersicht von Untersuchungen des professionellen Teamsports liefert Roy (2004, S. 54 ff.). Die Ergebnisse vorhandener Studien sind jedoch oft widersprüchlich und liefern kein eindeutiges Bild über Determinanten der Zuschauernachfrage (vgl. ebd., S. 49; Heinemann 1995, S. 179).
Die verschiedenen Variablen, die die Nachfrage nach sportlichen Wettkämpfen bestimmen können, fasst Heinemann (1995, S. 178 ff.) in fünf Bereiche zusammen. Er beschreibt Unsicherheitsfaktoren, Qualitätsfaktoren, ökonomische Einflussfaktoren, sozio-demographische Faktoren und Residualfaktoren.
Mit Blick auf die angesprochene Schädlichkeit von Monopolstellungen für sportliche Wettkämpfe ist zu vermuten, dass die Zuschauernachfrage nicht unwesentlich durch die Ungewissheit des Ausgangs eines Spiels bzw. einer Meisterschaft beeinflusst wird. „Die Unsicherheit, die mit einer Liga bzw.einem Ligaspiel generell verbunden ist, kann zweifellos als die am umfassendsten untersuchte Determinante der Nachfrage bezeichnet werden“ (Roy 2004, S. 58). Dabei hat sich weitestgehend die Unterscheidung in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Unsicherheit durchgesetzt (vgl. Heinemann 1995, S. 184; Frick 1997, S. 7; Roy 2004, S. 58). Die kurzfristige Unsicherheit bezieht sich auf die Offenheit des Ausgangs eines einzelnen Spiels. Mittelfristige Unsicherheit beschreibt den saisonalen Kampf um Positionen innerhalb einer Liga-Meisterschaft. Langfristige Unsicherheit hingegen wird für die Dominanz einzelner Clubs einer Liga über mehrere Jahre postuliert.
Als Indikatoren der kurzfristigen Unsicherheit haben sich die Differenzen beider Mannschaften in Form von Punkten oder Tabellenpositionen sowie die Betrachtung von Wettquoten durchgesetzt, wobei die empirischen Erkenntnisse dazu uneinheitlich sind (vgl. Roy 2004, S. 59). Frick (1997, S. 13 ff.) untersucht die mittelfristige Unsicherheit der bis dato 34 Spielzeiten der Fußballbundesliga anhand verschiedener Spannungsmaße für die Ausgeglichenheit der Liga und stellt fest, dass die saisonale Zuschauernachfrage geringer ist je größer die Unterschiede der Leistungsfähigkeit einzelner Clubs sind. Neuere Studien ermitteln jedoch keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem sportlichen Gleichgewicht und der Nachfragehöhe und stellen die hohe Relevanz der Unsicherheit vermehrt in Frage (vgl. Roy 2004, S. 60). Der langfristigen Unsicherheit liegt dagegen die Befürchtung zugrunde, dass ein erfolgreicher Club durch die damit verbundenen erhöhten Einnahmen in der Folge noch erfolgreicher wird und schließlich eine langfristige Dominanz entwickelt. Ein daraus resultierender Rückgang der Gesamtnachfrage nach einem Ligawettbewerb konnte bislang allerdings nicht bewiesen werden (vgl. ebd.).
Qualitätsfaktoren im Sinne von Heinemann (1995, S. 179 ff.) beziehen sich auf die spielerische Qualität der Mannschaften. Diese wird vor allem durch die Tabellenposition in einer Liga operationalisiert, wobei Zuschauer aufgrund des Tabellenstands beider Mannschaften auf die erwartete Qualität des Spiels zu schließen scheinen (vgl. Roy 2004, S. 63). Einige Studien machen die Qualität der Mannschaften auch am Mitwirken von Starspielern fest. „Ein Ergebnis dabei ist, dass vor allem attraktive Spieler der Gastmannschaft Zuschauer anziehen“ (Heinemann 1995, S. 181). Zudem wurde ein positiver Einfluss auf die Zuschauernachfrage auch aufgrund zurückliegender Erfolge, z.B.operationalisiert durch die Platzierung vergangener Spielzeiten, ermittelt (vgl. Roy 2004, S. 64). Gärtner/Pommerehne (1984, S. 153 ff.) untersuchen zudem gewonnene Spiele in Serie, in der bisherigen Saison durchschnittlich erzielte Tore pro Spiel sowie Erfolge in europäischen und nationalen Pokalwettbewerben als Indikatoren der Mannschaftsqualität. Einflüsse auf die Zuschauernachfrage ermitteln sie jedoch nicht (vgl. ebd., S. 159 ff.).
Daneben gibt es weitere Faktoren, die sich nicht direkt auf das spielerische Vermögen der Mannschaften beziehen, jedoch ebenfalls die Qualität eines Spiels für die Nachfrager determinieren können. So ist anzunehmen, dass Spiele im Meisterschafts-, und Abstiegskampf oder Lokalderbys die Relevanz eines Spiels erhöhen. Der positive Einfluss auf die Zuschauernachfrage wurde vielfach empirisch bestätigt (vgl. Roy 2004, S. 60 ff.). Die Chance auf einen Sieg der Heimmannschaft scheint die Qualität eines Spiels ebenfalls positiv zu beeinflussen. Eine verstärkte Nachfrage wurde ermittelt, je höher die Wahrscheinlichkeit eines Heimsieges anhand der Wettquote ist (vgl. ebd., S. 66). Einen negativen Einfluss auf die Zuschauernachfrage hat hingegen die fortschreitende Dauer einer Saison, wofür einsetzende Sättigungserscheinungen verantwortlich gemacht werden (vgl. ebd.).
In der Literatur untersuchte ökonomische Einflussfaktoren sind der Eintrittspreis, das Pro-Kopf-Einkommen in der Bevölkerung des Einzugsgebiets, zeitgleich angebotene alternative Unterhaltungsprogramme sowie Effekte von Fernsehübertragungen. Dabei erweist sich vor allem der Eintrittspreis als erklärende Determinante. Wie zu erwarten ist, wurden für den Eintrittspreis negative Preiselastizitäten der Nachfrage ermittelt, welche jedoch verhältnismäßig gering ausfallen und auf eine eher unelastische Nachfrage hinweisen (vgl. Heinemann 1995, S. 180; Roy 2004, S. 71). Der ermittelte negative Einfluss von Alternativangeboten dürfte ebenso wenig überraschen (vgl. ebd., S. 74 f.). Für den Einfluss des Einkommens und der Fernsehübertragungen auf die Zuschauernachfrage vor Ort sind die Ergebnisse hingegen widersprüchlich (vgl. ebd., S. 73 ff.; Heinemann 1995, S. 180).
Im Bereich der sozio-demographischen Faktoren wurde hauptsächlich die Größe der Bevölkerung untersucht, für die ein positiver Einfluss auf die Zuschauerzahl bestätigt wird (vgl. Heinemann 1995, S. 180). Zum Teil finden auch mitreisende Zuschauer der Gastmannschaft Berücksichtigung in Untersuchungen (vgl. Roy 2004, S. 79). Dem in amerikanischen Studien ermittelten negativen Zusammenhang zwischen der Zuschauernachfrage und dem Anteil ethnischer Minderheiten in der Bevölkerung wird in europäischen Studien keine Bedeutung beigemessen (vgl. ebd., S. 79 f.).
Sonstige Einflussfaktoren sind als Residual-Faktoren zusammengefasst. Heinemann (1995, S. 181) nennt die Zeit der Veranstaltung, den Zustand des Stadions sowie Wettereinflüsse. Wie zu vermuten ist, bestätigen mehrere Studien den negativen Einfluss schlechten Wetters auf die Zuschauernachfrage (vgl. ebd.; Roy 2004, S. 68 f.). Dass Wochenenden und Feiertage gegenüber Wochentagen für die Nachfrager geeignetere Tage sind, kann ebenfalls nicht überraschen (vgl. Roy 2004, S. 69). Auch konnten einige Studien belegen, dass weniger Zuschauer angezogen werden, je älter ein Stadion ist (vgl. ebd., S. 68). Ein limitierender Faktor des Konsums kann zudem die begrenzte Stadionkapazität sein.
Roy (2004), der Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage in der Fußballbundesliga untersucht, kommt gegenüber Heinemann (1995, S. 178 ff.) zu einer leicht modifizierten Klassifizierung der Determinantengruppen (siehe Abb. 2).
Dabei sind die Unsicherheitsfaktoren sowie die Qualitätsfaktoren den Sportbezogenen Konsuminteressen zugeordnet. Die Gruppe der Nicht-Sportbezogenen Konsuminteressen beinhaltet die beschriebenen Residual-Faktoren. Ein von Heinemann (1995, S. 178 ff.) nicht berücksichtigter Bereich, sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Als solche nennt Roy (2004, S. 80 f.) die Popularität und den Stellenwert einer Sportart, weist jedoch gleichzeitig auf die Schwierigkeit einer geeigneten Operationalisierung hin.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Determinanten der Stadionnachfrage nach Ligaspielen - Überblick und Beispiele
Quelle: Roy 2004, S. 57
Die dargestellte Klassifizierung von Roy (2004) dient im nachfolgenden empirischen Teil als Grundlage zur Bestimmung potentieller Einflussfaktoren auf die Zuschauernachfrage im Amateurfußball (Kap.4.3).
4 Empirische Untersuchung: Ökonomisches Modell der Einflussfaktoren auf die Zuschauernachfrage in der Gruppenliga Frankfurt Ost
Im diesem Teil der Arbeit erfolgt die Herausarbeitung eines Modells der Einflussfaktoren auf die Zuschauernachfrage im Amateurfußball, beispielhaft durchgeführt anhand der Gruppenliga Frankfurt Ost. Diesem Prozess liegt das im vorangegangenen Kapitel beschriebene Nachfragemodell von Roy (2004, S. 56 ff.) zugrunde. Um der Charakteristik des Amateurfußballs gerecht zu werden, erfolgt eine entsprechende Spezifikation möglicher Einflussvariablen.
Im Folgenden werden zunächst das methodische Vorgehen sowie die Datenbasis der Untersuchung beschrieben. Deren deskriptiver Darstellung widmet sich das anschließende Kap. 4.2. Die Bestimmung und Operationalisierung der potentiellen Einflussvariablen auf die Zuschauernachfrage folgt in Kap. 4.3 und wird in Kap. 4.4 in Auszügen ebenfalls deskriptiv erörtert. Die quantitative Datenanalyse erfolgt schließlich durch eine multiple Regressionsanalyse. Die Entwicklung eines Modells der Zuschauernachfrage für den Amateurfußball durch dieses Verfahren wird in Kap. 4.5 beschrieben, bevor die empirischen Befunde in Kap. 4.6 abschließend ausführlich zusammengefasst und mit Erkenntnissen aus dem professionellen Fußball verglichen werden.
4.1 Untersuchungsdesign und Datenbasis
Die vorliegende Untersuchung ist eine explorative Studie. Dies liegt zum einen darin begründet, dass die Zuschauernachfrage im Amateurfußball bislang nicht Inhalt ökonomischer Forschung war und somit ein relativ unbekanntes Gebiet darstellt. Zum anderen handelt es sich bei der Untersuchung nur einer der mehreren hundert Amateurfußballligen in Deutschland[4] um eine zu geringe Stichprobe zum Verifizieren von Hypothesen. Dennoch sollen Antworten auf die einleitend formulierten Forschungsfragen gefunden werden, wenngleich diese kaum abschließend sein dürften. Das explorative Vorgehen ermöglicht somit die Weiterentwicklung von Hypothesen und letztlich das Herausarbeiten von präzisierten Fragestellungen für weitere Forschungsvorhaben.
Als Grundlage für die Analyse der Zuschauernachfrage in der Gruppenliga Frankfurt Ost dient eine umfassende Sekundäranalyse. Es wird also auf bereits vorhandene Datenbestände zurückgegriffen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in der Einsparung von Zeit und finanziellen Mitteln, da der Datenerhebungsprozess entfällt (vgl. Schnell et al. 2008, S. 251). Eine eigene Datenerhebung konnte aufgrund der begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen im Rahmen dieser Arbeit nicht in Frage kommen. Ein weiteres Argument für die Durchführung einer Sekundäranalyse ist in der Möglichkeit zu sehen, Paneldaten untersuchen zu können. Bei diesem Forschungsdesign werden dieselben Variablen zu verschiedenen Zeitpunkten an denselben Objekten in die Untersuchung aufgenommen (vgl. ebd., S. 238). Es werden also Quer- und Längsschnittdaten gepoolt, was es ermöglicht, die zu untersuchenden Schwankungen der Zuschauernachfrage sowohl im Zeitverlauf als auch für mehrere Vereine gemeinsam nachvollziehen zu können.
Zur Untersuchung der so gewonnen quantitativen Daten kommt die Methode der multiplen Regressionsanalyse zum Einsatz. Sie ist ideal geeignet, um aus einer Vielzahl möglicher Einflussfaktoren diejenigen zu ermitteln, welche einen statistischen Zusammenhang mit der Zuschauernachfrage aufweisen (vgl. Fromm, S. 345).
Alternativ wäre eine qualitative Datenerhebung in Form einer Befragung der Zuschauer vor Ort denkbar gewesen. Diese Methode zielt jedoch eher auf die Ermittlung der in Kap. 3.1 beschriebenen soziologischen und psychologischen Motivgründe der Nachfrager und weniger auf die Bestimmung von ökonomisch orientierten Einflussfaktoren der Zuschauernachfrage, welche gemäß der zugrundeliegenden Fragestellung zu ermitteln sind. Daher ist die ökonometrische Analyse von Sekundärdaten einer Zuschauerbefragung vorzuziehen. Eine Befragung ist ergänzend dennoch vorstellbar, würde jedoch den Umfang dieser Arbeit bei weitem überschritten.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist die lückenlose Dokumentation der Zuschauerzahlen mindestens einer Amateurspielklasse in Deutschland über mehrere Spielzeiten notwendig. Um auch speziell die Auswirkungen des neu eingeführten Sonntagsspiels der Fußballbundesliga um 15:30 Uhr zu berücksichtigen, sollte eine Spielklasse in geographischer Nähe mindestens eines Bundesligaclubs Untersuchungsgegenstand sein. Die Beschaffung dieser Daten für Ligen im unteren Amateurbereich gestaltete sich als äußerst schwierig. Anfragen bei verschiedenen Landesverbänden, Vereinen und dem Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken e.V. verliefen erfolglos, da kein geeignetes Datenmaterial vorhanden war.
Über die Sportredaktion einer Lokalzeitung konnten letztlich verwertbare Datenbestände für die Gruppenliga Frankfurt Ost gewonnen werden. Bei diesen, bisher nicht wissenschaftlich genutzten, Daten handelt es sich um die Anzahl der Zuschauer bei jedem Spiel dieser Liga von der Saison 2007/08 bis zur Saison 2010/11.[5] Die Zahlen beruhen auf direkten Angaben der jeweiligen spielaustragenden Heimvereine. In Bezug auf diese Datenbasis kann man zwei kritische Vermutungen anbringen. Erstens könnten Vereine bewusst weniger Zuschauer angeben haben als tatsächlich anwesend waren, weil sie befürchten, die steuerbefreite Umsatzgrenze ihres Zweckbetriebs zu erreichen. Zweitens könnten sie die Zahlen nach oben geschönt haben, um sich attraktiver darzustellen. Jedoch ist festzuhalten, dass in diesem Bereich des Amateurfußballs letztlich keine zuverlässigeren Informationsquellen denkbar sind, als die Vereine selbst.
Aufgrund der einleitend beschriebenen besonderen Betroffenheit der Amateurvereine im Ruhrgebiet durch das frühe Sonntagsspiel der Bundesliga, wäre die Analyse gerne in dieser Region durchgeführt worden, was aber an fehlenden Datenbeständen scheiterte. Durch die Nähe zur Stadt Frankfurt am Main stellt die Gruppenliga Frankfurt Ost jedoch ebenfalls ein interessantes Untersuchungsobjekt dar. Denn Eintracht Frankfurt war während des Untersuchungszeitraums ununterbrochen Teilnehmer der Fußballbundesliga.
4.1.1 Betrachtungsebene Einzelspiel
Die Untersuchung auf dem Niveau von Einzelspielen steht im Rahmen dieser Studie im Fokus. Dieses Vorgehen ermöglicht es, Schwankungen der Zuschauernachfrage detailliert zu untersuchen und eine Vielzahl von potentiellen Einflussvariablen in das Untersuchungsmodell einfließen zu lassen.
Dabei berücksichtigt die Analyse alle Heimspiele der Vereine, die von der Saison 2007/08 bis 2010/11 durchgängig in der Gruppenliga Frankfurt Ost gespielt haben. Vereine, die im Untersuchungszeitraum aus der Spielklasse auf- oder abgestiegen sind, werden nicht einbezogen, weil davon auszugehen ist, dass die Auswirkungen eines Auf- bzw. Abstiegs die Effekte der untersuchten Einflussfaktoren überlagern würden. Aufgrund dieser Vorüberlegung werden in der Betrachtung von Einzelspielen sechs Vereine untersucht: 1. FCHochstadt, FC Bayern Alzenau II, FSVBischofsheim, SCViktoria Nidda, SG Marköbel und SusgoOffenthal. Einen Überblick über deren geographische Lage gibt die Karte in Anhang 1 (S. 68). Frankfurt am Main ist zusätzlich als Referenzort dargestellt. In den vier untersuchten Spielzeiten wurde in der Gruppenliga Frankfurt Ost jeweils mit 18 Mannschaften im Modus mit Hin- und Rückspiel bei tauschendem Heimrecht gespielt. Dadurch ergeben sich für jeden Verein 17 Heimspiele pro Saison und somit 68 Heimspiele im Untersuchungszeitraum. Bei der Untersuchung der Heimspiele von sechs Vereinen ergibt sich demzufolge ein Stichprobenumfang von 408 Einzelspielen.
Wie beschrieben, besteht die Datenbasis zur Bildung der abhängigen Variable aus den, von den jeweiligen Heimvereinen angegebenen, Zuschauerzahlen bei diesen Spielen. Dabei ist jedoch dringend zu beachten, dass diese nicht als absolute Zahlen in die Untersuchung übernommen werden können. Das liegt daran, dass die analysierten Vereine über die vier Spielzeiten betrachtet verschiedene Zuschauerdurchschnitte hatten, was bedeutet, dass Stichproben mit unterschiedlichen Mittelwerten zu vergleichen sind. Beispielsweise hätten 100 Besucher bei einem Spiel während des Untersuchungszeitraums für den FC Bayern Alzenau II eine relativ hohe Nachfrage, für die SG Marköbel hingegen, eine relativ niedrige Nachfrage bedeutet. Um die Daten über alle Vereine hinweg vergleichbar zu machen, werden die Werte daher einer Z-Transformation unterzogen (vgl. Zöfel 2003, S. 58):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dabei beschreibt Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltendie absolute Anzahl der Zuschauer des Spiels Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenist das arithmetische Mittel und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltendie Standardabweichung der Zuschauerzahlen aller Heimspiele des Vereins Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenim Untersuchungszeitraum. Der transformierte Wert heißt Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenbis Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenbilden folglich die abhängigen Variablen der Untersuchung auf der Ebene von Einzelspielen. Im weiteren Verlauf werden diese als Z bezeichnet.
[...]
[1] Eine Ausnahme stellt die Untersuchung von Schantz (1996) dar, der die Ergebnisse von Zuschauerbefragungen bei je einem Amateurfußballspiel in Deutschland und Frankreich vergleicht.
[2] Anders verhält es sich mit den Teilnehmern des Spielbetriebs der deutschen Lizenzliegen (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalligen), welche nicht zwingend Mitglied eines Landesverbandes sein müssen.
[3] Das Selbstkonzept beschreibt das subjektive Bild von der eigenen Person (vgl. Asendorpf 2009, S. 109).
[4] Van Bentem (2004, S. 11) geht von über 700 Staffeln aus.
[5] Ein Dank gilt an dieser Stelle Herrn Gert Bechert, der diese Daten nach jedem Spieltag bei den Vereinen erfragt, archiviert und zum Zwecke dieser Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt hat.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842841291
- DOI
- 10.3239/9783842841291
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen – Betriebs- und Sozialwirtschaft, Studiengang Sportmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2012 (Oktober)
- Note
- 1,1
- Schlagworte
- sportmanagement zuschauernachfrage amateurfußball konsuminteressen sportveranstaltungen
- Produktsicherheit
- Diplom.de