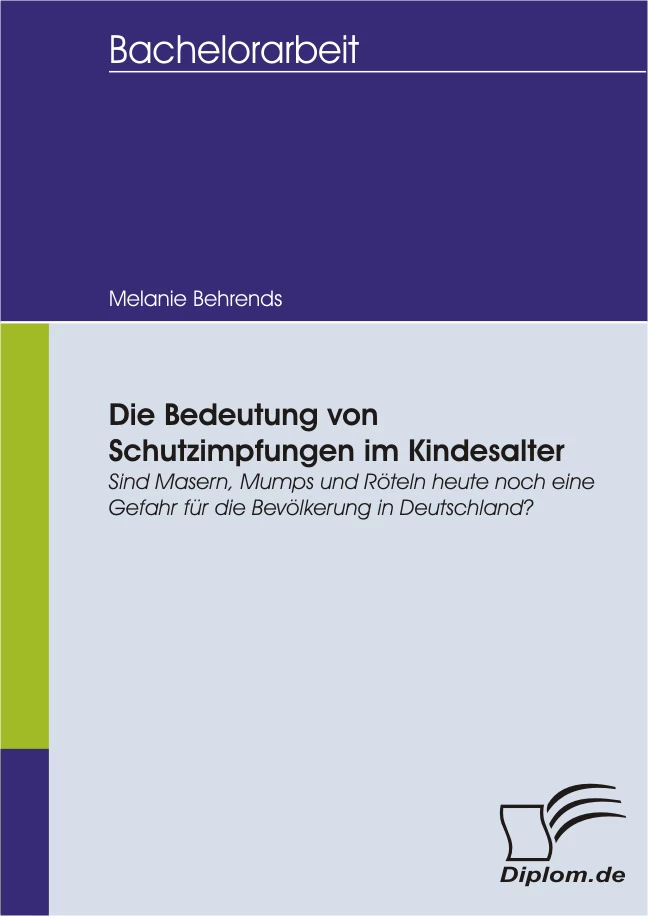Die Bedeutung von Schutzimpfungen im Kindesalter. Sind Masern, Mumps und Röteln heute noch eine Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland?
©2011
Bachelorarbeit
86 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Kinder sind unsere Zukunft. Und diese Zukunft gilt es zu sichern. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Gesundheit von Kindern ein, die allgemein im Vergleich zu Erwachsenen wegen ihres unausgereiften Immunsystems für gesundheitliche Risiken als anfälliger und gefährdeter gelten. Daraus ergibt sich für Kinder u. a. das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit (UN-Charta, 1992, S. 19).
Weltweit sterben jedes Jahr ca. 10,6 Mio. Kinder vor dem Alter von 5 Jahren. Es erscheint erschreckend, dass jährlich 1,4 Mio. von ihnen an den Folgen einer Infektionskrankheit sterben müssen, obwohl das durch eine rechtzeitige Impfung hätte vermieden werden können. Bevor es zur Einführung von routinemäßigen Impfungen kam, waren Infektionskrankheiten die häufigste Todesursache bei Kindern. Darunter nimmt die impfpräventable Infektionskrankheit Masern mit 38% die häufigste Todesursache ein (WHO, 2010a, S. 1).
Die Sicherstellung der Gesundheit unserer Kinder beginnt unter anderem in ihrer Prävention. In diesem Zusammenhang stellen Impfungen eine der effektivsten und kostengünstigsten primärpräventiven Gesundheitsmaßnahmen dar, um vor Infektionskrankheiten zu schützen. (Epid. Bulletin 30, 2010, S. 279) Sie können einen Schutz für den einzelnen Menschen vor bestimmten Infektionskrankheiten bilden. Wenn sich genügend Menschen impfen lassen, kann die Ausbreitung einer solchen Krankheit verhindert werden und im besten Fall einen Kollektivschutz der Bevölkerung bewirken (Herdenimmunität), was selbst Nichtimmunisierte schützt. (WHO, 2010a, S. 2) Die hoch ansteckenden Infektionskrankheiten Masern, Mumps und Röteln (MMR) werden auf Grund ihrer hohen Kontagiosität (Ansteckungsfähigkeit) mit ihrem Häufigkeitsgipfel im Kindesalter unter dem Begriff Kinderkrankheiten geführt. Dabei gilt: je älter ein nicht immunisierter Mensch ist, der daran erkrankt, umso mehr steigen die Komplikationsraten und bei der konnatalen Rötelnerkrankung die Wahrscheinlichkeit von schweren Schäden des Embryos im Mutterleib. (Epid. Bulletin 26, 2003, S. 200) Auf Grund der zum Teil schweren Krankheitsverläufe, wie z. B. Enzephalitis durch Masern, Hodenentzündung und Meningitis durch Mumps sowie Enzephalitis bei Röteln und Embryopathie bei den konnatalen Röteln (Meyer & Reiter, 2004, S. 1182), wird der Impfung eine wichtige Rolle als präventive Maßnahme zur Bildung eines individuellen und kollektiven Schutz vor diesen Krankheiten beigemessen. 1984 wurde in Deutschland […]
Kinder sind unsere Zukunft. Und diese Zukunft gilt es zu sichern. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Gesundheit von Kindern ein, die allgemein im Vergleich zu Erwachsenen wegen ihres unausgereiften Immunsystems für gesundheitliche Risiken als anfälliger und gefährdeter gelten. Daraus ergibt sich für Kinder u. a. das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit (UN-Charta, 1992, S. 19).
Weltweit sterben jedes Jahr ca. 10,6 Mio. Kinder vor dem Alter von 5 Jahren. Es erscheint erschreckend, dass jährlich 1,4 Mio. von ihnen an den Folgen einer Infektionskrankheit sterben müssen, obwohl das durch eine rechtzeitige Impfung hätte vermieden werden können. Bevor es zur Einführung von routinemäßigen Impfungen kam, waren Infektionskrankheiten die häufigste Todesursache bei Kindern. Darunter nimmt die impfpräventable Infektionskrankheit Masern mit 38% die häufigste Todesursache ein (WHO, 2010a, S. 1).
Die Sicherstellung der Gesundheit unserer Kinder beginnt unter anderem in ihrer Prävention. In diesem Zusammenhang stellen Impfungen eine der effektivsten und kostengünstigsten primärpräventiven Gesundheitsmaßnahmen dar, um vor Infektionskrankheiten zu schützen. (Epid. Bulletin 30, 2010, S. 279) Sie können einen Schutz für den einzelnen Menschen vor bestimmten Infektionskrankheiten bilden. Wenn sich genügend Menschen impfen lassen, kann die Ausbreitung einer solchen Krankheit verhindert werden und im besten Fall einen Kollektivschutz der Bevölkerung bewirken (Herdenimmunität), was selbst Nichtimmunisierte schützt. (WHO, 2010a, S. 2) Die hoch ansteckenden Infektionskrankheiten Masern, Mumps und Röteln (MMR) werden auf Grund ihrer hohen Kontagiosität (Ansteckungsfähigkeit) mit ihrem Häufigkeitsgipfel im Kindesalter unter dem Begriff Kinderkrankheiten geführt. Dabei gilt: je älter ein nicht immunisierter Mensch ist, der daran erkrankt, umso mehr steigen die Komplikationsraten und bei der konnatalen Rötelnerkrankung die Wahrscheinlichkeit von schweren Schäden des Embryos im Mutterleib. (Epid. Bulletin 26, 2003, S. 200) Auf Grund der zum Teil schweren Krankheitsverläufe, wie z. B. Enzephalitis durch Masern, Hodenentzündung und Meningitis durch Mumps sowie Enzephalitis bei Röteln und Embryopathie bei den konnatalen Röteln (Meyer & Reiter, 2004, S. 1182), wird der Impfung eine wichtige Rolle als präventive Maßnahme zur Bildung eines individuellen und kollektiven Schutz vor diesen Krankheiten beigemessen. 1984 wurde in Deutschland […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Melanie Behrends
Die Bedeutung von Schutzimpfungen im Kindesalter. Sind Masern, Mumps und Röteln
heute noch eine Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland?
ISBN: 978-3-8428-3423-1
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
Zugl. Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg, Deutschland, Bachelorarbeit, 2011
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2012
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen beteiligten Personen bedanken, welche
mich während der Vorbereitung und Erstellung dieser Bachelor-Arbeit unterstützt ha-
ben. Meiner ganzen Familie, vor allem meinem kleinen Sohn Lenny und meinem
Mann Christoph, gilt mein besonderer Dank. Sie unterstützten mich nicht nur wäh-
rend der Anfertigung dieser Bachelor-Arbeit sehr, sondern auch während des gesam-
ten Studiums, wodurch sie auf vieles verzichteten.
Zusammenfassung
II
Zusammenfassung
Die vorliegende Bachelor-Arbeit untersucht auch die Bedeutung von Schutzimpfun-
gen im Kindesalter, um festzustellen, ob MMR heute noch eine Gefahr für die Bevöl-
kerung in Deutschland sind. Neben den Darstellungen über die Krankheitsbilder mit
Symptomen, Verlauf und möglichen Folgen von MMR werden Impfungen und deren
mögliche Nebenwirkungen als wirksamste und kosteneffektivste Maßnahme in der
gesundheitlichen Primärprävention gegen MMR im Theorieteil dieser Arbeit behan-
delt. Nach einer Auseinandersetzung mit nationalen und internationalen Impfpro-
grammen, Impfgegner und -skeptiker sowie rechtlichen Grundlagen des deutschen
Impfwesens und ökonomischen Faktoren der MMR-Impfung, im gesundheitspoliti-
schen Theorieteil, werden daraufhin eine durch diese Arbeit zu klärende Frage und
Hypothesen abgeleitet: Sind MMR dadurch immer noch eine Gefahr für die Bevölke-
rung in Deutschland? Die Hypothesen werden in die Makro-, Meso- und Mikroebene
geteilt. Mittels Methode einer systematischen Literaturrecherche in den Datenbanken
,,Medline Direct" und ,,Cochrane" werden insgesamt 689 Einträge nach Filtration auf
ihre Relevanz zum Thema geprüft. Im Ergebnis können 20 übernommene Einträge
inhaltlich und graphisch dargestellt werden, die die Fragestellung über die Makro-,
Meso- und Mikroebenen dahingehend beantworten, dass es grundsätzliche Interven-
tionen für die Aufklärung und zur Durchimpfung gibt. Diese erreichen einerseits die
betreffenden Adressaten nicht ausreichend genug, wodurch andererseits u.a. nicht
hinreichend genug Impfakzeptanz erzielt wird, was zu Impfquoten gegen MMR von
unter 95% und deswegen weiterhin zu Infektionen sowie regionalen Epidemien ins-
besondere durch Masern führt. Es kann festgestellt werden, dass die Kinderkrankhei-
ten MMR heute immer noch eine Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland sind und
welche Bedeutungen Schutzimpfungen im Kindealter haben. Anschließend wird mit
den Erkenntnissen aus dem Theorieteil und den Ergebnissen der Literaturrecherche
dieser Arbeit über die Makro-, Meso- und Mikroebene zusammenhängend diskutiert.
Im Endergebnis werden schlussfolgernd aus der Diskussion die aufgestellte Frage
und Hypothesen aufgegriffen, beantwortet sowie abgeleitete Interventionsmöglichkei-
ten für die Praxis und Theorie genannt. Diese Arbeit soll im Ergebnis dazu dienen, in
Zukunft nicht nur höhere Impfquoten zu erzielen, sondern auch das gemeinsam mit
der WHO gefasste Ziel einer Masern- und Rötelneliminierung bis 2015 gerecht zu
werden, um die Bevölkerung und insbesondere Kinder vor den Kinderkrankheiten
MMR zu schützen.
Inhaltsverzeichnis
III
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung ... II
Inhaltsverzeichnis ... III
Abbildungsverzeichnis ... V
Tabellenverzeichnis ... VI
Abkürzungsverzeichnis ... VII
1
Einleitung ... 1
2
Theorieteil ... 4
2.1
Medizinische Grundlagen über MMR ... 4
2.1.1
Masern ... 4
2.1.2
Mumps ... 5
2.1.3
Röteln ... 5
2.2
Schutzimpfungen ... 6
2.2.1
Historie von Schutzimpfungen ... 6
2.2.2
Schutzimpfungen gegen MMR... 7
2.2.3
Nebenwirkungen und Komplikationen nach Schutzimpfung gegen MMR
sowie Kontraindikationen ... 9
2.2.4
Impfempfehlungen ... 10
2.3
Epidemiologie von MMR ... 10
2.3.1
Epidemiologie von MMR in Deutschland ... 11
2.3.2
Infektionsepidemiologie
,,Ost-West"-Vergleich der Masernfälle in
Deutschland von 2006 bis 2010... 12
2.3.3
Infektionsepidemiologie
Vergleich der Masernfalle in Deutschland von
2006 bis 2010 nach Altersgruppe ... 14
2.4
Gesundheitspolitischer Hintergrund ... 15
2.4.1
Ökonomische Aspekte der MMR-Impfung ... 15
2.4.2
Impfziele ... 15
2.4.3
Impfkonzepte und Impfprogramme ... 16
2.4.4
Impfakzeptanz ... 19
2.4.5
Rechtliche und ethische Aspekte des deutschen Impfwesens ... 21
3
Fragestellung ... 22
4
Methoden... 23
Inhaltsverzeichnis
IV
5
Ergebnisse ... 26
5.1
Einordnung der Ergebnisse der Literaturrecherche in Makro-, Meso- und
Mikroebene... 26
5.1.1
Ergebnisse auf der Makroebene... 26
5.1.2
Ergebnisse auf der Mesoebene ... 33
5.1.3
Ergebnisse auf der Mikroebene ... 38
5.2
Systematisierte Zusammenfassung der Ergebnisse ... 40
6
Diskussion ... 42
6.1
Diskussion auf der Makro-, Meso- und Mikroebene ... 43
6.1.1
Diskussion auf der Makroebene ... 43
6.1.2
Diskussion auf der Mesoebene... 46
6.1.3
Diskussion auf der Mikroebene... 49
6.2
Schlussfolgerungen ... 52
Glossar ... 57
Literaturverzeichnis ... 58
Anlage A ... 69
Anlage B ... 72
Anlage C ... 74
Abbildungsverzeichnis
V
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:
Schaubild über die Entwicklung von Inzidenzen in Abhängigkeit
diverser Faktoren ... 19
Abb. 2:
Die Impfentscheidung in Abhängigkeit ihrer Faktoren und Einflüsse
innerhalb des Ebenenmodells ... 40
Tabellenverzeichnis
VI
Tabellenverzeichnis
Tab. 1:
Gegenüberstellung von Komplikationen durch Erkrankung an MMR
und nach Impfung ... 9
Tab. 2:
,,Ost-West"-Vergleich der Masernfalle in D von 2006-2010 ... 13
Tab. 3:
Vergleich der Masernfälle in D von 2006-2010 nach Altersgruppe ... 14
Abkürzungsverzeichnis
VII
Abkürzungsverzeichnis
ABL alte
Bundesländer
BGH Bundesgerichtshof
BVKJ
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte
BZgA Bundeszentrale
für
gesundheitliche
Aufklärung
D Deutschland
DIMDI
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
IfSG Infektionsschutzgesetz
KJÄD
Kinder- und Jugendärztliche(r) Dienst
KV Kassenärztliche
Vereinigungen
MMR
Masern, Mumps und Röteln
NBL neue
Bundesländer
ÖGD Öffentlicher
Gesundheitsdienst
RKI Robert-Koch-Institut
SEU Schuleingangsuntersuchung(en)
WHO
World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
Kapitel 1: Einleitung
1
1 Einleitung
Kinder sind unsere Zukunft. Und diese Zukunft gilt es zu sichern. Eine wichtige Rolle
nimmt dabei die Gesundheit von Kindern ein, die allgemein im Vergleich zu Erwach-
senen wegen ihres unausgereiften Immunsystems für gesundheitliche Risiken als
anfälliger und gefährdeter gelten. Daraus ergibt sich für Kinder u. a. das ,,Recht auf
das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit" (UN-Charta, 1992, S. 19)
Weltweit sterben jedes Jahr ca. 10,6 Mio. Kinder vor dem Alter von 5 Jahren. Es er-
scheint erschreckend, dass jährlich 1,4 Mio. von ihnen an den Folgen einer Infekti-
onskrankheit sterben müssen, obwohl das durch eine rechtzeitige Impfung hätte
vermieden werden können. Bevor es zur Einführung von routinemäßigen Impfungen
kam, waren Infektionskrankheiten die häufigste Todesursache bei Kindern. Darunter
nimmt die impfpräventable Infektionskrankheit Masern mit 38% die häufigste Todes-
ursache
ein.
(WHO,
2010a,
S.
1)
Die Sicherstellung der Gesundheit unserer Kinder beginnt unter anderem in ihrer
Prävention. In diesem Zusammenhang stellen Impfungen eine der effektivsten und
kostengünstigsten primärpräventiven Gesundheitsmaßnahmen dar, um vor Infekti-
onskrankheiten zu schützen.
(Epid. Bulletin 30, 2010, S. 279) Sie können einen
Schutz für den einzelnen Menschen vor bestimmten Infektionskrankheiten bilden.
Wenn sich genügend Menschen impfen lassen, kann die Ausbreitung einer solchen
Krankheit verhindert werden und im besten Fall einen Kollektivschutz der Bevölke-
rung bewirken (Herdenimmunität), was selbst Nichtimmunisierte schützt. (WHO,
2010a, S. 2) Die hoch ansteckenden Infektionskrankheiten Masern, Mumps und
Röteln (MMR) werden auf Grund ihrer hohen Kontagiosität (Ansteckungsfähigkeit)
mit ihrem Häufigkeitsgipfel im Kindesalter unter dem Begriff ,,Kinderkrankheiten" ge-
führt. Dabei gilt: je älter ein nicht immunisierter Mensch ist, der daran erkrankt, umso
mehr steigen die Komplikationsraten und bei der konnatalen Rötelnerkrankung die
Wahrscheinlichkeit von schweren Schäden des Embryos im Mutterleib. (Epid.
Bulletin 26, 2003, S. 200) Auf Grund der zum Teil schweren Krankheitsverläufe, wie
z. B. Enzephalitis durch Masern, Hodenentzündung und Meningitis durch Mumps
sowie Enzephalitis bei Röteln und Embryopathie bei den konnatalen Röteln (Meyer &
Reiter, 2004, S. 1182), wird der Impfung eine wichtige Rolle als präventive Maßnah-
me zur Bildung eines individuellen und kollektiven Schutz vor diesen Krankheiten
beigemessen. 1984 wurde in Deutschland der Kombinationsimpfstoff ,,MMR" gegen
die Infektionskrankheiten Masern, Mumps und Röteln eingeführt, und gilt im Ver-
Kapitel 1: Einleitung
2
gleich zu den Einzelimpfstoffen als mindestens gleich verträglich. (Kriwy, 2007, S.
25) Seit 2001 empfiehlt die STIKO eine 2-fache Kombinationsimpfung gegen MMR.
(Epid. Bulletin 32, 2010, S. 320) Deutschland hat die Masern- und Rötelnelimination
zum gesundheitspolitischem Ziel bis 2010 erklärt und sich damit der Zielsetzung der
WHO angeschlossen. (Epid. Bulletin 31, 2007, S. 289) Die von der WHO geforderten
und von Deutschland als Gesundheitsziel ernannten Indikatoren zur Elimination von
Masern und Röteln sind: eine Höchstinzidenz von 0,1 Erkrankungen pro 100.000
Einwohner, eine mindestens 95%ige Durchimpfungsrate bei der 2. MMR-Impfung
sowie eine laborgestützte Überwachung mit einem Anteil von mindestens 80% labor-
bestätigter Fälle (Labor-Surveillance). (Epid. Bulletin 32, 2010, S. 319)
Seit den letzten zehn Jahren ist ein stetiger Anstieg der Impfquoten für beide Impfdo-
sen von MMR in Deutschland zu verzeichnen. 2009 beträgt die Impfquote der 1. Do-
sis 96,1% und die der 2. Dosis 90,2% (Epid. Bulletin 16, 2011, S. 127), die Masernin-
zidenz liegt 2010 bei einer Erkrankung pro 100.000 Einwohner und die labordiagnos-
tische Masernsurveillance bei 57%. (RKI, 2011a, S. 156-158) Es erkrankten 2010
insgesamt 780 Menschen in Deutschland an Masern. (RKI, 2011b)
Diese Daten zeigen u. a., dass in Deutschland das gemeinsam mit der WHO gefass-
te Ziel, die Masern- und Rötelnelimination bis 2010 zu verwirklichen, nicht erreicht
hat. Zu diesem Ergebnis ist ebenso der Ausschuss Regionalkomitee für Europa der
WHO bei seiner 60. Tagung in Moskau gekommen. (WHO, 2010c). In Folge dessen
beschloss das Komitee die ,,Erneuerung des Engagements für die Eliminierung von
Masern und Röteln und die Prävention der Rötelnembryopathie in der Europäischen
Region der WHO bis zum Jahr 2015". (WHO, 2010b)
Trotz zahlreicher Interventionen, wie z. B. dem seit 1999 bestehenden ,,Konzept für
ein nationales Programm zur Eliminierung der Masern in der BRD" (RKI, 1999), und
öffentlichen Empfehlungen, gelang es Deutschland u. a. bis heute nicht ein nationa-
les Impfprogramm zur Anwendung zu bringen. (Reiter et al., 2009a, S. 3) Auch wenn
Deutschland durchaus auf Erfolge mittels Schutzimpfungen zurückblicken kann: die
Pocken traten 1972 das letzte Mal in Hannover auf und wurden 1980 von der WHO
als ausgerottet erklärt (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2007, S. 156) sowie die
Poliomyelitiseliminierung 2002 (WHO, 2005). Es erscheint in Anbetracht der effekti-
ven Impfprogramme gegen z. B. Pocken und Poliomyelitis unvorstellbar, dass Ma-
sern und konnatale Röteln mit ihren zum Teil schwereren Krankheitsbildern nicht ge-
nügend Impfakzeptanz in der Bevölkerung entfalten können, um eine Eliminierung zu
erreichen.
Kapitel 1: Einleitung
3
Länder mit effektiven Masern-Impfprogrammen sind z. B. die USA und die Nieder-
lande, die u. a. dadurch sehr hohe Durchimpfungsraten erreichten. (Epid. Bulletin 30,
2010, S. 282) Die Masern erfolgreich zu eliminieren schafften Finnland 2003 (Kriwy,
2007, S. 20) und die USA 2002 (Wichmann, O., 2011). Dass es in Ländern, die als
(fast) masernfrei gelten, trotzdem Ausbrüche gibt, ist meistens auf einen Virenimport
zurückzuführen. Zu den größten ,,Masern-Exporteuren" in Europa gehört u. a.
Deutschland. (Fachportal Naturheilkunde & Naturheilverfahren, 2011a)
Unter den aktuell 1461 Masernerkrankungen in Deutschland (Stand 10.08.2011)
(RKI, 2011c) musste sogar ein Todesfall in Bayern verzeichnet werden. Der Präsi-
dent des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Hartmann sprach seine
Empörung darüber aus: ,,Dass ein Mensch in Deutschland an Masern stirbt, ist ein
Skandal." (Fachportal Naturheilkunde & Naturheilverfahren, 2011a)
Das Gesundheitsziel, die Masern- und Rötelneliminierung bis 2015 erreichen zu wol-
len, scheint angesichts solcher Fallzahlen und Berichterstattung gefährdet. Zumal
Deutschland bei der Realisierung dieses Gesundheitszieles als eine der modernsten
Industrienationen hinter den skandinavischen Ländern, der Niederlande und den
USA hinterher hinkt. (Epid. Bulletin 30, 2010, S. 282)
Diese Umstände weisen auf eine unterschätzte Risikowahrnehmung bezüglich der
Bedrohung durch Masern innerhalb der Bevölkerung hin, was durch nicht ausrei-
chende Impfquoten und zu hohen Inzidenzen erklärt werden könnte. Auf Grund des-
sen wird Deutschland sogar ,,Impfmüdigkeit" u. a. durch die WHO nachgesagt.
(Hurrelmann et al., 2007, S. 158; Fachportal Naturheilkunde & Naturheilverfahren,
2011b)
In dieser Arbeit werden im Folgenden zunächst innerhalb eines Theorieteiles
medizinsiche Grundlagen, Schutzimpfungen, Epidemiologie und
Gesundheitspolitische Aspekte von MMR behandelt. Nach einer systematischen
Literaturrecherche werden die Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil
diskutiert, um im Schluss die Bedeutung von Schutzimpfungen gegen MMR zu klären
und ob diese Kinderkrankheiten heute noch eine Gefahr für die Bevölkerung in
Deutschland sind.
Kapitel 2: Theorieteil
4
2 Theorieteil
2.1 Medizinische
Grundlagen
über
MMR
2.1.1
Masern
Ätiologie und Pathogenese: Masern ist eine nur beim Menschen auftretende Virus-
erkrankung, die sich durch Tröpfchenübertragung von Mensch zu Mensch verbreitet.
Als Auslöser wird das Morbillivirus identifiziert. Das Virus breitet sich zuerst im inne-
ren des Körpers, von Virenvermehrung in den Epithelzellen über Lymphknotenstatio-
nen und erster Virämie (Nachweisbarkeit des Virus im Blut), bis hin zu einer Beteili-
gung der Haut und einer Virenausbreitung im Atmungsapperat, aus. Die Erkrankung
ist hochkontagiös (hohe Ansteckungs- und Übertragungsfähigkeit) und hat einen sehr
hohen Manifestationsindex (95%-99% Erkrankung nach Infektion).
Krankheitsbild: Die Inkubationszeit liegt zwischen 8-12 Tagen, danach beginnt die
Erkrankung mit unspezifischen Zeichen einer Atemwegserkrankung: Fieber, Entzün-
dung der Nasen- und Rachenschleimhaut und Husten. Am Ende des Stadiums mit
diesen eher uncharakteristischen Symptomen entwickeln sich Kopliksche Flecken an
der Mundschleimhaut. Es kommt erneut zu fiebrigen Temperaturanstieg mit einem
ausgeprägten Krankheitsgefühl, Bewegungsunlust und einem fluorierendem kleinfle-
ckigem Exanthem auf der Haut. Das Exanthem breitet sich beginnend hinter den Oh-
ren über das Gesicht und dem Stamm bis hin zu den Extremitäten aus. Nach einer
Woche bildet es sich in der gleichen Reihenfolge zurück.
Komplikationen: Neben einer Mittelohrentzündung (5-15%), Lungenentzündung (bis
zu 50%) deren Heilungschancen (meist) gut verlaufen, kann in seltenen Fällen eine
Enzephalitis (Hirnentzündung, 0,05-0,2%) auftreten deren Letalität bei 20% liegt. Be-
sonders betroffen sind Menschen mit einem zellulären Immundefekt. Erkranken diese
an Masern verläuft das Bild meist ohne Exantheme dafür mit einer Riesen-Zell-
Pneumonie und einer Letalität von ca. 5%. Eine seltene, aber auftretende Spätfolge
einer Maserninfektion ist die sogenannte subakute sklerosierende Panenzephalitis
(SSPE), die nach durchschnittlich 7 Jahren bei 1:2000 bis 1:100.000 Masernfällen
auftreten kann und zum Tode führt. Brechen Masern aus, gibt es keine medizini-
schen Therapiemöglichkeiten, so dass ihr natürlicher Krankheitsverlauf durchlebt
werden muss. 10-14 Tage nach Exanthemherausbildung sind IgG-Antikörper nach-
weisbar, die eine lebenslange Immunität erzeugen und somit eine erneute Maserner-
krankung verhindern. (Heininger, 2004, S. 1132; Heininger, 2006a, S. 83-88; Hirte,
2004, S. 245-247; Illing & Ledig, 2006, S. 49)
Kapitel 2: Theorieteil
5
2.1.2
Mumps
Ätiologie und Pathogenese: Bei Mumps handelt es sich um eine durch das Para-
myxovirus nur beim Mensch auftretende Infektionskrankheit. Mumps wird durch
Tröpfchenübertragung und Speichelkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Die
Kontagiosität ist gegenüber den Masern deutlich geringer. Sie wird durch inkonse-
quente Impfungen wie in Deutschland auf das Jugend- und junge Erwachsenenalter
verlagert.
Krankheitsbild: Bei mehr als 50% verläuft die Krankheit in Form einer Atemwegser-
krankung. Nach Manifestierung des Erregers beginnt die Krankheit ca. 16-18 Tage
danach mit leichtem Fieber, geringem Krankheitsgefühl und unspezifischen Atem-
wegserkrankung-Symptomen. Bei 30-40% der Infizierten kann die Vergrößerung der
Ohrspeicheldrüsen festgestellt werden, die zu einer örtlichen Schwellung führt. Eine
Begleiterscheinung ist die Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, die sich durch vorü-
bergehende Bauchschmerzen bemerkbar macht.
Komplikationen: Seltene Beobachtungen zeigen mikroskopische kleine Blutpartikel
im Urin oder eine Diabetesauslösung. Von besonderer Bedeutung ist die bei 5% der
Erkrankten auftretende Begleitmeningitis (Hirnhautentzündung), die generell folgen-
los ausheilt, aber dennoch vereinzelt zur Zunahme des Hirnwasservolumens,
Krampfanfällen und Hirnnervenlähmung kommen kann, was beim letzteren in den
meisten Fällen für eine bleibende Schwerhörigkeit verantwortlich ist. Des Weiteren ist
ein Auftreten einer Epididymitis (Nebenhodenentzündung) und Orchitis (Hodenent-
zündung) bei Jungen zu 30-35% sowie eine Oopheritis (Eierstockentzündung) zu 5%
bzw. Mastitis (Entzündung der Brust) zu 35% bei Mädchen ab dem Pubertätsalter
wahrscheinlich. Sie führen vereinzelt bei Jungen zur Zeugungsunfähigkeit.
(Heininger, U., 2004, S. 1032-1033; Heininger, 2006a, S. 89-91; Hirte, 2004, S. 282-
285; Illing & Ledig, 2006, S. 57-59)
2.1.3
Röteln
Ätiologie und Pathogenese: Röteln sind ebenso wie Masern und Mumps eine In-
fektionskrankheit, die nur bei einem Menschen ausbrechen und auch nur von ihm
durch Tröpfchen übertragen werden kann. Eine Ausnahme stellt die diaplazentare
(durch die Plazenta) Übertragung des Erregers zum Embryo in der Frühschwanger-
schaft, sog. konnatale Röteln, dar. Der Erreger vermehrt sich nach Infektion zu-
nächst in den Epithelzellen der Nasenrachenschleimhaut und Lymphknoten. Nach
einer Woche erfolgt die Virämie und äußert sich in sichtbare Exantheme sowie bei
Kapitel 2: Theorieteil
6
Schwangeren in einer Plazentainfektion, die dem Virus den Übertritt in den embryo-
nalen bzw. fetalen Kreislauf ermöglichen. Dort führt das Virus zu vielfältigen, charak-
teristischen Entwicklungsstörungen des Embryos. Die Kontagiosität ist hoch. Präna-
tal infizierte Kinder bleiben bis zu einem Jahr nach Infektion ansteckungsfähig. Die
Infektion hinterlässt eine lebenslange Röteln-Immunität.
Krankheitsbild: Ungefähr 25-30% der Rötelnerkrankungen verlaufen asymptoma-
tisch. Sonst kommt es nach einer Inkubationszeit von 14-21 Tagen zum Erkran-
kungsausbruch mit in der Regel mildem Verlauf: Nasenschleimhautentzündung,
leichter Husten, leichte Temperaturerhöhung, Exantheme (makulös bis makulo-
papulös, im Gesicht beginnend und distal ausbreitend in Verbindung mit Lymphkno-
tenanschwellung). Bei weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen tauchen u.
a. Gelenkschmerzen bzw. entzündete Gelenke mit mehr als 50% an den Knien auf.
Komplikationen: Sehr seltene Komplikationen mit meist günstigem Verlauf sind En-
zephalitis und Thrombozytopenie. Als schwerwiegend gilt die Rötelninfektion in der
Frühschwangerschaft, bei der das Virus über die Plazenta das Embryo infiziert (sog.
konnatale Röteln). Sie kann zur Fehlgeburt bzw. Schädigung des Embryos führen.
Als häufigste Fehlbildungen gelten Innenohrtaubheit, Linsentrübung und Herzfehler.
Bei etwa 20% der betreffenden Kinder sind in den ersten Lebensmonaten bzw. -
jahren erhebliche Entwicklungsstörungen erkennbar, die auf einer Hirnschädigung
durch das Rötelnvirus beruhen. Röteln sind weit verbreitet, nennenswert sind aber
vor allem die damit verbundene Morbidität und Letalität nur bei den pränatal (vor der
Geburt) erworbenen Röteln. (Heininger, U., 2004, S. 1034; Heininger, 2006a, S. 91-
94; Hirte, 2004, S. 295-297; Illing & Ledig, 2006, S. 72-75) Dabei steigt die Wahr-
scheinlichkeit einer Gesundheitsschädigung des Embryos, je früher es sich mit dem
Virus infiziert. (Epid. Bulletin 32, 2010, S. 322-323)
2.2
Schutzimpfungen
2.2.1 Historie von Schutzimpfungen
Bereits vor über 1000 Jahren fand man in China heraus, dass überstandene Infekti-
onskrankheiten Immunität vor zukünftiger Erkrankung bewirkt haben. Aufbauend auf
dieser Grundlage entwickelte Edward Jenner 1796 in England den ersten nachweis-
baren Impfstoff gegen Pocken. Er bemerkte, wie Melker durch Pocken ihrer Kühe
angesteckt wurden, jedoch resistent gegenüber dem vom Menschen übertragenen
Erreger waren. (Hirte, 2004, S. 15) Der aus einem Kuhausschlag gewonnene Impf-
stoff prägt den heutigen Begriff der Vakzination (vacca=Kuh) (aktive Impfungen).
Kapitel 2: Theorieteil
7
(Kriwy, 2007, S. 19) Jenner verabreichte den Pockenimpfstoff einem Jungen, den er
daraufhin mit den echten Pocken infizierte. Der Junge entwickelte höchstwahrschein-
lich Immunität, weil er nicht an Pocken erkrankte. Die auf dieser Grundlage basie-
renden Folgeimpfstoffe, u. a. gegen Pocken (1798), Pest (1897), Diphterie (1925),
waren nach heutigen Kriterien schlecht gereinigt und hatten viele Nebenwirkungen.
Vor diesem Hintergrund fielen tausende Menschen der Impfung zum Opfer. Weil
meist Menschen mit hohem sozialen Status von Impfstoffen profitierten, gingen die
Erkrankungszahlen kaum zurück. Deshalb blieb Impfen nicht nur jahrzehntelang um-
stritten, sondern brachte auch zahlreiche Kritiker und Skeptiker hervor. Nach Weiter-
entwicklung von Impfstoffen sind erste größere Impfkampagnen (gegen Pocken und
Poliomyelitis) in den fünfziger und sechziger Jahren flächendeckend regional einge-
führt worden. Der nachweisliche Rückgang von Erkrankungszahlen bestimmter
impfpräventabler Infektionskrankheiten wird der Wirksamkeit von Impfstoffen, aber
auch den besseren Lebensstandards und Hygienebedingungen zugeschrieben.
(Hirte, 2004, S. 15-18) Auch erste Impfstoffe gegen MMR fanden ihren Einzug auf
den Markt Mitte der sechziger Jahre. (Kriwy, 2007, S. 19) Nach dem kein Pockenfall
mehr auftrat, erklärte 1980 die WHO die Welt als pockenfrei. (Hirte, 2004, S. 17) Die-
ser Erfolg gilt als Meilenstein in der Impfmedizin und wird gerne als Begründung für
die Wirksamkeit von Impfstoffen herangezogen. (Reiter, et al., 2009a, S. 1; WHO,
2010a, S. 5) Zweifelsohne haben hohe Durchimpfungsraten der Bevölkerung durch
effektive Impfprogramme zur Ausrottung der Masern in den USA (2002) (Wichmann,
O., 2011) und in Finnland (2003) (Kriwy, 2007, S. 20) geführt. Die Elimination der
Poliomyelitis 2002 in Europa untermauert die Aussage der Impfstoffwirksamkeit.
(WHO, 2005)
2.2.2 Schutzimpfungen gegen MMR
Unter der Schirmherrschaft der WHO sind Impfstoffe gegen Mumps 1967, gegen
Masern 1968 und gegen Röteln 1969 eingeführt worden. (Heininger, 2006a, S. 17)
Anfang der siebziger Jahre wurde gegen Mumps, Masern und Röteln der Kombinati-
onsimpfstoff ,,MMR" eingeführt. Dieser setzte sich zunehmend durch, so dass heutzu-
tage ein Einzelimpfstoff gegen Mumps nicht mehr erhältlich ist. (Heininger, 2006a, S.
90-91) In der DDR wurde seit 1970 mittels Impfpflicht u. a. gegen Masern vorgegan-
gen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts (RKI) emp-
fiehlt seit 1974 für die BRD eine monovalente Masernimpfung und ab 1991 für
Deutschland eine 2-fache Impfung mit dem Kombinationsimpfstoff MMR. (Epid.
Kapitel 2: Theorieteil
8
Bulletin 32, 2010, S. 320) Der in Deutschland eingeführte MMR-Impfstoff beinhaltet
abgeschwächte Lebendvakzine. Er gilt im Vergleich zu den Einzelimpfstoffen als
mindestens gleich verträglich. (Heininger, 2006a, S. 43; Kriwy, 2007, S. 25; Bitzer,
Walter, Lingner & Schwartz, 2009, S. 70) Das RKI weist in den wöchentlich publizier-
ten Gesundheitsblättern, zuletzt im Epidemischen Bulletin 32/2010, auf die Sicherheit
des MMR-Impfstoffs hin. (Epid. Bulletin 32, 2010, S. 320) Das zunehmende Ver-
schwinden von MMR durch steigende Impfquoten im Verhältnis zu geringen Erkran-
kungsfallzahlen deutet auf eine Wirksamkeit des MMR-Impfstoffs hin. (Bitzer et al.,
2009, S. 260) Die Vorteile von Kombinationsimpfstoffen bestehen darin einen Impf-
ling mit weniger Injektionen vor mehreren Erregern gleichzeitig zu schützen. Durch-
impfungsraten für mehrere Krankheiten können gesteigert werden, es entstehen ge-
ringere Kosten für die Impfstoffdosis im Vergleich zu Einzelimpfstoffen und weniger
Abfallmengen sowie geringere Nebenwirkungen durch verhältnismäßig weniger Be-
gleitsubstanzen. (Bitzer et al., 2009, S. 42) Sollten dennoch Komplikationen nach
Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff auftreten, kann nicht festgestellt werden,
welche Komponente dafür verantwortlich ist. Dieser Nachteil kann sich negativ auf
die Entscheidung über den Fortlauf des Impfplans auswirken. (Heininger, 2006a, S.
43; Hirte, 2004, S. 68) Die Kinderkrankheiten MMR weisen auf Grund hoher Konta-
giosität (Ansteckungsgefahr) ihren Häufigkeitsgipfel im Kindesalter auf und mit zu-
nehmendem Lebensalter eine Steigerung von Komplikationsraten. (Epid. Bulletin 26,
2003) Vor diesem Hintergrund empfiehlt das RKI den Impfschutz vor dem Erreichen
des 3. Lebensjahres mit 2 Dosierungen MMR abzuschließen. (RKI, 2011f) Für Nach-
holimpfungen gibt es keine Altersbeschränkung. Der Impfstoff führt in der Regel 14
Tage nach Injektion zu einen jahrzehnte- bis lebenslangen Impfschutz. Die erste Imp-
fung führt bei 95% der Geimpften zu Immunität mit IgG-Antikörpern. Die übrigen 5%
werden als ,,primäre Impfversager" bezeichnet. Deswegen wird eine zweite MMR-
Dosis empfohlen, damit bei den primären Impfversagern schützende Antikörper ge-
bildet werden können. Die 2. Dosis schadet den 95% Erstimpflingen nicht, weil sie
auf Grund von herausgebildeter Immunität durch die 1. Dosis die abgeschwächten
Lebendviren schnell neutralisieren können. (Heininger, 2006a, S. 86-87) Auf dem
Markt sind die Impfstoffe ,,Mérieux" gegen Masern, ,,HDC Mérieux" gegen Röteln und
sowohl ,,MMR-Vax Pro", ,,MMR Triplovax" als auch ,,Priorix" als Kombinationsimpfstoff
gegen MMR erhältlich. (Ages, 2011) ,,Die nur noch geringfügigen Unterschiede beim
Impfschutz gegen [MMR] sind ein Indiz für die fast ausschließliche Verwendung des
MMR-Kombinationsimpfstoffs." (Epid. Bulletin 16, 2011, S. 127)
Kapitel 2: Theorieteil
9
2.2.3 Nebenwirkungen und Komplikationen nach Schutzimpfung gegen MMR
sowie Kontraindikationen
Tab. 1: Gegenüberstellung von Komplikationen durch Erkrankung an MMR und
nach Impfung (Meyer & Reiter, 2004, S. 1184)
Aus der Studie KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 2003-2006) konnte
weitestgehend belegt werden, dass das evaluierte Nebenwirkungsprofil der MMR-
Impfung unter der Häufigkeit der bereits bekannten Impfnebenwirkungen liegt.
(Poethko-Müller, Atzpodien, Schmitz & Schlaud, 2011a, S. 357-363) (siehe Tab. 1)
Die Auswertung von Meldungen über mögliche Impfkomplikationen an das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) aus den Jahren 2004 und 2005 bestätigt das Ergebnis der
KiGGS-Studie trotz bekannter Fälle, dass der Nutzen von Impfungen höher ist als
deren Risiken. (Weißer, Meyer, Petzold, Mentzer & Keller-Stanislawski, 2007, S.
1406) Es müssen dennoch Kontraindikationen (siehe Glossar) beachtet werden: bei
akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankungen; bekannte, schwere allergische Reak-
Erkrankung/Symptom
Komplikationsrate
bei Erkrankung
Komplikationsrate
nach Impfung
Masern:
MMR
Exanthem
98%
5%, abgeschwächt
Fieber
98%, meist hoch
3-5%, sehr selten
Fieberkrämpfe
7-8%
1%
Verminderte Anzahl der Blutplättchen
1/3000
1/30.000-50.000
Enzephalitis
1/1000 10.000
1/1.000.000
(Zusammenhang unsicher)
Letalität
30%
Defektheilung
20%
Vorrübergehende Immunsuppression
oft Folgekrankheiten,
z. B. Pneumonie
Mumps:
MMR
Entzündung der Speicheldrüse
98%
0,5%
Bauchspeicheldrüse
2-5%
0,5%
Hodenentzündung bei Jugendlichen
und erwachsenen Männern
20-50%
1/1.000.000
Meningitis
~15%
1/1.000.000
Taubheit
1/20.000
0
Röteln:
MMR
Gelenkbeschwerden bei erwachsenen
Frauen
40-70%
1/10.000 meist kurz und
schwach
Gehirnentzündung
1/6000
0
Verminderung der Blutplättchen
1/3000
1/30.000-50.000
Rötelnembryopathie bei Infektion in
der Schwangerschaft
>60%
0
Kapitel 2: Theorieteil
10
tionen auf Bestandteile des Impfstoffes; Schwangerschaft und angeborene oder er-
worbene Immundefizienz (siehe Glossar) darf nicht geimpft werden. (Heininger,
2006a, S. 87) Neben Gründen nicht zu impfen (Kontraindikationen), gibt es auch
Gründe die fälschlicherweise als Kontraindikationen angesehen werden dennoch
zu Impfen. (Epid. Bulletin 30, 2010, S. 293)
Auf ,,falsche Kontraindikationen" wird in
diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen.
2.2.4
Impfempfehlungen
Gemäß RKI (2011f) werden aktuell zwei Dosen mit einem MMR-Impfstoff in Abstand
von mind. 4 Wochen ab dem 11. Lebensmonat für die 1. Dosis und zwischen dem
15.-23. Lebensmonat die 2. Dosis empfohlen. Weiterhin wird zusätzlich zur zweimali-
gen Impfung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr empfohlen, dass
sich alle nach 1970 geborenen Personen über 18 Jahre eine einmalige Impfung ge-
gen Masern geben lassen, wenn sie bisher nicht, nur einmal in der Kindheit geimpft
worden oder der Impfstatus unklar ist. Die STIKO empfiehlt darüber hinaus allen, die
im Gesundheitsdienst oder in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind und/oder Im-
mundefiziente betreuen eine Auffrischungsimpfung. Es wird vorzugsweise ein Kom-
binationsimpfstoff gegen MMR empfohlen. (Epid. Bulletin 32, 2010, S. 315) Bei Kon-
takt mit Mumps, Masern oder Röteln wird zu einer Impfprophylaxe möglichst inner-
halb von 3 Tagen nach Exposition (siehe Glossar)
geraten. Trotz fehlendem Wirk-
samkeitsnachweis kann diese Impfung 3-5 Tage nach Exposition die Symptomatik
sowie die Kontagiosität reduzieren und den Infektionszyklus unterbrechen.
(Heininger, 2006a, S. 89 u. 91) Für Frauen in der Frühschwangerschaft bewirkt eine
solche Impfung nach Exposition mit einem Rötelnvirus keine Immunisierung.
(Heininger, 2006a, S. 93) (siehe Anlage C: Impfkalender und Ergänzungstabellen)
2.3 Epidemiologie
von
MMR
Auswertbare Daten über Infektionsauftreten gibt es seit dem Jahr 1980 bis 2000 nur
aus der ehemaligen DDR bzw. den neuen Bundesländern (NBL) aufgrund der im-
plementierten Meldepflicht. In dem beobachteten Median (1980-2000) sind die jährli-
chen Fallzahlen für Masern von 28.745 auf 73, für Mumps von 126.886 auf 268 und
für Röteln (ab 1983) von 22.830 auf 352 gefallen. Für die BRD konnten bis zum Jahr
2001 nur Schätzungen auf Grundlage der Hospitalstatistik erfolgen. (Meyer, Reiter,
Siedler, Hellenbrand Rasch, 2002, S. 324-325) Mit dem seit 2001 geltendem Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG) können auch erstmals auswertbare Falldaten über die Mel-
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842834231
- Dateigröße
- 779 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Magdeburg-Stendal; Standort Magdeburg – Sozial- und Gesundheitswesen
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- masern mumps röteln gefahr
- Produktsicherheit
- Diplom.de