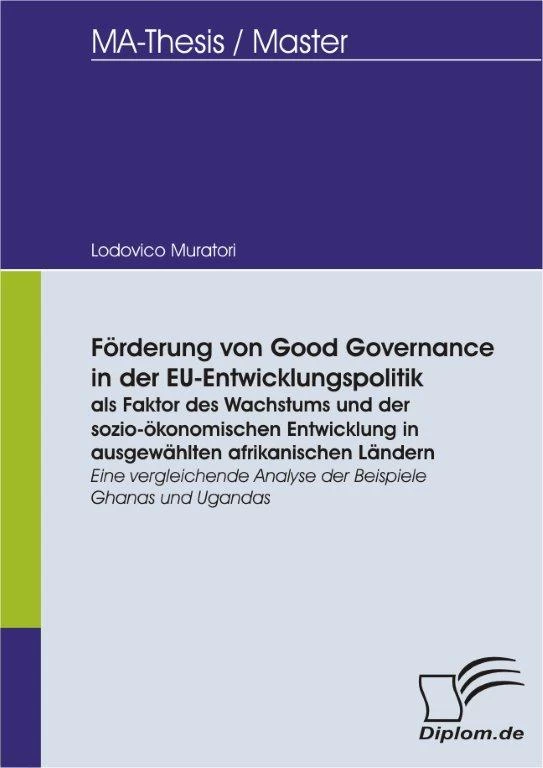Förderung von Good Governance in der EU-Entwicklungspolitik als Faktor des Wachstums und der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten afrikanischen Ländern
Eine vergleichende Analyse der Beispiele Ghanas und Ugandas
©2011
Masterarbeit
136 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die vorliegende Studie untersucht die Auswirkungen der Entwicklungszusammenarbeit auf die Entwicklung, hier als Armutsminderung definiert, in Ghana und Uganda. Dieser Analyse liegt ein genaues Verständnis internationaler Beziehungen zugrunde, d.h. dass die Akteure der Weltpolitik, wie z.B. Staaten und internationale Organisationen, weder vollkommen altruistisch, weil sie ihre Interesse vorantreiben wollen, noch vollkommen egoistisch sind, weil sie auf die Bedürfnisse der Empfängerländer achten. Die in dieser Studie geltend gemachte Position befindet sich in der Grenzzone zwischen dem Realismus und dem Konstruktivismus und erkennt den relevanten theoretischen Beitrag, aber auch die Engstirnigkeit einiger Schlussfolgerungen des einen und des anderen an.
Viele Studien haben ihren Schwerpunkt auf die Fragestellung gelegt, welches der zwei Modelle, d.h. Realismus oder Konstruktivismus, vorrangig in der Entwicklungspolitik präsent ist und dieses anhand der Einbeziehung der Variablen der Interessen der Geberländer und der Bedürfnisse der Empfängerländer als Faktoren des Entscheidungstreffens in der Vergabe der Entwicklungshilfen überprüft. Die Forschung liefert hierzu widersprüchliche Resultate, aber im Allgemeinen darf gesagt werden, dass egoistische Zwecke in bilateralen Entwicklungshilfen prioritär sind und dass das Verhältnis in der multilateralen Zusammenarbeit konträr ist.
In der vorliegenden Studie werden die Variablen der Interessen der Geberländer und der Bedürfnisse der Empfängerländer in der Regressionsanalyse nicht operationalisiert, weil das Hauptaugenmerk nicht auf die Motivationen, sondern auf die Effekte der Geldervergabe auf das wirtschaftlichen Wachstum und die Entwicklung der Empfängerländer liegt. Allerdings werden die erwähnten Überlegungen in der qualitativen Bewertung der Ergebnisse der Regressionsanalyse berücksichtigt, weil die Allokationsgründe die Strategien der Entwicklungspolitik beeinflussen.
Die Studie besteht aus sieben Teilen: Im Anschluss an diese Einleitung werden in Kapitel 2 die Grundlagen des angewandten theoretischen Ansatzes erläutert. Hierbei wird auch auf das Verständnis des Begriffs Armut, auf die verschiedenen Ansätze der Entwicklungsökonomie und der Entwicklungspolitik eingegangen. Darüber hinaus wird das dieser Studie zugrunde gelegte mikro- und makroökonomische Modell präsentiert. In Kapitel 3 wird die Auswahl der Fallbeispiele, d. h. Ghana und Uganda, begründet und ihre […]
Die vorliegende Studie untersucht die Auswirkungen der Entwicklungszusammenarbeit auf die Entwicklung, hier als Armutsminderung definiert, in Ghana und Uganda. Dieser Analyse liegt ein genaues Verständnis internationaler Beziehungen zugrunde, d.h. dass die Akteure der Weltpolitik, wie z.B. Staaten und internationale Organisationen, weder vollkommen altruistisch, weil sie ihre Interesse vorantreiben wollen, noch vollkommen egoistisch sind, weil sie auf die Bedürfnisse der Empfängerländer achten. Die in dieser Studie geltend gemachte Position befindet sich in der Grenzzone zwischen dem Realismus und dem Konstruktivismus und erkennt den relevanten theoretischen Beitrag, aber auch die Engstirnigkeit einiger Schlussfolgerungen des einen und des anderen an.
Viele Studien haben ihren Schwerpunkt auf die Fragestellung gelegt, welches der zwei Modelle, d.h. Realismus oder Konstruktivismus, vorrangig in der Entwicklungspolitik präsent ist und dieses anhand der Einbeziehung der Variablen der Interessen der Geberländer und der Bedürfnisse der Empfängerländer als Faktoren des Entscheidungstreffens in der Vergabe der Entwicklungshilfen überprüft. Die Forschung liefert hierzu widersprüchliche Resultate, aber im Allgemeinen darf gesagt werden, dass egoistische Zwecke in bilateralen Entwicklungshilfen prioritär sind und dass das Verhältnis in der multilateralen Zusammenarbeit konträr ist.
In der vorliegenden Studie werden die Variablen der Interessen der Geberländer und der Bedürfnisse der Empfängerländer in der Regressionsanalyse nicht operationalisiert, weil das Hauptaugenmerk nicht auf die Motivationen, sondern auf die Effekte der Geldervergabe auf das wirtschaftlichen Wachstum und die Entwicklung der Empfängerländer liegt. Allerdings werden die erwähnten Überlegungen in der qualitativen Bewertung der Ergebnisse der Regressionsanalyse berücksichtigt, weil die Allokationsgründe die Strategien der Entwicklungspolitik beeinflussen.
Die Studie besteht aus sieben Teilen: Im Anschluss an diese Einleitung werden in Kapitel 2 die Grundlagen des angewandten theoretischen Ansatzes erläutert. Hierbei wird auch auf das Verständnis des Begriffs Armut, auf die verschiedenen Ansätze der Entwicklungsökonomie und der Entwicklungspolitik eingegangen. Darüber hinaus wird das dieser Studie zugrunde gelegte mikro- und makroökonomische Modell präsentiert. In Kapitel 3 wird die Auswahl der Fallbeispiele, d. h. Ghana und Uganda, begründet und ihre […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Lodovico Muratori
Förderung von Good Governance in der EU-Entwicklungspolitik als Faktor des
Wachstums und der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten afrikanischen
Ländern
Eine vergleichende Analyse der Beispiele Ghanas und Ugandas
ISBN: 978-3-8428-3024-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
Zugl. Freie Universität Berlin, Berlin, Deutschland, MA-Thesis / Master, 2011
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2012
Die vorliegende Masterarbeit wurde durch LYX Version 1.6.7 geschrieben, als Dokumentklasse
Book (KOMA-Script: scrbook) formatiert und als PDF-Datei durch den pdflatex-Befehl hergestellt.
Die Bibliographie wurde nach dem bibliographischen Stil apalike-url-deutsch, den der Autor mit
kleinen Anpassungsänderungen des apalike-url-Stils von Norman Gray (GNU General Public License)
zusammensetzte, erzeugt. Alle erwähnten bibliographischen Layouts basieren auf dem Zitierstil Nat-Bib
(Autor-Jahr).
Fachbegriffe sind im Text eingehend erläutert. Einige Termini, die im Text mit
*Sternchen
gekennzeichnet wurden, werden im Glossar noch ausführlicher definiert. Eine CD-Rom mit den
Excel-Dateien, in denen die Berechnung der Regressionsanalyse enthalten ist, wird beigelegt.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden
dürften.
Die Aktualität des Inhalts aller angegebenen Internetressourcen wurde zuletzt am 10.7.2011 geprüft.
Die letzte Revision der Masterarbeit wurde am 6.12.2011 abgeschlossen.
Der Autor bedankt sich herzlich bei Frau PD Salua Nour und Herrn Dr. Stefan Ryll für ihre Hilfsbereitschaft
und Betreuung. Der Autor widmet diese Arbeit seiner Familie und seinen Freunden, die ihn immer
unterstützt haben.
Stichwörter:
Armutsminderung,
Ausländische
Direktinvestitionen
(ADI),
Bertelsmann
Transformation
Index
(BTI),
Beschäftigungsquote,
Bevölkerungszahl,
Bruttofixkapitalbildung,
Bruttoinlandsersparnis,
Corruption
Perception
Index
(CPI),
Cotonou-Abkommen, Entwicklung, Entwicklungsökonomie, Europäische Entwicklungsbank
(EIB), Europäische Entwicklungsfonds (EDF), Europäische Union, EuropeAid Development
and Cooperation, Ghana, Good Governance, Korruptionsbekämpfung, Messung der
Governance, Regressionsanalyse, Uganda, Wachstum, Weltbank.
III
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
VII
Abbildungsverzeichnis
VIII
Abkürzungsverzeichnis
IX
1. Zum Inhalt und Aufbau der Arbeit
1
2. Theoretische Grundlagen
3
2.1. Verständnis des Begriffs ,,Armut" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.2. Grundlegende Definitionen zur Entwicklungspolitik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
. . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2.3.1. Die Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.3.2. Joseph Schumpeter und seine Theorie einer dynamischen Ökonomie . . . . . . . . . .
8
2.3.3. Von den neoklassischen Ansätzen bis Keynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.3.4. Wachstumsorientierte Entwicklungsprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.3.5. Kritik an den wachstumsorientierten Programmen und die Durchsetzung der
Dependenztheorie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.3.6. Die Grundbedürfnisstrategie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
2.3.7. Die Kontroversen in den 80er und 90er Jahren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2.3.8. Wirtschaftsgeographie, neue politische Ökonomie und neue Institutionenökonomik . .
17
2.3.9. Post-Development-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2.4. Grundlagen des mikro- und makroökonomischen Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3. Vergleichende Analyse zweier ähnlicher Fallbeispiele: Ghana und Uganda
23
3.1. Begründung der Fallbeispielauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3.2. Wirtschaftliche, politische und soziale Ausgangslage Ghanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.2.1. Etnische Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.2.2. Politische, soziale und wirtschaftliche Strukturen vor der britischen Kolonisierung . . .
29
3.2.3. Die ersten Jahren der Unabhängigkeit: instabiles und nicht-demokratisches politisches
System
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3.2.4. Rückkehr zur Demokratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
3.3. Wirtschaftliche, politische und soziale Ausgangslage Ugandas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
3.3.1. Politische, soziale und wirtschaftliche Strukturen vor der britischen Kolonisierung . . .
32
3.3.2. Britische Herrschaft und Sonderstellung des Königreichs von Baganda . . . . . . . . .
33
3.3.3. Der Weg zur Unabhänigkeit und interne Kriege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
IV
Inhaltsverzeichnis
3.3.4. Politische Stabilität und Autoritarismus unter Museveni . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
4. Regressionsanalyse: Auswirkungen der Entwicklungshilfen auf die Beschäftigung.
38
4.1. Festlegung der zu untersuchenden Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
4.1.1. Operationalisierte Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
4.1.2. Ausgeschlossene Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
4.2. Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
4.2.1. Modellformulierung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
4.2.2. Überprüfung der Regressionsfunktion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
4.2.3. Überprüfung der Regressionskoeffizienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
4.2.4. Prüfung der Modellprämissen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.3. Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
4.3.1. Modellformulierung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
4.3.2. Überprüfung der Regressionsfunktion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
4.3.3. Überprüfung der Regressionskoeffizienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
4.3.4. Prüfung der Modellprämissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
4.4. Schlussfolgerung der Regressionsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
5. Rolle der Governance für die Entwicklung
74
5.1. Enstehung des Konzepts der ,,Governance" und seine Interpretationen . . . . . . . . . . . . .
74
5.2. Indikatoren zur Messung der Governance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
5.2.1. Human-Development-Index und Indikatoren der Weltbank . . . . . . . . . . . . . . . .
83
5.2.2. Indikatoren der ,,politischen" Governance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
5.2.3. Bertelsmann-Transformation-Index und Failed-States-Index . . . . . . . . . . . . . . .
88
6. Die Good-Governance-Anforderungen in der EG/EU-AKP-Partnerschaft
93
6.1. Historischer Überblick und Merkmale der EG/EU-Entwicklungspolitik . . . . . . . . . . . . .
93
6.1.1. Die EG/EU als entwicklungspolitischer Akteur: Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . .
93
6.1.2. Assozierung französischer Überseegebiete durch die römischen Verträge und
Yaoundé-Abkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
6.1.3. Lomé-Verträge und Beitritt der ehemaligen britischen Kolonien . . . . . . . . . . . . .
95
6.1.4. Cotonou-Abkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
6.1.5. Wechselwirkungen zwischen Korruption und aller sonstigen Governance-Aspekte . . . 101
6.2. Definition und Umfang der Korruption
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.3. Korruptionsbekämpfung in Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.4. Korruptionsbekämpfung in Uganda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7. Schlussfolgerungen
110
Literaturverzeichnis
113
V
Inhaltsverzeichnis
A. Abbildungen von Heteroskedastizität und Autokorrelation
120
B. Glossar
121
VI
Tabellenverzeichnis
4.1. Multivariate Regressionen mit der Gesamtbevölkerung
(X
4
) und erwerbsfähiger
Bevölkerung
(X
4b
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2. Vergleich des
R
2
korr
von
Y
g
, Y
m
, Y
w
für
Ghana
(91-07)
und
Ghana
(97-07)
. . . . . .
44
4.3. Vergleich von
r
xy
,
R
2
und
R
2
korr
von
Y
g
, Y
m
, Y
w
für
Ghana
(91-07)
. . . . . . . . . . .
46
4.4. F-Test für
Y
GH(91-07)
g
,
Y
GH(91-07)
m
,
Y
GH(91-07)
w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
4.5. Variationskoeffizient (v) für Y
GH(91-07)
g
, Y
GH(91-07)
m
, Y
GH(91-07)
w
. . . . . . . . . . . . .
48
4.6. t-Test für
X
1
,
X
2
,
X
3
,
X
4
und
X
5
bei
Y
GH(91-07)
g
, Y
GH(91-07)
m
, Y
GH(91-07)
w
. . . . . . .
50
4.7.
R
2
korr
einfacher Regressionen von
X
1
,
X
2
, X
3
, X
4
und X
5
. . . . . . . . . . . . . . .
51
4.8.
R
2
korr
von multivariaten Regressionen (Kombination von
X
1
, X
3
, X
5
) . . . . . . . .
52
4.9. Goldfeld-Quandt-Test
zur
Prüfung
der
Heteroskedastizität
für
Y
GH(91-07)
g
,
Y
GH(91-07)
m
,
Y
GH(91-07)
w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
4.10. d-Werte der Durbin-Watson Formel für Y
GH(91-07)
g
, Y
GH(91-07)
m
, Y
GH(91-07)
w
. . . . . .
55
4.11.
R
2
und
VIF
j
für
Y
GH(91-07)
g
, Y
GH(91-07)
m
, Y
GH(91-07)
w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
4.12. Vergleich des
R
2
korr
von
Y
g
, Y
m
, Y
w
für
U ganda
(91-07)
und
U ganda
(97-07)
. . . . .
57
4.13. Vergleich von
r
xy
,
R
2
und
R
2
korr
für
Y
UG(97-07)
g
, Y
UG(97-07)
m
, Y
UG(97-07)
w
.
. . . . . . .
58
4.14. F-Test für Y
UG(97-07)
g
, Y
UG(97-07)
m
, Y
UG(97-07)
w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
4.15. Variationskoeffizient (v) für Y
UG(97-07)
g
, Y
UG(97-07)
m
, Y
UG(97-07)
w
. . . . . . . . . . . . .
59
4.16. t-Test für
X
1
,
X
2
,
X
3
,
X
4
und
X
5
bei
Y
UG(97-07)
g
, Y
UG(97-07)
m
, Y
UG(97-07)
w
. . . . . . .
61
4.17. R
2
korr
einfacher Regressionen von
X
1
,
X
2
, X
3
, X
4
und X
5
. . . . . . . . . . . . . .
62
4.18. R
2
korr
von multivariaten Regressionen für
Y
UG(97-07)
w
(Kombination von
X
1
, X
3
,
X
5
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
4.19. Goldfeld-Quandt-Test
zur
Prüfung
der
Heteroskedastizität
für
Y
UG(97-07)
g
,
Y
UG(97-07)
m
,
Y
UG(97-07)
w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
4.20. d-Werte der Durbin-Watson Formel für Y
UG(97-07)
g
, Y
UG(97-07)
m
, Y
UG(97-07)
w
. . . . . .
66
4.21. R
2
und
V IF
j
für
Y
UG(97-07)
g
,
Y
UG(97-07)
m
,
Y
UG(97-07)
w
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
5.1. Aspekte des verwendeten Good Governance-Konzepts (nach: Audretsch, 2009, 23) . .
77
5.2. Übersicht einiger Governance-Indikatoren
(I Teil)
(nach: Nuscheler, 2009, 42) . . . .
84
5.3. Übersicht einiger Governance-Indikatoren
(II Teil)
(nach: Nuscheler, 2009, 42) . . . .
85
VII
Abbildungsverzeichnis
3.1.1.Gesamtbevölkerung Ghanas und Ugandas [1991-2007] (in Millionen Menschen)
[Eigene Bearbeitung nach Daten aus: (UN-Population-Division, 2009)] . . . . . . . . . . . . .
25
3.1.2.Betrag der Entwicklungshilfe und eingehender ausländischer Direktinvestitionen
(in Mio. US$ in jeweiligen Preisen und Wechselkursen) [Eigene Bearbeitung nach Daten aus:
(UNCTAD, 2010)(OECD-DAC, 2010b)(OECD-DAC, 2010a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
3.1.3.Verlauf jährlicher Pro-Kopf-BIP-Wachstumsraten [KKP] (%) [Eigene Bearbeitung
nach Daten aus: (World-Bank, 2010a)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.4.1.Verlauf jährlicher Beschäftigungsquoten in Ghana und Uganda [1991-2007] (in
%) [Eigene Bearbeitung nach Daten aus: (ILO, 2009)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
4.4.2.Vergleich der HDI-Werte von Ghana und Uganda [Eigene Bearbeitung nach Daten
aus: (UNDP, 2010)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
4.4.3.Vergleich der CPI-Werte von Ghana und Uganda [Eigene Bearbeitung nach Daten
aus: (Transparency-International, 2010)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
4.4.4.Vergleich der BTI-Werte von Ghana und Uganda [Eigene Bearbeitung nach Daten
aus: (Bertelsmann-Stiftung, 2010)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
A.0.1.Typische Verteilung der Residuen bei der Heteroskedastizität und bei der
Autokorrelation (Backhaus et al., 2006, 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
VIII
Abkürzungsverzeichnis
konstante Regenerationsrate des menschlichen Kapitals
Irrtumswahrscheinlichkeit
Quote an Löhnen im Nationaleinkommen
t
Sozialklima
h
Akkumulationsrate des Know-Hows
k
Kapitalvertiefungsquote
NR
t
Wachstumsrate natürlicher Ressourcen
T
t
Wachstumsrate der Technologie
Elastizität des Produktes auf die externen Effekten des Erwerbs des Know-Hows seitens der
Beschäftigten
I
t
/
K
t-1
Akkumulationsrate
Y
Mittelwert von Y
Quoten an Profiten im Nationaleinkommen
Standardabweichung
g
(tiefgestellt) gesamt
m
(tiefgestellt) männlich
w
(tiefgestellt) weiblich
E
t
Quote des Unternehmensgeistes
G
n
natürliche Wachstumsrate
G
w
wünschenwerte Wachstumsrate
H
0
Nullhypothese
I
At
autonome Investitionen
I
It
induzierte Investitionen
i
t
Zinssatz
K
t-1
Kapitalbestand
P
t
Profit
R
2
Bestimmtheitsmaß
IX
Abkürzungsverzeichnis
R
2
korr
korrigiertes Bestimmtheitsmaß
r
xy
Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson
s
p
Sparneigung der Kapitalisten
s
w
Sparneigung der Arbeitnehmer
W
rt
Reallohn
X
1
; X
2
; X
3
; X
4
; X
5
operationalisierte unabhängige Variablen (s. Kapitel 4.1.1 für die Deutung)
X
4b
erwerbsfähige Bevölkerung (von der Operationalisierung ausgeschlossene Variable. s. 4.1.2)
X
i
beliebiges X
Y
g
; Y
m
; Y
w
Operationalisierte abhängige Variable (s. 4.1.1)
1-
Vertrauenswahrscheinlichkeit
A
anfängliche Technologieniveau
ADI
private ausländische Direktinvestitionen
AKP
Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten.
AU
afrikanische Union
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BLUE Best Linear Unbiased Estimator, dt: bester linearer unverzerrter Schätzer
BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Deutschland)
BTI
Bertelsmann Transformation Index
CHRAJ Commission for Human Rights and Administrative Justice (Ghana)
CPI
Corruption Perception Index
CPIA Country Policy and Institutional Assessment
CPP
Convention's People Party (Ghana)
DAC
Development Assistance Committee der der Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)
DDGG Donor Democracy and Governance Group (Koordinierungsgruppe der Geberländer in Uganda)
DEVCO Generaldirektion EuropeAid Development and Cooperation (EU-Kommission)
DP
Democratic Party (Uganda)
ECHO Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (EU-Kommission)
EEAS europäische auswärtige Dienst (EU-Kommission)
X
Abkürzungsverzeichnis
EEF
Europäischer Entwicklungsfonds (EU)
EG
Europäische Gemeinschaft(en)
EIB
Europäische Investitionsbank (EU)
EL
Entwicklungsländer
EP
Entwicklungspolitik
EU
Europäische Union
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZ
Entwicklungszusammenarbeit
G
effektive Wachstumsrate
GASP gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (EU)
GD
Generaldirektionen
(EU-Kommission)
h
Niveau des Know-Hows des jeweiligen Beschäftigen
HDI
Human Development Index
I
Investitionen
IDA
International Development Association
IFI
International Financial Institution(s), dt: Internationale Finanzinstitutionen
IG
Ispectorate of Government (Uganda)
IL
Industrieländer
ILO
International Labour Organization
IWF
Internationaler Währungsfonds
Jh.
Jahrhundert/Jahrhunderten
JI
Justiz und Inneres (EU)
k
Kapitalintensität (Kapitalausstattung pro Beschäftigte)
KKP
Kaufkraftparität
KY
Kabaka Yekka (Royalistische Partei Bugandas in Uganda)
LLDC Least Developed Countries (deutsch: am wenigsten entwickelte Länder)
LRA
Lord's Resistance Army (Uganda)
MDBS Multi-Donor Budget Support (Ghana)
XI
Abkürzungsverzeichnis
Mio
Million/Millionen
MS
Microsoft Corporation
N
Anzahl an Beschäftigten
NDC
National Democratic Congress (Ghana)
NLC
National Liberation Council (Ghana)
NRA
National Resistance Army (Uganda)
NSA
nicht-staatliche Akteure
OAU
Organization of African Unity, dt: Organisation für afrikanische Einheit
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OIGG Office of the Inspector General of Government (Uganda)
PJZS
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (EU)
PPV
paritätische parlamentarische Versammlung
(AKP-EU-Partnerschaft)
PTS
Political Terror Scale
S
Ersparnisse
SFO
Serious Fraud Office (Ghana)
STABEX System for the Stabilization of Export Earnings (EU)
SYSMIN System of Stabilization of Export Earnings from Mining Products (EU)
TRADE Generaldirektion Handel (EU-Kommission)
u
Der Zeitanteil, der der Arbeit und nicht der Weiterbildung gewidmet wird.
UGCC United Gold Coast Convention (Ghana)
UHRC Uganda Human Rights Commission
UN
United Nations Organization
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDP United Nations Development Programme
UNLF Uganda National Liberation Front
UPC
Uganda People's Congress
v
Variationskoeffizient
WTO World Trade Organisation
X
Produkt
XII
Kapitel 1
Zum Inhalt und Aufbau der Arbeit
Like slavery and apartheid, poverty is not natural.
It is man-made and it can be overcome and
eradicated by the actions of human beings (Mandela, 2005).
Die
vorliegende
Masterarbeit
untersucht
die
Auswirkungen
der
Entwicklungszusammenarbeit auf die Entwicklung, hier als Armutsminderung definiert,
in Ghana und Uganda. Dieser Analyse liegt ein genaues Verständnis internationaler
Beziehungen zugrunde, d. h. dass die Akteure der Weltpolitik, wie z. B. Staaten und
internationale Organisationen, weder vollkommen altruistisch, weil sie ihre Interesse
vorantreiben wollen, noch vollkommen egoistisch sind, weil sie auf die Bedürfnisse der
Empfängerländer achten. Die in dieser Studie geltend gemachte Position befindet sich in der
Grenzzone zwischen dem Realismus und dem Konstruktivismus und erkennt den relevanten
theoretischen Beitrag, aber auch die Engstirnigkeit einiger Schlussfolgerungen des einen und
des anderen an.
Viele Studien haben ihren Schwerpunkt auf die Fragestellung gelegt, welches der zwei
Modelle, d. h. Realismus oder Konstruktivismus, vorrangig in der Entwicklungspolitik
präsent ist und dieses anhand der Einbeziehung der Variablen der Interessen der Geberländer
und der Bedürfnisse der Empfängerländer als Faktoren des Entscheidungstreffens in der
Vergabe der Entwicklungshilfen überprüft. Die Forschung liefert hierzu widersprüchliche
Resultate, aber im Allgemeinen darf gesagt werden, dass egoistische Zwecke in
bilateralen Entwicklungshilfen prioritär sind und dass das Verhältnis in der multilateralen
Zusammenarbeit konträr ist (Neumayer, 2003, 18-20).
In der vorliegenden Studie werden die Variablen der Interessen der Geberländer und
der Bedürfnisse der Empfängerländer in der Regressionsanalyse nicht operationalisiert,
weil das Hauptaugenmerk nicht auf die Motivationen, sondern auf die Effekte der
Geldervergabe auf das wirtschaftlichen Wachstum und die Entwicklung der Empfängerländer
liegt. Allerdings werden die erwähnten Überlegungen in der qualitativen Bewertung der
Ergebnisse der Regressionsanalyse berücksichtigt, weil die Allokationsgründe die Strategien
der Entwicklungspolitik beeinflussen.
Die Abschlussarbeit besteht aus sieben Teilen: Im Anschluss an diese Einleitung werden
in Kapitel 2 die Grundlagen des angewandten theoretischen Ansatzes erläutert. Hierbei
wird auch auf das Verständnis des Begriffs ,,Armut", auf die verschiedenen Ansätze der
Entwicklungsökonomie und der Entwicklungspolitik eingegangen. Darüber hinaus wird
das dieser Studie zugrunde gelegte mikro- und makroökonomische Modell präsentiert. In
1
1. Zum Inhalt und Aufbau der Arbeit
Kapitel 3 wird die Auswahl der Fallbeispiele, d. h. Ghana und Uganda, begründet und
ihre wirtschaftliche, politische und soziale Ausgangslagen erklärt. In Kapitel 4 werden das
Regressionsmodell, die Auswahl der Variablen und des Untersuchungzeitraums vorgestellt,
die Regressionsanalyse durchgeführt und ihre Gültigkeit und Linearität durch verschiedene
Tests, z. B. durch den F-Test, den t-Test und die Durbin-Watson-Formel , geprüft.
Damit der Beitrag der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Faktoren zur Entwicklung
eines Landes ausführlich dargestellt werden kann, wird in Kapitel 5 auf das Konzept
der ,,Good Governance", das seit etwa 20 Jahren ein programmatischer Fokus der
Entwicklungspolitik geworden ist, sowie auf ihre Messung eingegangen. In Kapitel 6
wird überprüft, ob eine unterschiedliche Ausgangslage der Governance-Strukturen die
Differenzen in den makroökonomischen Leistungen Ghanas und Ugandas bewirkt hat.
Darüber hinaus wird die Förderung der Politiken zur Korruptionsbekämpfung in der
EG/EU-*AKP-Partnerschaft beschrieben. Die EG/EU wurde als Geberorganisation gewählt,
weil die EU-Kommission allein in den 90er Jahren den fünftgrößten weltweiten Betrag an
Entwicklungszusammenarbeit ausgezahlt hat und zusammen mit den EU-Mitgliedsstaaten
mehr als 50 % der in die *AKP-Staaten eingehenden Entwicklungshilfe immer noch
vergibt. Darüber hinaus ist die EU seit der Verhandlung und dem In-Kraft-Treten des
*Cotonou-Abkommens (23. Juni 2000) ein Vorreiter in der expliziten Einbeziehung von
Good-Governance-Anforderungen an die Gebergemeinschaft, an ihre Mitgliedsstaaten und
an die Empfängerländer. Die vorliegende Betrachtung fokussiert besonders Maßnahmen
zur Korruptionsbekämpfung, weil erhebliche Wechselwirkungen zwischen der Korruption
und allen sonstigen Bestandteilen der Governance vorhanden sind. In Kapitel 7 werden
die Schlussfolgerungen aus der gesamten Studie gezogen und deren Verallgemeinerbarkeit
problematisiert. Im Anhang werden einige Vergleichsgrafiken zur Interpretation der
Regressionsanalyse sowie ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen hinzugefügt.
2
Kapitel 2
Theoretische Grundlagen
In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen des angewandten Ansatzes
erläutert. Auf das Verständnis des Begriffs ,,Armut", auf die verschiedenen Ansätze der
Entwicklungsökonomie und der Entwicklungspolitik wird eingegangen. Darüber hinaus wird
das dieser Studie zugrunde gelegte mikro- und makroökonomische Modell präsentiert.
2.1
Verständnis des Begriffs ,,Armut"
Eine Schwierigkeit, die Entwicklungspolitik zu gestalten, liegt in den strittigen Fragen
bezüglich ihrer Instrumente, Ziele und ihres Wirkungsgrads. Der Begriff ,,Entwicklung"
ist äußerst vielfältig. In der vorliegenden Arbeit wird er als Reduktion der Massenarmut
gedeutet. Auch der Begriff ,,Armut" weist verschiedene Dimensionen auf. Die Weltbank
versuchte in den letzten Jahrzehnten, durch einige Studien die Komplexität des Phänomens
Armut zu fassen (World-Bank, 2000). Die Umfragen und Analysen hierzu heben hervor,
dass Armut für die Armen selbst mehr als ein niedriges Einkommen- und Konsumniveau
bedeutet. Heute versteht man unter ,,Armut" (Killick, T.; Asthana, R.; Annex I in: Cox und
Healey, 2000, 179-183) (Durth et al., 2002, 7-34):
· Die ökonomische Dimension der Armut, die auf ein unterdurchschnittliches
Einkommens- und Konsumniveau verweist; sie wird mithilfe des Pro-Kopf-Einkommens
anhand der Kaufkraftparität (KKP) berechnet.
· Die
menschliche
Dimension
der
Armut,
das
heißt
der
unzureichende
Bildungs- und Grundernährungszustand. Letzterer hat zudem eine schlechte
Gesundheitsverfassung
zur
Folge.
Der
Ernährungszustand
kleiner
Kinder
wird
durch
den
Vergleich
von
anthropometrischen
Daten
ermittelt
1
.
Die Bildungsqualität kann durch die Alphabetisierungsrate, die Einschulungsquote
oder durch Tests zur Leistungsmessung untersucht werden.
· Die politische Dimension der Armut, die sich auf beschränkte politische Freiheiten,
Machtlosigkeit und starke soziale Abhängigkeit bezieht. Hierzu gehört auch die
Korruption, die erhebliche Auswirkungen auf das politische und soziale Leben hat. Ein
1
Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Unterschiede in der Durchschnittsgröße verschiedener Völker vor
allem von den Lebensstandards oder von Faktoren, die in einer späteren Altersstufe relevant sind, abhängen (Sahn
und Stifel, 2002).
3
2. Theoretische Grundlagen
hoher Verbreitungsgrad der Korruption erschwert es z. B. den schwächsten Mitgliedern
der Gesellschaft, gesetzwidrigen Eingriffen der Institutionen oder der Mächtigen
zu widerstehen und beschwört Misstrauen bezüglich der politischen und sozialen
Strukturen herauf. Die Indikatoren, die im Bereich ,,politische Armut" die größte
wissenschaftliche Anerkennung finden, sind der ,,Corruption-Perception-Index" von der
Organisation Transparency International und der ,,Freedom-in-the-World-Index" von
Freedom House. Deren Strukturen werden in Kapitel 5.2. erläutert.
· Die schutzbezogene Dimension der Armut, d. h. dass speziell die Armen besonderen
Risiken ausgesetzt sind, weil sie wegen unzureichender Ersparnisse meist nicht
in der Lage sind, sich dagegen zu versichern. Hiermit sind Naturkatastrophen,
Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit und Umweltverschmutzung gemeint. Soziale
Sicherungssysteme in den Entwicklungsländern, soweit überhaupt vorhanden, beziehen
sich auf die einflussreichsten Schichten der Bevölkerung wie z. B. Staatsbeamte oder
Angestellte des formellen Sektors.
· Die soziokulturelle Dimension der Armut, d. h. fehlende Akzeptanz innerhalb
einer Gemeinschaft und beschränkte Partizipationsmöglichkeiten am sozialen
und
politischen
Leben.
Menschen,
die
schwer
krank
oder
anders
als
die
Bevölkerungsmehrheit sind, leiden oft unter sozialem Ausschluss, was unter anderem
die Suche nach einer Arbeitstelle schwierig gestaltet, das Gefühl der Machtlosigkeit
verstärkt und sogar die Befriedigung von Grundbedürfnissen erschwert.
Häufig sind alle Facetten der Armut, die oben beschrieben wurden, miteinander korreliert,
d. h. das Bestehen von einer Form von Armut erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
der anderen Ausprägungen von Armut. Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Dimensionen von Armut sind zahlreich (Durth et al., 2002, 7-34). In dieser Studie wird
die Annahme verworfen, die Armen bildeten eine homogene Gruppe; so wird z. B.
zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung, zwischen Arbeitslosen und Berufstätigen,
Beschäftigten im Exportsektor und Arbeitnehmer in Zweigen, die gegen die ausländische
Konkurrenz kämpfen müssen, unterschieden (Killick, T; Asthana, R.; Annex I in: Cox und
Healey, 2000, 181).
Armut kann vorübergehend oder dauerhaft bzw. relativ oder absolut sein. Unter relativer
Armut wird das Wohlstandsgefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie
innerhalb der Entwicklungsländer zwischen den Regionen und sozialen Schichten verstanden.
Absolute Armut ist durch einen Zustand solch entwürdigender Lebensbedingungen wie
Krankheit, Analphabetentum, Unterernährung und Verwahrlosung charakterisiert, dass die
Opfer nicht einmal die grundlegendsten menschlichen Existenzbedürfnisse befriedigen können
(Nohlen und Sottoli, 2002, 68-70). Die International Development Association (IDA) hat
fünf quantitative Indikatoren absoluter Armut entwickelt: Jährliches Pro-Kopf-Einkommen
4
2.1. Verständnis des Begriffs ,,Armut"
unter 150 US$, täglicher Kalorienverbrauch unter 2160 bis 2670 Einheiten je nach Land, eine
Lebenserwartung unter 55 Jahren, eine Kindersterblichkeit von über 33 pro Tausend und eine
Geburtenrate über 25 pro Tausend. Ein alternatives synthetisches, allerdings partielles Maß
der Armut sind die von der Weltbank berechneten food adequancy standards: Menschen, die
mehr als 70 % ihres Einkommens für die Ernährung aufwenden müssen und häufig weniger
als 2250 Kalorien täglich verbrauchen, sind absolut arm. Leute, die mehr als 80 % ihres
Einkommens für die Ernährung aufwenden müssen und dabei von schwerer Unterernährung
bedroht sind, werden als ,,ultra-arm" klassifiziert (Nohlen und Sottoli, 2002, 68-70).
Armut scheint trotz unvollständiger Paneldatenanalysen eher transitorisch zu sein, das
heißt, dass es zwar mehrere Menschen über die Armutsgrenze schaffen, diese allerdings sehr
anfällig dafür sind, wieder darunter zu fallen (Durth et al., 2002, 16). Das Armutsniveau
wird entweder durch einkommens- oder konsumbasierte Indikatoren gemessen. Die Wahl
einer oder der anderen Operationalisierung hat praktische Auswirkungen, und zwar ist sie
für die Bestimmung entwicklungspolitischer Maßnahmen entscheidend.
Die
Überwindung
der
Massenarmut
gestaltet
sich
aufgrund
erheblicher
Bevölkerungswachstumsquoten in den Entwicklungsländern als äußerst schwierig. Die
jetzige Bevölkerungsdynamik in den Entwicklungsländern weicht bedeutend von dem unter
dem Stichwort ,,demographischer Übergang" bekannten Trend, der in den letzten 150 Jahren
in Europa stattfand, ab. In den ersten europäischen Entwicklungsphasen, d. h. in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sanken die Sterberaten durch einen besseren Zugang
zu medizinischer Versorgung und Hygiene, während die Geburtenraten konstant blieben.
Später wirkte die Verringerung der Geburtenraten aufgrund der Säkularisierungs- und
Verstädterungsprozesse dem anfänglichen Bevölkerungswachstum entgegen. In den letzten
50 Jahren haben sich die Geburtenraten in den Entwicklungsländern nicht merkbar reduziert
und sind in einzelnen Fällen sogar gestiegen. Die Senkung der Anzahl Neugeborener wurde
nur in Südost- und Südasien durch Zwangsmaßnahmen teils erreicht. Die in der Dritten
Welt bei 2,5 % liegenden jährlichen Geburtenraten werden in weniger als dreißig Jahren
zur Verdopplung der Weltbevölkerung führen (Durth et al., 2002, 28-31). Die Folge dieses
raschen Wachstums wird eine Abnahme der Arbeitskraft in dem jeweiligen Land sein, weil
eine zunehmende Anzahl an Kindern und Jugendlichen einer niedrigen Zahl erwerbsfähiger
Menschen gegenübersteht. Viele von diesen Kindern sind Waise und müssen sich selbst
versorgen, weil die Eltern z. B. an Aidsinfektionen, Seuchen oder aufgrund von Kriegen
gestorben sind. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für die Entwicklungsländer
dar, die sie in einem ersten Moment ihrer Industrialisierung nur schwierig bewältigen
können. Den demographischen Wandel wie in den Industrieländern durch den Ausbau des
Wohlfahrtstaates zu meistern, scheint in der Dritten Welt eine unwahrscheinliche Lösung
(Durth et al., 2002, 28-31).
In der vorliegenden Studie wird, wie oben bereits erwähnt, Entwicklung als
Armutsreduktion verstanden und die beschriebene vielschichtige Definition der Armut als
Ganzes berücksichtigt. Die Relevanz des Bevölkerungszuwachses für die geringe Entwicklung
5
2. Theoretische Grundlagen
von Ghana und Uganda wird geprüft. Die UN haben viele statistische Indikatoren
gewählt, um die Vergleichbarkeit der Entwicklung verschiedener Länder zu gewährleisten
und parallel hierzu die Effizienz von entwicklungspolitischen Maßnahmen zu überprüfen.
Die Teilindikatoren für die Messung der Armut sind dennoch vor allem für die
Entwicklungsländer oft unvollständig oder die Daten nur für sehr kurze Zeiträume
verfügbar. In dieser Arbeit wird die Beschäftigungsquote als Proxy-Variable für die
Entwicklung gewählt, da von Mosley und Rock bewiesen werden konnte, dass Familien
das überschüssige Geld, das von den Gehältern von langfristigen Arbeitsverhältnissen übrig
bleibt, für die Gesundheit oder die Bildung ihrer Kinder verwenden (Mosley und Rock, 2004).
Insgesamt betreffen die Aussagen der Entwicklungsökonomie nicht nur die heutigen
Entwicklungsländer, sondern auch die Industrieländer. Wirtschaftsgeschichtlich gesehen
können einige Besonderheiten bzw. Eigenschaften entwickelter Volkswirtschaften durch
die in dieser Abschlussarbeit vorgestellten Ansätze erklärt werden. Die heutigen
Entwicklungsländer stellen das am meisten untersuchte Objekt der Entwicklungsökonomie
dar. Die in dieser Studie vorgestellte Analyse behandelt deshalb zwei afrikanische
Entwicklungsländer, Ghana und Uganda, die beachtenswert ähnliche Fälle bilden. Die
Gründe der Auswahl der zwei Länder werden in Kapitel 3.1 eingehend erläutert.
2.2
Grundlegende Definitionen zur Entwicklungspolitik
Bodemer schreibt: ,,Unter Entwicklungspolitik (EP) ist die Summe aller Mittel und
Maßnahmen zu verstehen, die von den Entwicklungsländern (EL) und Industrieländern
(IL) eingesetzt und ergriffen werden, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
EL zu fördern, d. h. die Lebensbedingungen der Bevölkerung in den EL zu verbessern."
(Bodemer, 2002, 224). Die Entwicklungspolitik besteht also aus den Zuschüssen, den
niedrig verzinsten Krediten und der technischen Zusammenarbeit, die die Industrieländer
und die internationalen Organisationen jährlich an die Entwicklungsländer vergeben. Auch
Maßnahmen internationaler Handels- und Außenpolitik, wie z. B. gebundene Hilfen
2
, wirken
auf das Wachstum der Empfängerländer ein.
In der vorliegenden Abschlussarbeit wird die Entwicklungszusammenarbeit durch die
Indikatoren, die vom Development Assistance Committee (DAC) zusammengestellt wurden,
und zwar durch den Betrag an ,,Net official development assistance and official aid
(constant 2007 US$)", gemessen. Das DAC versteht unter dem Begriff ,,Netto-Betrag
öffentlicher Entwicklungshilfe" (,,Net official development assistance") die Auszahlung von
Zuschüssen und Darlehen zu günstigen Bedingungen (nach Abzug der Rückzahlung
des Grundkapitals) seitens offizieller Behörden der Mitglieder des DAC, multilateraler
2
Hiermit sind Darlehen, Zuschüsse oder gebundene Finanzierungspakete mit einem Zuschusselement von mehr
als 0 % gemeint, die an den Bezug von Waren oder Dienstleistungen aus dem Geberland gebunden sind.(EU, 1979)
6
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
Institutionen und Nicht-DAC-Länder. Hiermit soll die wirtschaftliche Entwicklung und
Verbesserung der Lebensbedingungen in Ländern und Gebieten der DAC-Liste gefördert
werden. Die öffentlichen Entwicklungshilfen beinhalten Darlehen mit einem Zuschusselement
von mindestens 25 % (Berechnung der Diskontrate von 10 %). Der ,,Netto-Betrag öffentlicher
Hilfe" (,,Net official aid ") bezieht sich dagegen auf die Hilfe (nach Abzug der Rückzahlung
des Grundkapitals) von offiziellen Gebern an Länder und Gebiete in dem zweiten Teil der
DAC-Liste der Empfänger: besser entwickelte Länder in Mittel- und Osteuropa, Länder
der ehemaligen UdSSR und einige besser positionierten Entwicklungsländer und -gebiete
(World-Bank, 2010b). Die Unterscheidung zwischen den zwei Teilen der DAC-Liste ist für
die Analyse dieser Abschlussarbeit nicht relevant, weil Ghana und Uganda immer im ersten
Teil der Liste der DAC-Empfängerländer verzeichnet gewesen sind und zudem wurde die
Einordnung der Länder im Jahr 2005 geändert und diese zweite Gruppe komplett aufgelöst.
Allgemein ist die Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit auf die Wirtschaftslage der
Dritten Welt äußerst umstritten: Die radikalen Kritiker der Entwicklungshilfe plädieren
für deren vollständige Abschaffung, weil diese den Empfängerländern nur Schaden
zufüge (Erler, 1985, 8). Auf die schlechte Vergabepraxis von Geldern gehen sowohl
die Kritiker als auch die Befürworter der Entwicklungspolitik ein: Nach der Auffassung
von Myrdal und Bauer unterstützen die Industrieländer durch ihre Finanzierung die
undemokratischen Machtinhaber und verschlechtern so die Situation der Armen (Myrdal,
1981, 87)(Bauer, 1993). Bauer glaubt wiederum, dass die Auslandshilfe weder eine
notwendige noch eine hinreichende Bedingung für die Entwicklung der Länder sei und
dass nationale soziale, politische und persönliche Faktoren eine erhebliche Rolle spielen.
Er erwähnt die Erfahrung heutiger Industrieländer und einiger Entwicklungsländer,
die jeweils ohne bzw. vor Vergabe der Entwicklungshilfe bedeutende Wachstumsraten
aufwiesen (Bauer, 1982, 9). Auch die Befürworter der Entwicklungspolitik erkennen
die Bedeutung der nationalen sozialen, politischen und persönlichen Gegebenheiten und
die Misswirtschaft des Transfers der Ressourcen seitens der Eliten der Geber- und
Empfängerländer an, allerdings stimmen sie mit der Ansicht der Weltbank überein, dass
die Entwicklungshilfen in mehrerlei Hinsicht langfristig eher Nutzen als Schaden gebracht
haben (World-Bank, 1985). Entwicklungspolitische Angelegenheiten werden eingehend vor
allem von der Entwicklungsökonomie, die von den Erkenntnissen der Soziologie, Psychologie,
Umweltforschung usw. profitiert, analysiert.
2.3
Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
Die Entwicklungsökonomie ist ein sehr junges, selbstständiges akademisches Fach, das
vor etwa 50 Jahren etabliert wurde, auch wenn seine Kernthemen schon lange in
volkswirtschaftlichen Überlegungen anwesend sind. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert
7
2. Theoretische Grundlagen
stellten sich Wissenschaftler die Frage, wie die moderne bürgerlich-kapitalistische
Gesellschaft entstanden ist und wie die Nachzügler die Entwicklung aufholen konnten. Auf
diesem Hintergrundanliegen beruht die gesamte ökonomische Theorie.
2.3.1
Die Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert
Im 17. und 18. Jh. waren die Merkantilisten der Meinung, dass positive Handelsbilanzen
durch Zölle und Importverbote, Ausbeutung der Gold- und Silberminen und die Plünderung
der Kolonien vor allem zum Wohlstand des eigenen Landes beitragen würden und nur eine
erhebliche Staatseinmischung in die Wirtschaft könne das nationale Wachstum gewährleisten
(Marzano, 1998). Dieser Ansatz wurde von den Klassikern, besonders von Adam Smith und
David Ricardo, in Frage gestellt, weil sie glaubten, dass Reichtum nur durch Arbeitsteilung,
technischen Fortschritt und die Spezialisierung nach dem Grundsatz absoluter und
komparativer Kostenvorteile erreicht werden könne (Smith, 1776)(Ricardo, 1817). Später
erhoben die Nachzüglerländer der Industrialisierung, z. B. das heutige Deutschland oder
Frankreich, den Anspruch, die internationalen Freihandelsprinzipien zu missachten und die
,,unreifen" Industrien durch Zölle oder ähnliche Maßnahmen zu schützen, um den Vorsprung
Großbritanniens aufzuholen (List, 1841). Etwa zur gleichen Zeit ging Karl Marx auf den
Verteilungskonflikt zwischen Kapitalisten und Arbeitnehmern ein und schlussfolgerte die
Instabilität und den zyklischen Verlauf des kapitalistischen Systems. Marx erweiterte seinen
Ansatz auf internationaler Ebene, indem er die Parallelität zwischen den Sozialklassen
innerhalb der Industrieländer hervorhob, und übertrug ihn auf das Verhältnis zwischen
Europa und den Kolonien. Er deutete den wirtschaftlichen Aufstieg des kapitalistischen
Zentrums Europas als Folge der Ausbeutung der Peripherie (Marx und Engels, 1894). Diese
Position blieb lange Zeit so bestehen und wurde zur Kernaussage heutiger marxistischer und
nicht-marxistischer Dependenztheorien. Die Analyse von Entwicklungsphänomenen wurde
in den Jahrzehnten nach Marx' Ansatz vernachlässigt, weil sich die neoklassische Schule
abgesehen von Joseph Schumpeter, dessen Ansatz im folgenden Kapitel vertieft wird im
19. Jahrhundert auf die statische Mikroökonomie konzentrierte.
2.3.2
Joseph Schumpeter und seine Theorie einer dynamischen Ökonomie
Wie bereits gesagt, Joseph Schumpeter stellt ab Anfang des 20. Jahrhunderts eine
Ausnahme dar, weil er sich mit der dynamischen Strukturökonomie beschäftigte. Er
ging von einer kreisförmigen Wirtschaft aus, wo die Verhältnisse zwischen den Sektoren
jeweils gleich bleiben und das System sich zu ,,*steady-state-Bedingungen" entwickelt,
indem alles in einem dynamischen Gleichgewicht bleibt. Schumpeter beschreibt den Verlauf
einer kreisförmigen Ökonomie auf folgende Weise: ,,Jede Wirtschaftsperiode gleicht in
8
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
den Grundzügen wie in der Masse der Einzelheiten der vorhergehenden und erledigt
im Wesen, produzierend und konsumierend, dieselben Aufgaben wie diese. Das liegt
nicht nur daran, dass der stetige Kreislauf von Produktion und Konsumtion immer
wieder - gleichsam bei jeder Umdrehung jahraus jahrein - dieselbe objektive Situation
schafft, die wesentlich immer dieselben Möglichkeiten darbietet und andere ausschließt,
sondern auch daran, dass die Wirtschaftssubjekte mit wesentlich immer der gleichen,
festgewordenenen und sich nur langsam ändernden Mentalität, denselben Kenntnissen
und Erfahrungen, derselben Weite des Gesichtskreises, denselben Produktionsmethoden,
Geschäftsgewohnheiten, Geschmacksrichtungen und im Besitz derselben Beziehungen,
Kunden, Lieferanten, Konkurrenten an sie herantreten und unter dem Druck der
Notwendigkeiten des Alltags in der Regel herantreten müssen."(Schumpeter und Haberler,
1987, 150-151)
Allerdings lehnt Schumpeter ab, dass die *steady-state-Bedingungen zu einer tatsächlichen
Ökonomie passen. Eine dynamische Ökonomie ist vor allem durch den Prozess der
Entwicklung gekennzeichnet, der ,,unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus
revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue
schafft"(Schumpeter und Seifert, 1942, 137). Diese schöpferische Zerstörung ist im
Sinne von Schumpeter ,,Anderswerdung des Produktionsmittelvorrats der Volkswirtschaft"
(Schumpeter, 1911, 103). Mithilfe der Investitionen, die von schöpferischen Unternehmern
getätigt werden, kann der zyklische Vorgang der Wirtschaft erklärt werden.
Die Gesamtinvestitionen sind die Summe autonomer Investitionen (I
At
), die langfristig
den wirtschaftlichen Trend bestimmen, und der induzierten (I
It
), die die Schwankungen
des Einkommens bewirken. Die autonomen Investitionen sind durch die Wachstumsrate
natürlicher Ressourcen und der Technologie bedingt: I
At
(
N R
t
;
T
t
). Die induzierten
Investitionen hängen von kurzfristigen Überlegungen, und zwar vom Profit (P
t
),
Kapitalbestand (K
t-1
) und Zinssatz (i
t
) in einem Land, ab: I
It
= I
t
(P
t
; K
t-1
; i
t
) (Marzano,
1998, 83-96)(Omer, 2002, 61-70).
Schumpeter geht auch auf den Einkommensverteilungskonflikt ein, indem er die Relevanz
der Quote des Unternehmensgeistes (E
t
) analysiert. E
t
ist bedingt durch den Profit und
das Sozialklima in einem Land (
t
): E
t
=E (P
t
;
t
).
t
bezieht sich auf den politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnungsrahmen und hängt vom Verhältnis zwischen
dem Profit und Reallohn (W
rt
) ab:
t
= (
P
t
/
W
rt
). Dem Sozialklima schreibt Schumpeter
eine erhebliche Rolle zu. In seinem Ansatz führt die Entstehung eines investitionsfeindlichen
Sozialklimas durch die Erlangung eines größeren Anteils des Einkommens seitens der
Arbeitnehmer als seitens der Profitbezieher zur Euthanasie des Kapitalismus und zur
Trust -dominierten Wirtschaft (Marzano, 1998, 83-96)(Omer, 2002, 61-70).
9
2. Theoretische Grundlagen
2.3.3
Von den neoklassischen Ansätzen bis Keynes
Die neoklassischen Volkswirten folgten in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts
der Lehre von Schumpeter nicht, weil sie den Fokus ihrer Untersuchungen von der
dynamischen Wirtschaft, die im Schumpeters Ansatz zentral war, auf die statische
Mikroökonomie verlegten. Auch die Entscheidungsträger der Industrieländer befürworteten
bis Mitte der 30er Jahre die Lehrsätze neoklassischer Ökonomie, allerdings entsprach
die politische Umsetzung nicht ihren theoretischen Vorstellungen, weil sie immer
öfter protektionistische Maßnahmen einführten. Die daraus folgende Schrumpfung des
Welthandels war eine der Ursachen der Wirtschaftskrise des Jahres 1929 (Marzano, 1998,
97). Dieses entscheidende Erlebnis ebnete jedoch den Weg für neue theoretische Ansätze:
1936 gab Keynes seinen Ansatz der Öffentlichkeit bekannt, in dem der Staat fehlende
private Nachfrage durch Staatsnachfrage ausgleichen soll. Keynes lehnte die Gültigkeit des
Say'schen Gesetzes
3
in einer entwickelten Ökonomie ab und zeigte, dass eine Tendenz zur
vollen Auslastung keineswegs immer bestehen muss und ein wirtschaftliches Gleichgewicht
auch bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und ungenutzter Produktionskapazität eintreten kann
(Keynes, 1936). Der Keynesianismus galt vierzig Jahre lang als theoretisches Dogma der
politischen Ökonomie und war daher das erste Wirtschaftsmodell, das sich bewusst mit
den Problemen der Entwicklung der Dritten Welt beschäftigte (Keynes, 1930)(Keynes,
1936)(Keynes, 1940). Die westliche Praxis der Entwicklungszusammenarbeit war lange Zeit
mit den keynesianischen Kernaussagen verbunden.
2.3.4
Wachstumsorientierte Entwicklungsprogramme
Die Wurzeln der Entwicklungshilfe sind bereits im 19. Jahrhundert in den ,,infant colony
subsidies" zu finden, das heißt im Geldtransfer unter weichen Leihbedingungen seitens der
Kolonialmächte zu den Kolonien (Mosley, 1987). Allerdings entstand die heutige Form der
Entwicklungzusammenarbeit am Ende der 40er Jahre nach dem Vorbild des Marshall-Plans.
Dank dieses von den USA finanzierten Wiederaufbauprogramms gelang es, innerhalb
weniger Jahre die Wirtschaft und die Gesellschaft europäischer vom Krieg zerstörter Länder
wieder instand zu setzen. Das Wirtschaftswunder in Westeuropa und die Dekolonialisierung
Afrikas und Asiens verstärkten die moralische Verbindlichkeit in den Industrieländern, den
unmittelbar zuvor unabhängig gewordenen Nationen Entwicklungshilfe zu leisten (Omer,
3
Ein von Say aufgestellter Satz der klassischen Lehre, nach dem eine allgemeine Überproduktion in einer
Volkswirtschaft unmöglich sei, da jedes Angebot in demselben Umfang kaufkräftige Nachfrage schaffe, die durch
Faktoreinkommen und Gewinne dem Wert der erstellten Produkte entspreche. Jede Produktion schaffe sich also
ihre eigene Nachfrage. Das Geld sei nur ein Schleier, der den eigentlichen Tatbestand verhülle, dass die Produkte
immer nur mit Produkten gekauft werden. Demnach sei nur eine partielle Überproduktion möglich, der eine
Unterproduktion an anderer Stelle entspreche. Diese Ungleichgewichtssituation sei aber nur temporär und werde
durch den Preismechanismus beseitigt (Wohltmann, 2010b). Das Say'sche Gesetz stellt die Grundannahme jedes
neoklassischen Ansatzes dar und wurde auch von den Klassikern mit Ausnahme von Malthus und Marx
angenommen (Marzano, 1998, 97).
10
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
2002, 3-7). Dieser neue Politikbereich wurde der Öffentlichkeit zum ersten Mal am 20.
Januar 1949 durch das ,,Point Four Program" vom US-amerikanischen Präsidenten Truman
vorgestellt (Browne, 1990, 14). Seine Rede war primär humanitärer Natur, allerdings stand
die Verkleinerung des sowjietischen ideologischen Einflussbereichs im Hintergrund.
In den 50er Jahren befürworteten viele Industrieländer sowie internationale Organisationen
wachstumsorientierte Programme. Man glaubte, dass die Förderung hochbegabter
Elitemitglieder unterentwickelter Länder zunächst das Wachstum und dann, mittels
Durchsickerungseffekten, die Verbesserung der Situation der Armen herbeigeführt hätte.
Diese Auffassung beruhte auf der sogenannten ,,U-Hypothese" von Kuznets, der aufgrund
vergleichender statistischer Untersuchungen über die Industrialisierungsprozesse in diversen
Ländern zu der Aussage gelangt war, dass eine zu Beginn der Industrialisierung vorhandene
eher egalitäre Einkommensverteilung sich in eine stärker ungleiche verwandelt, die sich erst
mit fortschreitender Industrialisierung wieder abbaut (Kuznets, 1955)(Menzel, 1993, 135).
Der Fokus auf das wirtschaftliche Wachstum war den keynesianischen und neoklassischen
Ansätzen gemein und blieb bis zu den 90er Jahren vorherrschend. Die Wirtschaftstheorie, die
sich heute durchgesetzt hat, erkennt die Akkumulationsrate (
I
t
/
K
t-1
) als die Hauptvariable
des Wachstums an. Das Hauptziel der Entwicklungsökonomie ist es, die effektive (G),
wünschenswerte (G
w
) und natürliche (G
n
) Wachstumsrate einander anzugleichen. Unter
wünschenswertem Wachstum wird der Zustand verstanden, in dem alle Wirtschaftssubjekte
mit ihren Investitions- und Konsumentscheidungen zufrieden sind. Die Unternehmerschaft
glaubt, dass in diesem Fall keine zusätzliche Investition notwendig ist, um das erwartete
Profitniveau zu erlangen. Diese Begebenheit gewährleistet die Nachhaltigkeit des Systems
und das Wachstum in Gleichgewichtsverhältnissen zwischen den Sektoren und beruht auf
der theoretischen Relevanz der Erwartungen, die erstmals von Keynes formuliert wurden
und später auch in der neoklassischen Theorie Eingang fanden (Marzano, 1998, 100-120).
Die natürliche Wachstumsrate entspricht dem Zuwachs der Arbeitskraft und dem technischen
Fortschritt. Die Wirtschaft sollte in einem Vollbeschäftigungszustand während der gesamten
Entwicklungsphase wachsen. Strittig ist die Frage, wie die Äquivalenz G=G
w
=G
n
umgesetzt
werden kann (Marzano, 1998, 100-120)(Gabler-Verlag, 2010a).
Die Neokeynesianer schlussfolgern, dass es unwahrscheinlich ist, dass die oben erwähnte
Gleichung (G=G
w
=G
n
) spontan auf dem Markt erreicht wird. Sie setzen großes
Vertrauen in die makroökonomische Steuerung des Staates, der die Sparneigung der
Kapitalisten (s
p
) durch Besteuerung und öffentliche Investitionen erhöhen kann. In fast allen
neokeynesianischen und neoklassischen Modellen spielt die Sparneigung der Arbeitnehmer
(s
w
) eine nebensächliche Rolle, weil sie als gleich null bzw. niedriger als die der
Kapitalisten (s
w
< s
p
) angenommen wird. Allerdings berücksichtigen die neokeynesianischen
und neoklassischen Ansätze nicht, dass ein Mensch sein Einkommen aus verschiedenen
Quellen, etwa aus dem Gehalt, aus Renten und Profiten, beziehen kann (Marzano, 1998,
97-159).
Die Neoklassiker des 20. Jahrhunderts argumentieren, dass die keynesianischen
11
2. Theoretische Grundlagen
und neokeynesianischen makroökonomischen Steuerungsstrategien ausschließlich der
kurzfristigen Stabilisierung dienen. Sie vertrauen auf einen Markt, der nicht gesteuert
werden muss, um langfristig bessere Wachstumsziele über die Zyklusstabilisierung hinaus
zu erreichen. Die neoklassischen Ansätze der 50er und 60er Jahre bauen auf die
Cobb-Douglas-Funktion
4
auf, lehnen den neutralen exogenen technischen Fortschritt à la
Harrod ab und ersetzen ihn mit dem von Hicks. In beiden Modellen ist der technische
Fortschritt jeweils exogen und neutral. Allerdings ist die Bedeutung der Neutralität jeweils
unterschiedlich: Hicks vergleicht zwei Punkte der Funktion des Produkts je Beschäftigte
(x
=X
/
N
) unter einer konstanten Rate von Kapital und Arbeit (k=
K
/
W
), so dass das Verhältnis
zwischen der marginalen Produktivität der Arbeit und des Kapitals sowie zwischen ihren
Verteilungsquoten konstant bleiben:
x > 0; wenn k=¯k, so beschaffen, dass
w
'
/
r
=
w
/
r
.
Harrod verglich zwei Punkte der Funktionen des Produkts je Beschäftigte (x
=X
/
N
) unter
einer konstanten Profitrate, so dass das Verhältnis zwischen Kapital und Produkt konstant
bleibt:
x > 0 ; wenn r=¯r, so beschaffen, dass x= k. 1956 führte Solow die Elastizität
der Faktorsubstitution gleich eins (= 1) ein. Dadurch wurden die Gleichungen von
Hicks und Harrod gleich: (
x
/
x
)= (
k
/
k
)
(
w
r
/
rk
)
1
=
(
w
r
/
rk
)
2
(Marzano, 1998, 167-171). Das
Solow- und das Solow-Ramsey-Modell kommen 1956 bzw. 1965 zu dem Ergebnis, dass die
Erhöhung gesellschaftlicher Sparneigung durch makroökonomische Steuerung nur kurzfristige
Auswirkung haben kann; nur der freie Lauf des Marktes kann langfristig die Konstanz der
Kapitalintensität, d. h. des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit, (k
=
K
/
N
) sowie die
Gleichheit zwischen effektivem, wünschenswertem und natürlichem Wachstum (G=G
w
=G
n
),
bewirken (Marzano, 1998, 161-199).
Der Hauptfaktor des Wachstums ist der neutrale Fortschritt, der allerdings von keiner
internen Verhaltensvariable des Solow- und des Solow-Ramsey-Modells abhängt. Der
Fortschritt als exogener Faktor wird stark von der neoklassischen Theorie des endogenen
Wachstums, besonders von Lucas und Romer, kritisiert (Romer, 1986)(Lucas, 1988). Lucas
4
Die Grundeigenschaften der Cobb-Douglas-Funktion sind die Elastizität der Faktorsubstitution gleich eins (
=1)
und die Inada-Bedingungen. Eine Funktion erfüllt die Inada-Bedingungen, wenn:
· sie linear homogen ist
· sie konstante Skalenerträge aufweist
· sie positive und abnehmende Grenzerträge
(
Y
K
= f
'
> 0;
2
Y
K
2
= f < 0) aufweist
· sie konvex ist
(F
KL
> 0)
· kein Input zu keinem Output führt [F (0, 0) = 0]
· sie von monoton abnehmender Funktion marginaler Produktivität für jeden Produktionsfaktor charakterisiert
ist.
lim
K
F
K
= 0; lim
K0
F
K
= ; lim
L
F
L
= 0; lim
L0
F
L
=
· keine absolute Obergrenze für die Produktion vorhanden ist
lim
K
F (K, L) = , (L > 0; fest); lim
L
F (K, L) = , (K > 0; fest).
(Marzano, 1998, 162)(Ströbele und Meyer, 2010, 16; 20)
12
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
fügt in die Produktionsgleichung [F
= F (K, L)] den Ausbau des menschlichen Kapitals als
einen wichtigen Faktor des endogenen Fortschritts hinzu.
Die Vergrößerung des menschlichen Kapitals hat zwei Effekte, wobei einer intern
ist, und zwar die Erhöhung individueller Produktivität durch Spezialisierung und
Weiterbildung, und der zweite extern, und zwar die Steigerung der durchschnittlichen
Arbeitsproduktivität des gesamten produktiven Systems. Letzterer ist ein positiver Effekt,
der nicht an den Entscheidungen der Beschäftigten liegt (Marzano, 1998, 200-213)(Lucas,
1988). Wegen des zweifachen Effekts lautet die Lucassche Produktionsfunktion wie
folgt: X
= AK
t-1
[uhN]
h
. Hierbei wird das anfängliche Technologieniveau (A) als
konstant angenommen. Die Hauptvariablen sind der Kapitalbestand (K
t-1
), die Anzahl
an Beschäftigten (N ), das Niveau des Know-Hows des jeweiligen Beschäftigen (h) und der
Zeitanteil, den die Beschäftigten der Produktion widmen (u). h erscheint zweimal, weil das
erste h auf den internen Effekt, das zweite h auf den externen verweist. Die Variablen werden
jeweils in -,- und -Potenz erhoben. und sind die Quoten an Profiten und Löhnen
im Nationaleinkommen; ist die Elastizität des Produktes auf die externen Effekte des
Erwerbs des Know-Hows seitens der Beschäftigten. Die Akkumulationsrate des Know-Hows
( h) hängt proportional von einer konstanten Regenerationsrate des menschlichen Kapitals
() ab, vom anfänglichen Bestand des menschlichen Kapitals (h)
5
und von dem Zeitanteil,
den die Beschäftigten der Weiterbildung widmen (1-u), ab: h
= h(1 - u). Die Linearität
des Verhaltens von h ist die Haupthypothese des Ansatzes, die den Verlauf der effektiven
Wachstumsraten erklären soll
6
. Ferner liefern Investitionen in menschliches Kapital keine
abnehmenden Erträge, wenn dessen Bestand sich vergrößert, weswegen h der Hauptfaktor
des kapitalistischen Wachstums ist (Marzano, 1998, 200-213)(Lucas, 1988).
Innerhalb der neokeynesianischen und neoklassischen Grundmodelle haben sich die
verschiedenen Strömungen für verschiedene Strategien und Instrumente zur Unterstützung
der Investitionsbereitschaft unterschieden. Die Vertreter der Theorie des ausgewogenen
Wachstums weisen auf den Teufelskreis unzureichender Investitionsnachfrage hin: Da die
Unternehmer aufgrund enger Absatzmärkte eine geringe Investitionsbereitschaft zeigen,
können offen oder latent vorhandene Ersparnisse nicht produktiv investiert werden;
dies führt wiederum zu geringen Einkommen und niedrigen Absatzchancen. Es wird
von den Befürwortern der Theorie als Lösung vorgeschlagen, alle Wirtschaftszweige
eines Landes in einem ausgewogenen Verhältnis wachsen zu lassen, damit das
Angebot
an
Kapital
in
allen
Zweigen
deren
Nachfrage
gleicht
dies
würde
Absatzrisikos
mindern
und
die
Investitionen
unterstützen
(Omer,
2002,
47-50).
Allerdings übertrifft die gleichgewichtige Finanzierung aller produktiver Sektoren oft
trotz der Entwicklungszusammenarbeit die verfügbaren finanziellen Ressourcen und die
5
Im Lucasschen Modell ist der Akkumulationsprozess des menschlichen Kapitals eine gesellschaftliche Tätigkeit,
weil die älteren Beschäftigen den jüngeren ihr Know-How weitergeben. Das Ausgangsniveau des Know-Hows der
jüngeren Beschäftigten entspricht dem in der Gesellschaft bereits vorhanden (Lucas, 1988, 19).
6
Wenn das Akkumulationsgesetz des menschlichen Kapitals [
h = h
(1 - u)] und 0 < < 1wären, fände
kein endogener Wachstum statt. Die Funktion würde unter demselben Akkumulationsgesetz und
> 1 explosive
Schwingungen aufweisen (Solow und Sordi, 1992).
13
2. Theoretische Grundlagen
Verwaltungskapazität der Dritten Welt (Omer, 2002, 48). Von diesem Ausgangspunkt
argumentiert Hirschman, dass die Ersparnisse in den Entwicklungsländern ausreichend
vorhanden sind, allerdings fehlten investionsfähige und -willige Unternehmer. Aufgrund
des sozialen, ökonomischen und politischen Ordnungsrahmens mangelt es bei den
Wirtschaftsakteuren an Risikofreude und Investitionsbereitschaft. Hirschman erklärt, dass
Ungleichgewichte in ersten Entwicklungsphasen Anreize zu technischen Fortschritten und
organisatorischen Aufbesserungen seien (Hirschman, 1967). Derartige Engpässe sind dennoch
ein zweischneidiges Schwert, da sie sich in Monopolstellungen verwandeln können und der
Entwicklung ein vorzeitiges Ende setzen können (Timmermann, 1982, 188).
2.3.5
Kritik an den wachstumsorientierten Programmen und die Durchsetzung
der Dependenztheorie
In denselben Jahren, etwa ab 1969, wurde die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik in
Frage gestellt. In diesem Jahr schloss eine von dem ehemaligen kanadischen Außenminister
Pearson geleitete Expertenkommission eine Untersuchung über die Leistungen der
Entwicklungspolitik seit dem Anfang der 50er Jahre ab. Der Ausschuss stellte die
optimistische Auffassung in Frage, dass das wirtschaftliche Wachstum zur Entwicklung der
Dritten Welt geführt habe und hielt es für unwahrscheinlich, den Scheitelpunkt der U-Kurve
von Kuznets (Kuznets, 1955) zu überwinden und zu einer fairen Einkommensverteilung zu
gelangen. Der Bericht stellte darüber hinaus fest, dass die Strategie der Importsubstitution
einen mittelmäßigen Erfolg bei der Produktion von Konsumgütern hatte und sie aufgrund
des Mangels der Binnennachfrage für die Investitionsgüter in diesem Bereich vollkommen
gescheitert war.
Den Entwicklungsagenturen wurde allmählich bewusst, dass das westeuropäische
Wirtschaftswunder sich keineswegs in der Dritten Welt wiederholen würde. Die Gründe
für solch andere Resultate der Entwicklungshilfe im Vergleich zu dem Erfolg des
Marshall-Programms sind umstritten. Es wird oft behauptet, dass das materielle Kapital
nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa einerseits zerstört war, dass aber anderseits
noch fast alle Länder über hochwertiges Humankapital, organisatorisches Know-How
und gut funktionierende Verwaltungsapparate verfügten. Der Marshall-Plan füllte den
Mangel an materiellem Kapital aus. In der Dritten Welt dagegen ist das physische
Kapital nicht der einzige Entwicklungsengpass; funktionierende Infrastrukturen, gut
ausgebildetes Humankapital und verlässliche Governance fehlen heute immer noch (Omer,
2002, 3-7). Die Dependenz-Theoretiker kritisieren dennoch die ahistorische Position der
Modernisierungsansätze und weisen nicht nur auf die innergesellschaftlichen, sondern
vorrangig auf die außenwirtschaftlichen Faktoren hin.
Das Hauptmerkmal der Unterentwicklung ist die Abhängigkeit der Dritte-Welt-Länder
von den Industrieländern, die als externe Variable und als Eigenschaft internationaler
14
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
Gesellschaftsstruktur verstanden wird. Das Dependenzverhältnis überschneidet sich
begrifflich mit dem Kolonialismus und Neokolonialismus. Vertreter der Dependenztheorie
befürworten im Allgemeinen eine Umgestaltung aktueller internationaler Strukturen,
allerdings sind sie sich nicht einig darüber, ob die Organisation heutiger internationaler
Beziehungen tatsächlich zur Entwicklung der Dritten Welt führen wird. Einige glauben,
dass zwar Wachstum und Akkumulation, nicht aber eine Entwicklung stattfinden
können (Boeckh, 1982, 142), andere glauben wiederum, dass einige Staaten trotz der
Abhängigkeitsverhältnisse ihren Entwicklungsstand verbessert haben (Sautter, 1975).
Die Dependenz-Theorie konnte sich in den Industrieländern, abgesehen von der
Unterstützung einiger Linksparteien, nicht durchsetzen, wurde allerdings von einigen
Regierungen der Dritten Welt befürwortet, um den Anschuldigungen von Geldmisswirtschaft
entgegenzutreten.
2.3.6
Die Grundbedürfnisstrategie
Die
Entwicklungsagenturen
reagierten
auf
die
heftige
Kritik
bezüglich
des
Scheiterns der Entwicklungspolitik der 50er und 60er Jahre mit der Lancierung der
Grundbedürfnisstrategie, die zuerst von dem damaligen Präsidenten der Weltbank,
McNamara, formuliert wurde. Seine Äußerungen wurden von den Vertretern marxistischer
und nicht-marxistischer Dependenzansätze heftig kritisiert. Diese meinten, dass die
Industrieländer
beabsichtigten,
die
Konkurrenz
durch
die
Entwicklungsländer
bei
Fertigprodukten zu unterbieten (Omer, 2002)(Boeckh, 1993).
In den 70er Jahren entstand das Bewusstsein, dass es der Dritten Welt an Infrastrukturen,
die der Gesellschaft die Gewinne des Wachstums zuteilten, mangelte. Allerdings wurden
trotz dieser Erkenntnis lange Zeit keine Maßnahmen mit dem Schwerpunkt, Infrastrukturen
zu fördern, eingeführt. Der Hauptgrund dafür war, dass ein solcher Aktionsplan keine
unmittelbaren sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen hat. Viele Industrieländer
zögerten dabei, weil sie begriffen, dass die Anziehungskraft erwähnter Maßnahmen zur
westlichen Welt für die regierenden Eliten in international abgespannter Atmosphäre
des Kalten Kriegs niedriger war als von Projekten, die auf das kurzfristige Wachstum
zielten. Darüber hinaus war der Zustand der unteren Schichten der Bevölkerung vieler
Entwicklungsländer so elend, dass es eine Priorität war, zu vermeiden, dass Millionen
Menschen vor Hunger oder Seuchen starben. Da der Betrag von Geldern für die
Entwicklungszusammenarbeit begrenzt war, standen die zwei Ziele, also die Förderung der
Infrastrukturen und das blanke Überleben zu sichern, im Konflikt (Omer, 2002)(Boeckh,
1993). In diesem Kontext schlossen sich auf Anregung von McNamara berühmte politische
Persönlichkeiten zu einer Nord-Süd-Kommission zusammen, um Lösungsvorschläge für die
dringendsten Probleme zu erarbeiten, nachdem die Verhandlungen im Nord-Süd-Dialog ins
Stocken geraten waren. 1980 und 1982 gab das Komitee unter Vorsitz von Willy Brandt
15
2. Theoretische Grundlagen
zwei Berichte heraus und schlug die Einführung einer automatischen Mittelaufbringung
zur Finanzierung der Entwicklungspolitik vor, z. B. durch Abgabe auf den Waffenhandel,
Luft- und Frachttransporte, durch die Ausweitung der Sonderziehungsrechte oder der
Nutzbarmachung der Goldbestände des IWF. Das Komitee befürwortete auch die formelle
und informelle Zusammenarbeit zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern, zwischen
den Entwicklungs- und privaten Banken und sonstigen gesellschaftlichen Akteuren. Die
Nord-Süd-Kommission hob überdies hervor, dass die Entwicklungszusammenarbeit sowohl
zur Armutsüberwindung als auch als antizyklische Maßnahme während der Depression der
70er Jahre hätte wichtig sein können. Die Nachfrage von Konsum- und Investitionsgütern
seitens der Dritten Welt hätte auch die Produktion in den Industrieländern stimulieren
können (Nohlen, 2002d, 617-618)(Nohlen, 2002a, 127-128)(Independent Commission on
International Development Issues und Brandt, 1980, 1983). Einzelne Hinweise zur
Effizienzerhöhung der Entwicklungspolitik wurden in der Grundbedürfnisstrategie von
der Weltbank aufgenommen, allerdings wurden die von der Nord-Süd-Kommission
vorgeschlagenen Reformpläne bisweilen kritisiert bzw. ignoriert. Die Grundbedürfnisstrategie
verlor ihre Relevanz, als konservative Parteien, die neoliberale Ansätze befürworteten,
Anfang der 80er Jahre erneut die Wahlen gewannen.
2.3.7
Die Kontroversen in den 80er und 90er Jahren
Die konservativen Politiker versprachen in den 80er Jahren durch eine strenge
Finanzpolitik und den Abbau des Wohlfahrtstaats im Inland die Staatsbilanzen wieder zu
verbessern. Im Bereich der Entwicklungspolitik unterstützten die neoliberalen Regierungen
die strengen Maßnahmen des IWF und der Weltbank, um die erheblichen öffentlichen
Schuldquoten vieler Entwicklungsländer zu senken und ihre internationale Zahlungsbonität
aufzubessern. Allerdings konnten die initiierten Programme das wirtschaftliche Wachstum
in der Dritten Welt nicht herbeiführen und die Armut mindern; dies führte zu einer
großen Verzweiflung unter den Entwicklungsagenturen (Menzel, 1993, 153). Eine Reaktion
darauf war die Einführung der Strategie nachhaltiger Entwicklung in den 90er Jahren
von der Weltbank, dass heißt ein Plan, der das Wachstumziel mit Umweltschutz,
Familienplanung, dem Schutz der Menschenrechte und der Demokratie koppelte. Dieses
Prinzip leitet heutzutage die Entscheidungen der meisten Entwicklungsorganisationen und
-banken und wurde durch die Verabschiedung der UN-Entwicklungsziele und den partiellen
Erfolg internationaler Verhandlungen für den Klimaschutz noch stärker im internationalen
Normenrahmen verankert (Strübel und Schwehm, 2002, 633).
In der entwicklungsökonomischen Analyse sind heutzutage immer noch zwei Strömungen
zu unterscheiden: Die Monetaristen bzw. Orthodoxen und die Strukturalisten. Erstere
glauben, dass die Lehrsätze der Mainstream-Ökonomie in den Entwicklungsländern
zur kurzfristigen und langfristigen Stabilisierung anzuwenden sind. Gegen den Einsatz
16
2.3. Historischer Überblick der Entwicklungsökonomie und -politik
von dirigistischen Politiken und für den Abbau der riesigen öffentlichen Schuldenberge
schlagen sie strenge monetäre Maßnahmen, wie z. B. Geldentwertung und die Erhöhung
inländischer Zinssätze, vor. Ein Beispiel dafür ist der wirtschaftspolitische Plan, den
Pinochet in den 70er Jahren unter der Beratung von Milton Friedman anwandte
(Agénor und Montiel, 1996, 13-15)(Agénor und Montiel, 2008). Die Strukturalisten
dagegen bestreiten die Effizienz ebendieser Maßnahmen. Der strukturalistische Ansatz
entstammt den Schlussfolgerungen der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und
besagt, dass die Nachfrage der Rohstoffe weniger als die der industriellen Güter wächst,
wenn das Einkommen um denselben Prozentsatz steigt. Aufgrund dessen erfahren die
Entwicklungsländer eine Verschlechterung ihrer *Terms of Trade den Industrieländern
gegenüber. Diese strukturalistisch ausgerichtete Gruppe von Ökonomen befürwortet die
Strategie der Importsubstitution, wobei der Schutz von entstehenden Industriezweigen durch
Handelsbarrieren, Subventionen und überbewerteten Devisenkurs erreicht werden soll. Die
Strukturalisten glauben, dass die Ursachen der Inflation in der Dritten Welt eher ein
relativ niedriges Wachstum der Produktivitätsrate der Landwirtschaft, Preisstarrheit des
Industriesektors und Lohnindexierung als eine übermäßige Geldmenge sind (Agénor und
Montiel, 1996, 13-15)(Agénor und Montiel, 2008).
2.3.8
Wirtschaftsgeographie,
neue
politische
Ökonomie
und
neue
Institutionenökonomik
Jenseits der in Kapitel 2.3.7 dargestellten Grundspaltungen haben sich in den letzten
Jahrzehnten einige neue Ansätze, und zwar die Wirtschaftsgeographie, die neue politische
Ökonomie und die neue Institutionenökonomik, entwickelt. Diese Ansätze gehen von der
Unvollkommenheit der Märkte aus und analysieren innenpolitische und geographische
Faktoren. Die Wirtschaftsgeographen vermuten, dass die räumliche Entfernung der
Entwicklungsländer von den weltwirtschaftlichen Zentren, d. h. den USA, Europa und
Japan, eine relevante Ursache der Unterentwicklung ist. Deswegen schlagen sie vor,
Produktionscluster als neue ökonomische Brennpunkte in der Dritten Welt zu bilden. Eine
derartige Clusterbildung bringt in den ersten Entwicklungsphasen Vorteile und Skaleneffekte,
da sie den Infrastrukturausbau und den Wissenstransfer unterstützt. In einem weiteren
Stadium wird eine Dekonzentration der Produktion bevorzugt, um unerwünschte negative
Verstopfung- und Verstädterungseffekte zu vermeiden (Durth et al., 2002, 173-189).
Die neue politische Ökonomie lehnt die Hauptannahme vieler entwicklungspolitischer
Theorien ab, und zwar dass die Eliten immer für den Wohlstand des jeweilgen Landes
handeln. Oftmals versuchen die Akteure, z. B. die Wähler, Politiker, Bürokraten und
Interessengruppen, die eigenen Interessen zu maximieren (Durth et al., 2002, 191-212). In der
vorliegenden Arbeit wird diese Position ebenfalls vertreten und in einzelnen Fällen zwischen
den verschiedenen Interessen innenpolitischer und internationaler Gruppen unterschieden.
17
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842830240
- DOI
- 10.3239/9783842830240
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Politik- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2012 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- entwicklungsökonomie armutsminderung korruptionsbekämpfung
- Produktsicherheit
- Diplom.de